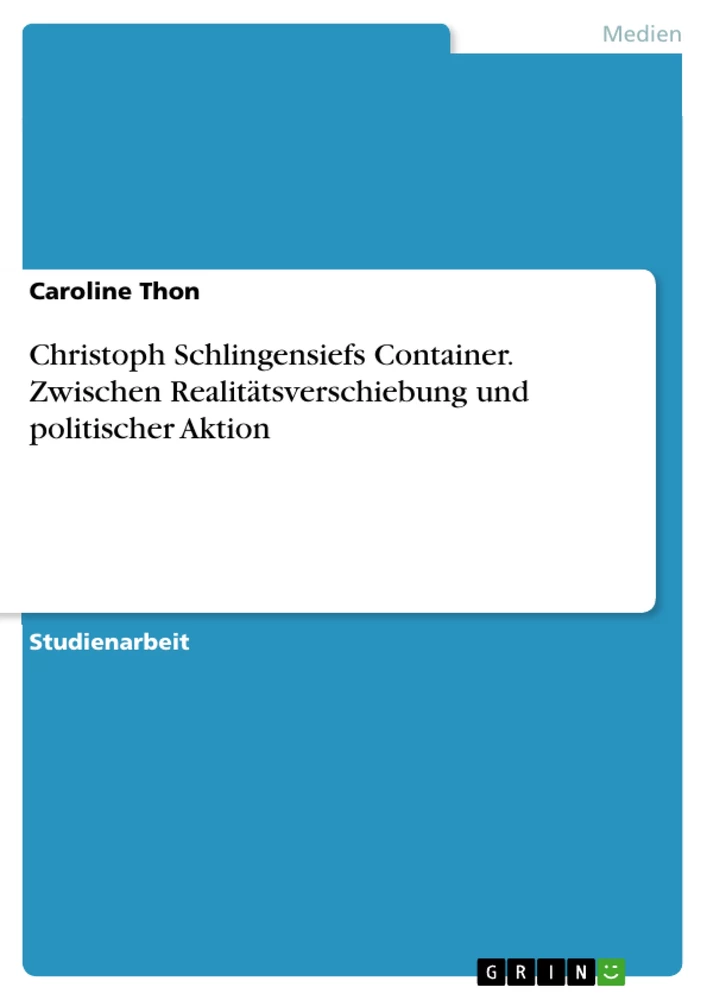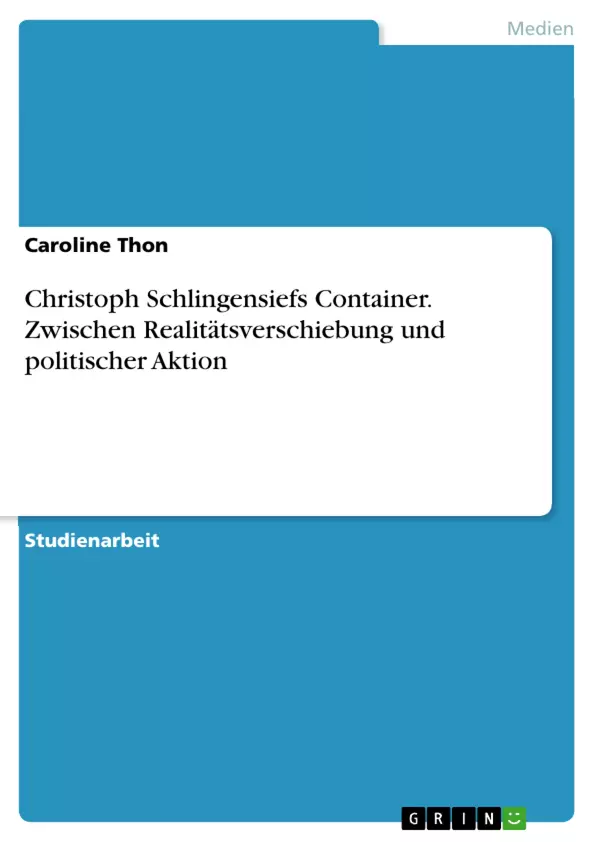Diese Arbeit setzt sich mit dieser vom 09.-16.06.2000 durchgeführten Aktion und der daraus entstandenen Dokumentation „Ausländer raus! Schlingensiefs Container“ von Paul Poet, die im Jahr 2002 veröffentlicht wurde, auseinander. Sie wird vor allem unter dem Aspekt des Politischen analysiert, und es soll der Frage nachgegangen werden, inwiefern sie die Betroffenen in ein „Realitätsdilemma“ stürzte und ob die Aktion an sich einen politischen Effekt erzielte, demnach, in Bezug auf die Beuys´sche Definition, „die Welt veränderte“.
Greift man die Beuys‘sche Definition des erweiterten Kunstbegriffs und der Sozialen Plastik auf, ist jeder Mensch ein Künstler, weil in seinem Inneren ein Potenzial von Kreativität und individueller Gestaltungskraft schlummert, über das er verfügen kann und somit die Fähigkeit besitzt, Ungewöhnliches zu kreieren. Die Soziale Plastik ist folglich ein Kunstkonzept, welches menschliches Handeln miteinschließt und das die Strukturierung und Formung der Gesellschaft zum Ziel hat. Jedes kreative Handeln, das dahingehend wirkt, wird – heutzutage insbesondere unter Einbeziehung der Medien – zur künstlerischen Praxis.
Nach Beuys sei es die Aufgabe der Kunst, diesen Prozess in den Fokus der Aufmerksamkeit zu rücken und damit auch zu zeigen, dass jeder einzelne durch sein Sprechen und Denken zur Veränderung der Welt beitragen oder dem Bestehenden zustimmen könne. Auch Christoph Schlingensiefs Filme, Happenings und Objekte erheben sich über den unmittelbar sinnlich wahrnehmbaren Gegenstand hinaus. Er arbeitete stets am „Puls der politischen, gesellschaftlichen und medialen Entwicklungen“, wodurch seine Projekte und Aktionen häufig politisch motiviert, teils provokativ zum Einsatz kamen.
Die Hinterfragung von konventionellen Wahrnehmungsmustern, dem Spiel mit dem Verhältnis von Kunst und Leben, Fiktion und Realität sowie Bühne und öffentlichem Raum spiegelt sich auch in seiner Container-Aktion „Bitte liebt Österreich – Erste österreichische Koalitionswoche“ im Rahmen der Wiener Festwochen wieder. Auch dort verschob er bewusst und unbewusst die Grenzen oder hob sie gänzlich auf, was die zufälligen oder durch die Medien aufmerksam gewordenen Menschen zum Teil in große Verwirrung versetzte.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Schlingensiefs Container - als politische Aktion erfolgreich?
- II.1. Ausgangslage und Intention der Container-Aktion
- II.2. Der politische Aspekt
- III. Verschiedene Ebenen von Realität …
- III.1. Wenn die Grenzen aufgehoben werden: Zwischen Kunst und Leben ....
- III. 2. Der Unterschied zwischen Skandal und Skandalisierung
- VI. Fazit.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Christoph Schlingensiefs Container-Aktion „Bitte liebt Österreich Erste Österreichische Koalitionswoche“ im Rahmen der Wiener Festwochen 2000 und die daraus entstandene Dokumentation „Ausländer raus! Schlingensiefs Container“ von Paul Poet (2002). Der Fokus liegt auf dem politischen Aspekt der Aktion und der Frage, inwieweit sie die Betroffenen in ein „Realitätsdilemma“ stürzte und ob sie einen politischen Effekt erzielte.
- Die politische Dimension von Kunst und Aktionismus
- Die Verbindung von Kunst, Politik und Medien
- Die Manipulation von Realität und Wahrnehmung
- Die Rolle von Fremdenfeindlichkeit in der österreichischen Gesellschaft
- Die Auswirkungen von Schlingensiefs Aktion auf die öffentliche Meinung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Arbeit ein und stellt den Bezug zu Joseph Beuys' Konzept der Sozialen Plastik her, um die politische Dimension von Schlingensiefs Kunst zu beleuchten. Kapitel II analysiert die Ausgangslage und Intention der Container-Aktion sowie den politischen Aspekt der Aktion, der auf die Wahl der FPÖ im Jahr 2000 und die damit verbundene „Ausländer raus“-Politik Bezug nimmt. Das dritte Kapitel widmet sich verschiedenen Ebenen von Realität, die in Schlingensiefs Aktion verschwimmen, insbesondere der Grenze zwischen Kunst und Leben.
Schlüsselwörter
Christoph Schlingensief, Container-Aktion, "Bitte liebt Österreich", Wiener Festwochen, "Ausländer raus!", FPÖ, politische Aktion, Kunst und Politik, Realität und Fiktion, Medien, Fremdenfeindlichkeit, Soziale Plastik.
Häufig gestellte Fragen
Was war die Container-Aktion von Christoph Schlingensief?
Die Aktion „Bitte liebt Österreich“ im Jahr 2000 nutzte Container vor der Wiener Staatsoper, um im Stil von Big Brother die Abschiebung von Asylbewerbern zu parodieren.
Welches politische Ziel verfolgte Schlingensief damit?
Er wollte die Fremdenfeindlichkeit und die Politik der FPÖ-ÖVP-Koalition entlarven und die Gesellschaft zur Reflexion über ihre Werte zwingen.
Was ist die „Soziale Plastik“ nach Joseph Beuys?
Es ist ein Kunstbegriff, der menschliches Handeln und Denken als Material zur Formung der Gesellschaft betrachtet.
Warum löste die Aktion ein „Realitätsdilemma“ aus?
Durch die Vermischung von Kunst, echtem Leid (Asylbewerber) und medialer Inszenierung wussten Passanten und Zuschauer oft nicht, was Realität und was Fiktion war.
War die Aktion politisch erfolgreich?
Die Arbeit analysiert, ob die Aktion tatsächlich die Welt veränderte oder lediglich einen medialen Skandal ohne nachhaltigen Effekt produzierte.
- Arbeit zitieren
- Caroline Thon (Autor:in), 2017, Christoph Schlingensiefs Container. Zwischen Realitätsverschiebung und politischer Aktion, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/366696