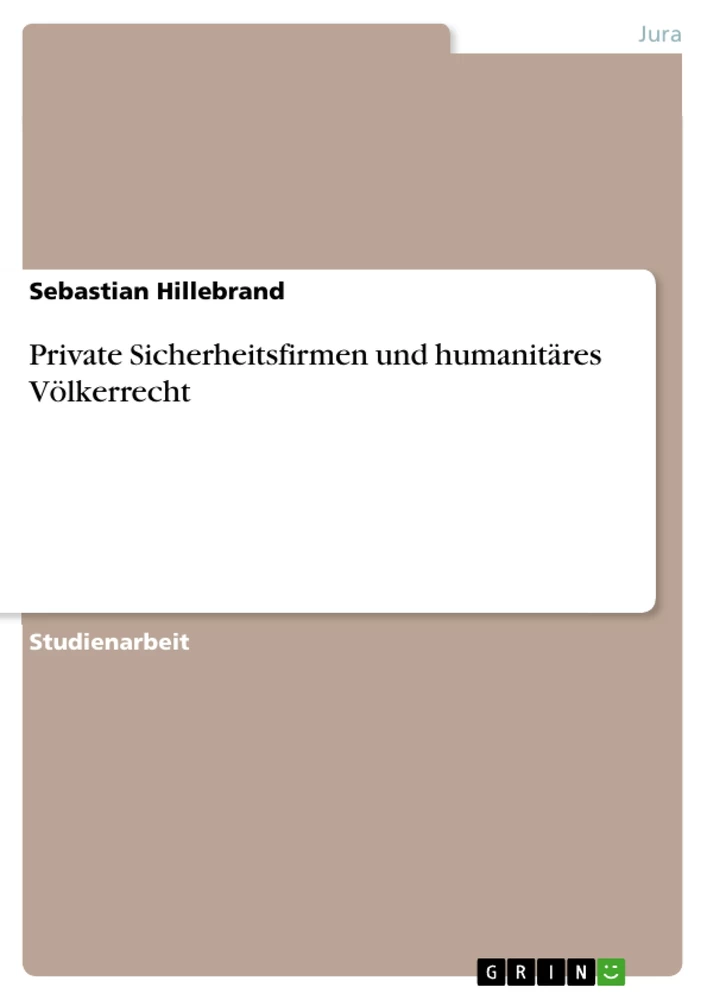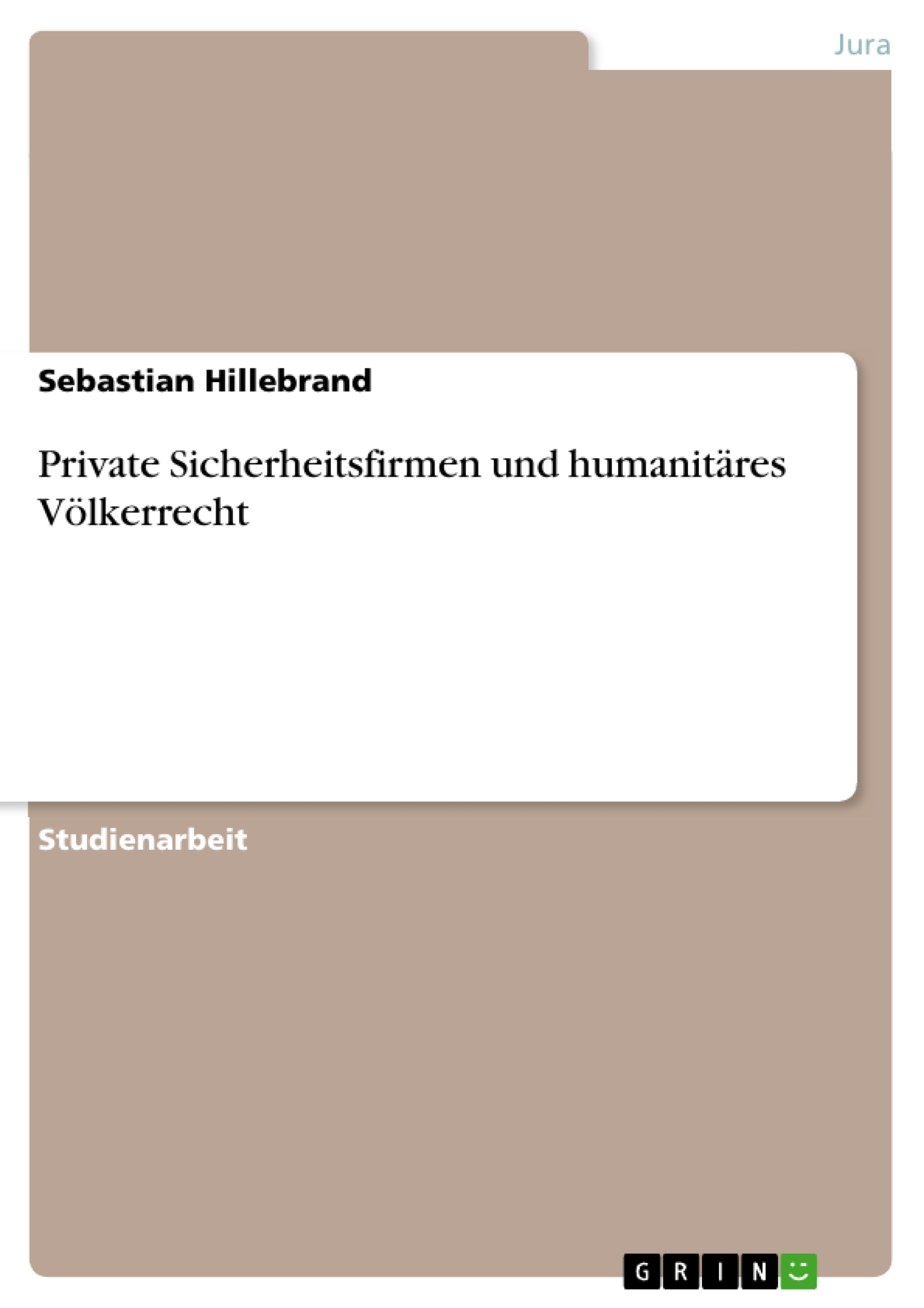Seit dem Ende des Kalten Krieges, Anfang der 90er Jahre, hatten viele Staaten ihre Truppenstärken reduziert, um durch militärische Abbaumaßnahmen die Beendung des Konflikts zu symbolisieren. Für Privatunternehmen bot sich durch diese Aktion ein Sprungbrett für ein Milliarden Geschäft. Die Regierungen konnten keinesfalls eine Einschränkung der Einsatzfähigkeit ihrer Armeen hinnehmen und mussten, bzw. konnten somit über Private Sicherheitsfirmen ihr Personal aufstocken. Insbesondere die USA, unter dem damaligen Präsident George W. Bush, erreichte hinsichtlich der Debatte über das "Outsourcing des Krieges" neue Dimensionen. Über 100 Milliarden Dollar, rund ein Fünftel der Gesamtkosten des Irakkrieges, soll die US-Regierung zwischen 2003 und 2008 für die Dienste sogenannter privater Sicherheitsfirmen ausgegeben haben. Die Einstellung von "modernen Söldnern" ist insoweit praktisch, dass Involvierte in den offiziellen Statistiken nicht geführt werden. Somit haben die Regierungen politisch einfacheres Spiel Kriege länger und intensiver zu führen, der Preis für diesen Einsatz sind jedoch Grauzonen, vor allem juristischer Art. So ist in der aktuellen Diskussion ungewiss, welche rechtlichen Konsequenzen "Söldner" wegen möglicher im Ausland begangener Verbrechen haben können.
Im Laufe dieser Arbeit möchte ich der Streitfrage nachgehen, wer die Verantwortung in diesem Geschäft trägt und wieweit Verankerungen im internationalen Recht gegeben sind. Die kriegsrechtliche Behandlung von "Private Military Companies" ist dahingehend gespalten, da keine konkrete Zuteilung getroffen werden kann, ob die Auftrag gebenden Staaten von Ihrer kriegsrechtlichen Verpflichtung entbunden werden können, oder das Handeln der Privaten Ihnen noch zuzurechnen ist. Es ist außerdem ungeklärt, wie weit Überprüfungen und Kontrollpflichten eingehalten werden, ebenso wie die Einordnung des personellen Status über private Kämpfer, die unter Umständen auch keinen Kriegsgefangenenstatus inne haben. Nachfolgend sollen diese aktuellen Rechtsfragen erörtert und diskutiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- A) Einleitung
- B) Staatenverantwortlichkeit für Verletzungen des Humanitären Völkerrechts durch private Militär- und Sicherheitsfirmen
- I) Private Military Companies/PMC's
- II) Staatenverantwortlichkeit
- 1) Art. 4 ILC-Entwurf
- 2) Art. 5 ILC-Entwurf
- 3) Art. 7 ILC-Entwurf
- 4) Art. 8 ILC-Entwurf
- 5) Fazit
- C) Regulierungsmechanismen
- I) Selbstregulierung
- II) Montreux-Dokument
- D) Status der einzelnen Akteure
- I) Status im internationalen bewaffneten Konflikt
- 1) Söldner
- 2) Kombattanten
- a) Zugehörigkeit der PMC-Angestellten zu den bewaffneten Kräften
- b) Zugehörigkeit der PMC-Angestellten zu einer Konfliktpartei
- c) Zwischenfazit
- 3) Zivilisten
- a) Der rechtliche Schutz der PMC-Angestellten
- aa) Schutz vor Angriffen
- bb) Kriegsgefangenenstatuts
- b) Die rechtlichen Pflichten eines PMC-Angestellten
- c) Zwischenfazit
- E) Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der rechtlichen Verantwortlichkeit von Staaten für Verletzungen des humanitären Völkerrechts durch private Militär- und Sicherheitsfirmen (PMC's). Im Fokus stehen die rechtlichen Einordnungen von PMC's im internationalen Recht und die Frage, ob Staaten von ihren kriegsrechtlichen Verpflichtungen entbunden werden können, wenn sie private Unternehmen mit militärischen Aufgaben beauftragen.
- Staatenverantwortlichkeit für Verletzungen des humanitären Völkerrechts durch PMC's
- Rechtlicher Status von PMC's im internationalen Recht
- Regulierungsmechanismen für PMC's
- Kriegsrechtliche Behandlung von PMC's
- Schutz und Pflichten von PMC-Angestellten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der privaten Sicherheitsfirmen im Kontext des humanitären Völkerrechts vor und beleuchtet die historische Entwicklung sowie die aktuelle Relevanz des Themas. Kapitel B befasst sich mit der Staatenverantwortlichkeit für Verletzungen des humanitären Völkerrechts durch private Militär- und Sicherheitsfirmen. Dabei wird die rechtliche Einordnung von PMC's im internationalen Recht erläutert und die Problematik der Zuordnung von Verantwortung im Kontext von Outsourcing militärischer Aufgaben diskutiert. In Kapitel C werden Regulierungsmechanismen für PMC's analysiert, darunter die Selbstregulierung und das Montreux-Dokument. Kapitel D widmet sich dem Status der einzelnen Akteure, insbesondere dem Status von PMC-Angestellten im internationalen bewaffneten Konflikt. Die Einordnung von PMC-Angestellten als Söldner, Kombattanten oder Zivilisten sowie die Frage nach ihrem Schutz und ihren rechtlichen Pflichten im Kontext von Kriegseinsätzen stehen im Zentrum dieser Betrachtung.
Schlüsselwörter
Private Militär- und Sicherheitsfirmen, humanitäres Völkerrecht, Staatenverantwortlichkeit, Söldner, Kombattanten, Zivilisten, Montreux-Dokument, Regulierungsmechanismen, Outsourcing des Krieges, Kriegsrecht, Schutz von Zivilisten.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Private Military Companies (PMCs)?
PMCs sind Privatunternehmen, die militärische Dienstleistungen und Sicherheitsaufgaben anbieten, die früher ausschließlich von staatlichen Armeen übernommen wurden.
Wer haftet für Völkerrechtsverletzungen durch private Sicherheitsfirmen?
Die Arbeit untersucht, inwieweit Staaten für das Handeln beauftragter Privater verantwortlich bleiben. Hierbei spielen die ILC-Entwürfe zur Staatenverantwortlichkeit eine zentrale Rolle.
Welchen rechtlichen Status haben PMC-Angestellte in Konflikten?
Die Einordnung ist komplex und umstritten. Es wird geprüft, ob sie als Söldner, Kombattanten oder Zivilisten gelten, was entscheidend für ihren Schutz und ihre Pflichten im Kriegsfall ist.
Haben PMC-Mitarbeiter Anspruch auf den Kriegsgefangenenstatus?
Dies hängt von ihrem rechtlichen Status ab. Zivilisten, die direkt an Feindseligkeiten teilnehmen, verlieren oft ihren Schutzstatus, während Kombattanten Anspruch auf Behandlung als Kriegsgefangene haben.
Was ist das Montreux-Dokument?
Das Montreux-Dokument ist eine internationale Vereinbarung, die die völkerrechtlichen Verpflichtungen von Staaten im Umgang mit privaten Militär- und Sicherheitsunternehmen in bewaffneten Konflikten präzisiert.
- Quote paper
- Sebastian Hillebrand (Author), 2016, Private Sicherheitsfirmen und humanitäres Völkerrecht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/366768