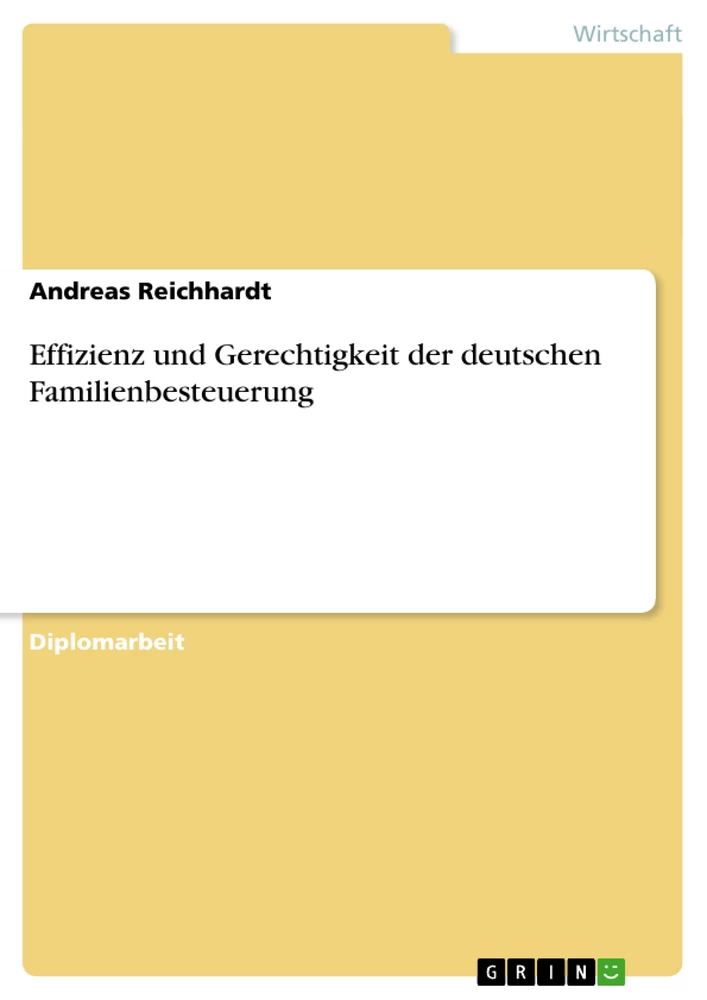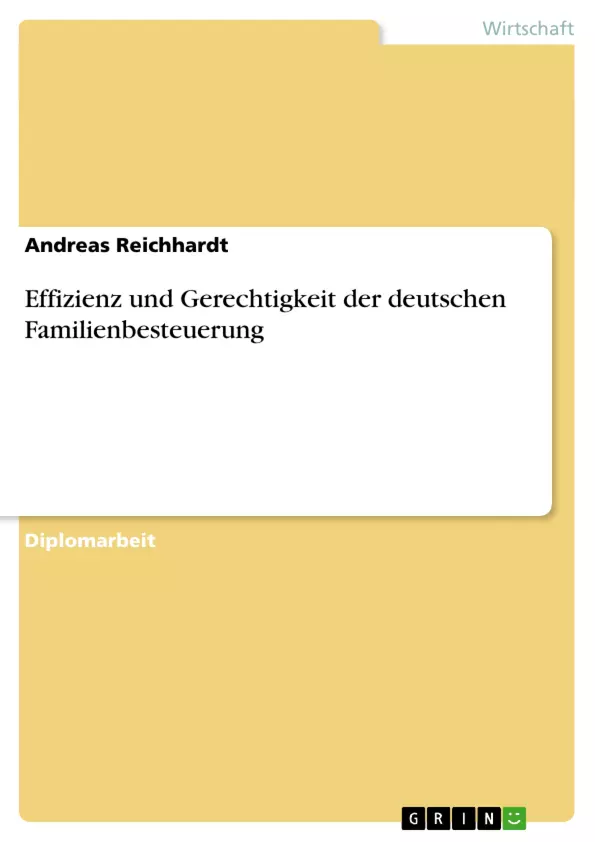[...] Das vorliegende Zitat stammt von einem Staatsdenker des 16. Jahrhunderts, Thomas Morus (More). Es ist erstaunlich, dass bereits vor 500 Jahren, also weit vor den wirtschaftstheoretischen Überlegungen eines Marx, Keynes oder Friedman beispielsweise, die Folgen von Umverteilung diskutiert wurden. Das Thema Umverteilung nimmt auch in der vorliegenden Diplomarbeit eine herausragende Stellung ein, die Umverteilung von Kinderlosen zu Familien mit Kindern im Sinne der Gerechtigkeit. Und damit wird auch die Frage diskutiert, ob eine solche Umverteilung in Grenzen „effizient“ sein kann und keine Leistungsanreize verloren gehen. Leistungsanreizverluste bedeuten gleichzeitig Effizienzverluste, da die Betroffenen keinen Sinn darin sehen, am Markt aktiv zu werden. Diejenigen, die durch die erhöhte Steuerzahlung betroffen sind, erzielen keine Markteinkommen, da sie nach subjektiver Einschätzung zuviel abgeben müssen. Die von der Umverteilung Profitierenden haben nicht die Absicht, am Markt aktiv zu werden, da sie ohnehin ein gewisses Einkommensniveau erreichen2. Um diese Wirkungen zu untersuchen, wird zunächst der Begriff der Familie näher betrachtet und die Leistungen für das Mikrosystem Familie sowie das Makrosystem Volkswirtschaft erläutert. Zugleich wird auf die Kosten verwiesen, die einer Familie durch die Kindererziehung entstehen. Ausgehend von diesen Erkenntnissen werden Effizienz und Gerechtigkeit zunächst zwar theoretisch erklärt, aber anschließend konkret angewandt, um Verbindungen zu Leistungen und Kosten aufzuzeigen. Danach soll die Frage geklärt werden, wie der Effizienz- und Gerechtigkeitsgedanke konkret im deutschen Steuerrecht umgesetzt sind und welche Belastungen dadurch dem Bundeshaushalt entstehen. Der Hauptteil der Arbeit schließt sich mit der Frage an, ob die Forderungen nach Effizienz und Gerechtigkeit durch die Elemente der Familienbesteuerung auch erfüllt werden. Als Abschluss soll noch kurz darauf eingegangen werden, inwieweit auf Grund sich stets verändernder gesellschaftlicher Verhältnisse Reformkonzepte nötig sind und wie sich die politisch Verantwortlichen solche Reformen vorstellen. 2 Zur Leistungsanreizproblematik vgl. auch Hüther (1990), S. 43ff., und Stöß (1991), S. 21ff.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung und Methodik der vorliegenden Arbeit
- 2. Definition, Leistungen und Kosten der Familie
- 2.1 Definition der Familie
- 2.1.1 Konstituierendes Element des Begriffs „Familie“
- 2.1.2 Eine weitere Definition der Familie: Die Familie als ökonomische Betrachtungseinheit
- 2.2 Wesentliche Leistungen der Familie in einer Gesellschaft / Volkswirtschaft
- 2.2.1 Die Mikroperspektive – die innerfamiliäre Wirkungsebene
- 2.2.2 Die Makroperspektive – die Leistungen der Familie für die Gesellschaft
- 2.3 Belastung der Familien durch das Aufziehen von Kindern
- 2.3.1 Direkte Kosten
- 2.3.2 Indirekte Kosten (Opportunitätskosten)
- 3. Theoretische Effizienz in der Besteuerung von Familien
- 3.1 Begriffsdefinition und volkswirtschaftliches Ziel der Effizienz
- 3.2 Das Allokationsoptimum
- 3.2.1 Das Pareto-Kriterium
- 3.2.2 Der vollkommene Markt
- 3.2.3 Die,,Laissez-Faire-Ökonomie“
- 3.2.3.1 Die öffentlichen Güter
- 3.2.3.2 Übertragung auf das Ökonomie-Modell
- 3.2.4 Kritik am bisherigen Modell – die externen Effekte
- 3.2.5 Die Internalisierung der externen Effekte
- 3.3 Effizienz der Besteuerung
- 4. Theoretische Gerechtigkeit in der Besteuerung von Familien
- 4.1 Begriff und Ziel der Gerechtigkeit in einer Volkswirtschaft
- 4.1.1 Regelgerechtigkeit
- 4.1.2 Verteilungsgerechtigkeit
- 4.2 Grundlegende Besteuerungsprinzipien
- 4.2.1 Äquivalenzprinzip.
- 4.2.2 Leistungsfähigkeitsprinzip
- 4.3 Die Verbindung des Distributionsziels mit der Steuererhebung
- 4.3.1 Horizontale, vertikale Gerechtigkeit und progressiver Tarifverlauf_
- 4.3.2 Weitere Implikationen durch die Familiensituation
- 4.4 Gerechtigkeit der Besteuerung
- 5. Die Elemente der deutschen Familienbesteuerung
- 5.1 Die Familienbesteuerung im engeren Sinne
- 5.1.1 Das Ehegattensplitting_
- 5.1.2 Das beschränkte Realsplitting
- 5.2 Der Familienlasten- bzw. Familienleistungsausgleich
- 5.2.1 Tarifabhängige Transfers
- 5.2.1.1 Kinderfreibetrag
- 5.2.1.2 Betreuungsfreibetrag
- 5.2.1.3 Haushaltsfreibetrag
- 5.2.1.4 Minderung der zumutbaren Belastung
- 5.2.1.5 Unterhaltsleistungen
- 5.2.1.6 Ausbildungsfreibeträge
- 5.2.1.7 Beschäftigung einer Haushaltshilfe oder Heimunterbringung
- 5.2.1.8 Kinderbetreuungskosten
- 5.2.2 Tarifunabhängige Transfers
- 5.2.2.1 Kindergeld_
- 5.2.2.2,,Baukindergeld“
- 5.3 Weitere Elemente der Familienbesteuerung
- 5.4 Elemente der übrigen Familienförderung
- 5.5 Belastungen der öffentlichen Haushalte durch die Familienförderung
- 6. Erfüllung der allgemeinen Anforderungen durch die Familienbesteuerung_
- 6.1 Zusammenfassung der bisherigen theoretischen Ergebnisse
- 6.2 Die Inzidenzanalyse
- 6.2.1 Die Steuerinzidenzanalyse
- 6.2.2 Die Budgetinzidenzanalyse
- 6.3 Die Mikroperspektive
- 6.3.1 Allgemeine Wirkungsanalyse
- 6.3.2 Die Sonderproblematik Ehegattensplitting
- 6.3.3 Die Sonderproblematik Kinderfreibetrag vs. Kindergeld
- 6.4 Die Makroperspektive
- 6.4.1 Allgemeine Wirkungsanalyse
- 6.4.2 Die Optimalsteuertheorie
- 6.4.3 Weitere Wirkungen der Familienbesteuerung_
- 6.4.4 Die Bedeutung anderer Familien – Fördermaßnahmen
- 7. Zukunftsanforderungen und Reformkonzepte zur Familienbesteuerung
- 7.1 Wandel des Familienbildes, Position der Familie in der Gesellschaft und Zukunftsanforderungen
- 7.2 Das Problem der Gerechtigkeits- und Gleichheitsdefinition – Urteile des Bundesverfassungsgerichts
- 7.3 Reformkonzeptionen
- 7.3.1 Zur Weiterentwicklung des bestehenden Modells
- 7.3.2 Konsumorientierung der Besteuerung_
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Effizienz und Gerechtigkeit der deutschen Familienbesteuerung. Sie analysiert die Auswirkungen verschiedener Besteuerungsmodelle auf die Familienstruktur und die Allokation von Ressourcen. Ziel ist es, die aktuellen Strukturen der Familienbesteuerung in Deutschland zu bewerten und Reformkonzepte aufzuzeigen, die eine effiziente und gerechte Verteilung von Ressourcen ermöglichen.
- Definition und Leistungen der Familie in ökonomischer Hinsicht
- Theoretische Konzepte von Effizienz und Gerechtigkeit in der Steuerpolitik
- Analyse der Elemente der deutschen Familienbesteuerung
- Bewertung der Effizienz und Gerechtigkeit der Familienbesteuerung
- Zukunftsanforderungen und Reformkonzepte für die Familienbesteuerung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 legt die Methodik der vorliegenden Arbeit dar und erläutert die Forschungsfrage. Kapitel 2 definiert den Begriff Familie und beleuchtet deren Leistungen und Kosten. Die Kapitel 3 und 4 behandeln die theoretischen Konzepte von Effizienz und Gerechtigkeit in der Besteuerung von Familien. Kapitel 5 analysiert die Elemente der deutschen Familienbesteuerung, einschließlich Ehegattensplitting, Kinderfreibetrag und Kindergeld. Kapitel 6 untersucht die Effizienz und Gerechtigkeit der Familienbesteuerung in Deutschland unter Berücksichtigung der Mikroperspektive (intra-familiäre Ebene) und der Makroperspektive (gesamtwirtschaftliche Ebene). Kapitel 7 befasst sich mit Zukunftsanforderungen und Reformkonzepten für die Familienbesteuerung in Deutschland.
Schlüsselwörter
Familienbesteuerung, Effizienz, Gerechtigkeit, Ehegattensplitting, Kinderfreibetrag, Kindergeld, Inzidenzanalyse, Budgetinzidenzanalyse, Familienförderung, Reformkonzepte, Zukunftsanforderungen.
- Quote paper
- Andreas Reichhardt (Author), 2002, Effizienz und Gerechtigkeit der deutschen Familienbesteuerung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36688