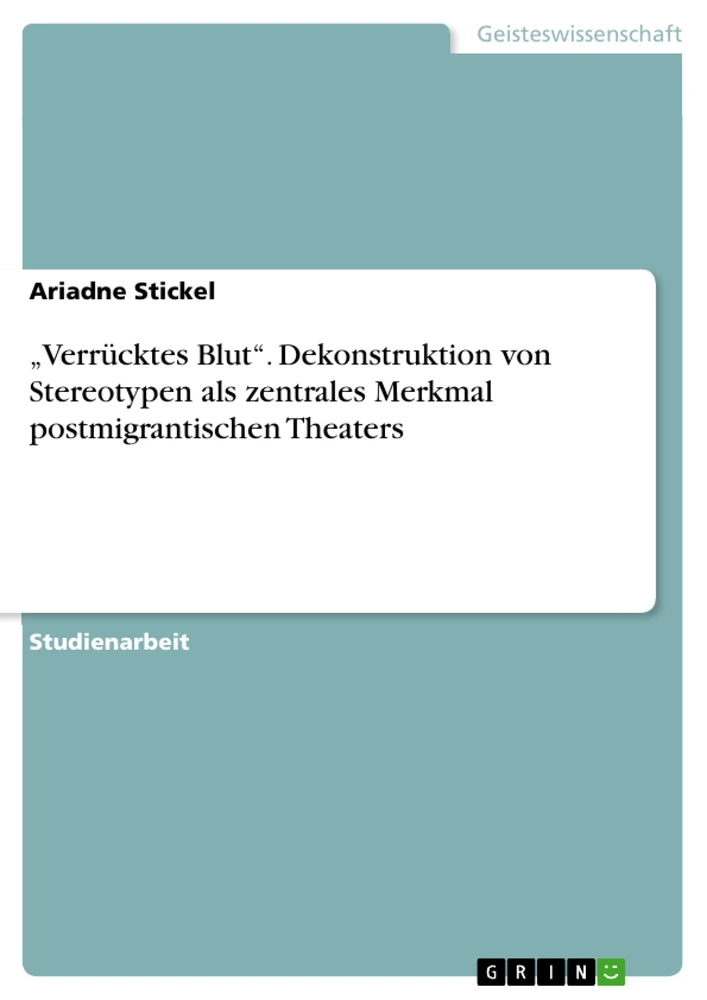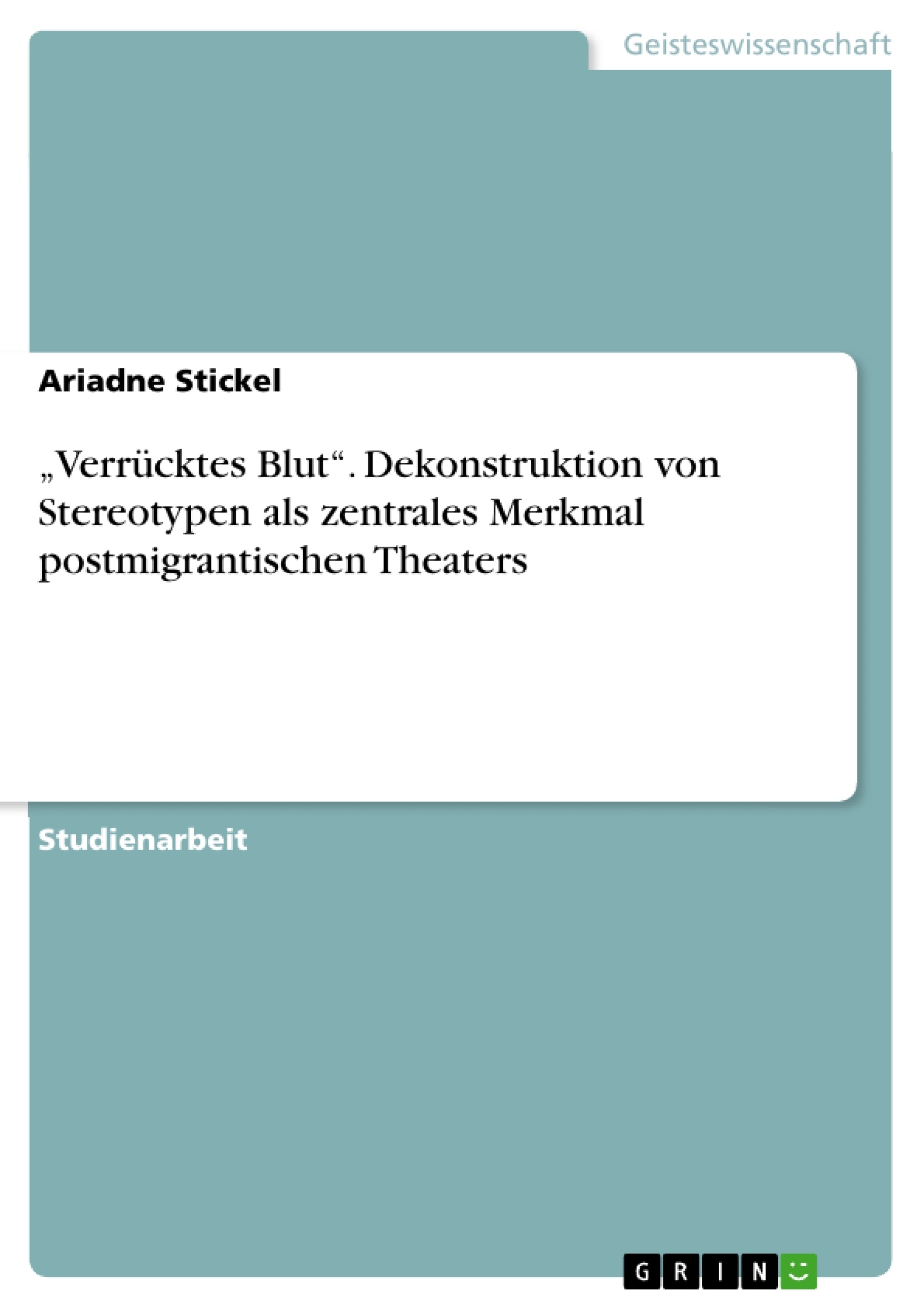Inwiefern bringt das Stück „Verrücktes Blut“, eine Koproduktion des Ballhaus Naunynstraße und der Ruhrtriennale, das Prinzip des postmigrantischen Theaters auf den Punkt? Wodurch zeichnet sich dieses Prinzip aus? Wie wird es in diesem Fall konkret umgesetzt und welcher Versuch wird damit unternommen? Diese Fragen sollen im Folgenden am Beispiel von „Verrücktes Blut“ näher betrachtet und analysiert werden.
Ich werde zunächst in aller Kürze auf die Situation des Migrations-Theaters in Deutschland eingehen, da mir dies als wichtige Voraussetzung erscheint, um das Stück, den Inhalt und die Form einordnen und verstehen zu können. Anschließend werde ich die Merkmale des postmigrantischen Theaters beispielhaft anhand der mir für die Fragestellungen zentral erscheinenden Figur der Lehrerin analysieren. Dabei werde ich nicht jede einzelne Szene berücksichtigen können, sondern mich auf eine Auswahl einiger zentralen beschränken.
„Das Stück (…) ist der Hit der Saison.“ So titelt der „Spiegel“ im September 2010, als „Verrücktes Blut“, eine Koproduktion des Ballhaus Naunynstraße und der Ruhrtriennale, in Berlin-Kreuzberg erstmals aufgeführt wird. Als „Stück der Stunde“ wird es von der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ bezeichnet und die Fachzeitschrift „Theater heute“ kürt es zum deutschsprachigen Stück des Jahres. Gewissermaßen scheint es Regisseur Nurkan Erpulat und Dramaturg Jens Hillje mit ihrem Werk gelungen zu sein, das Prinzip des seit geraumer Zeit viel diskutierten postmigrantischen Theaters auf besondere Weise auf den Punkt zu bringen. Nahezu keine Theater-und-Migrations-Debatte lässt „Verrücktes Blut“ seither unerwähnt. Es scheint zum postmigrantischen Theaterstück par Excellance geworden zu sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Postmigrantisches Theater als „,künstlerische Suchbewegung“
- Die Verhandlung von Stereotypen als zentrales Merkmal in „Verrücktes Blut“.
- Die plakative Darstellung von Vorurteilen gegenüber Migranten als Auftakt der ersten Szene
- Die Figur der Lehrerin in „Verrücktes Blut“.
- Die „Klischeedeutsche“
- Die Lehrerin als aufklärerisches Ideal des deutschen Bildungsbürgers
- Die Dekonstruktion jeglicher klaren Identität am Beispiel der Figur der Lehrerin
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Stück „Verrücktes Blut“ von Nurkan Erpulat und Jens Hillje als Beispiel für postmigrantisches Theater. Die Analyse konzentriert sich auf die Dekonstruktion von Stereotypen als zentrales Merkmal des Stücks und beleuchtet, wie dieses Merkmal in der Figur der Lehrerin zum Ausdruck kommt.
- Postmigrantisches Theater als „künstlerische Suchbewegung“
- Dekonstruktion von Stereotypen
- Die Rolle der Lehrerin im Stück
- Authentizität und Realitätsbezug
- Die Frage nach Identität und Zugehörigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Stück „Verrücktes Blut“ vor und erläutert dessen Rezeption in der Theaterlandschaft. Sie betont die Bedeutung des Stücks für die Diskussion um postmigrantisches Theater und stellt die zentralen Fragestellungen der Arbeit dar.
Postmigrantisches Theater als „,künstlerische Suchbewegung“
Dieser Abschnitt beleuchtet den Kontext des migrantischen und postmigrantischen Theaters in Deutschland und beschreibt die Herausforderungen, denen diese Theaterform in der deutschen Gesellschaft begegnet. Der Fokus liegt auf der Rolle des Ballhaus Naunynstraße und der Arbeit von Şermin Langhoff.
Die Verhandlung von Stereotypen als zentrales Merkmal in „Verrücktes Blut“.
Dieses Kapitel analysiert die Dekonstruktion von Stereotypen im Stück, insbesondere in Bezug auf die Figur der Lehrerin. Es untersucht die Darstellung von Vorurteilen gegenüber Migranten und analysiert die Figur der Lehrerin als Klischee und aufklärerisches Ideal.
Schlüsselwörter
Postmigrantisches Theater, Dekonstruktion von Stereotypen, Migration, Identität, Interkulturalität, „Verrücktes Blut“, Lehrerin, Stereotypen, Ballhaus Naunynstraße, Şermin Langhoff.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter "postmigrantischem Theater"?
Es ist eine künstlerische Suchbewegung, die über klassische Migrationserzählungen hinausgeht und Identitäten jenseits von Herkunft verhandelt.
Worum geht es in dem Stück "Verrücktes Blut"?
Das Stück dekonstruiert Stereotypen durch eine Handlung, in der eine Lehrerin ihre Schüler mit Waffengewalt zur Bildung zwingt.
Welche Rolle spielt die Lehrerin im Stück?
Sie verkörpert das aufklärerische Ideal des deutschen Bildungsbürgers, wird aber gleichzeitig als Klischee dekonstruiert.
Warum war das Ballhaus Naunynstraße wichtig für dieses Werk?
Das Ballhaus unter Şermin Langhoff gilt als Geburtsort des postmigrantischen Theaters in Deutschland.
Wie werden Stereotypen im Stück behandelt?
Durch plakative Darstellung und anschließende Brechung der Vorurteile gegenüber Migranten und "Bio-Deutschen".
- Citar trabajo
- Ariadne Stickel (Autor), 2015, „Verrücktes Blut“. Dekonstruktion von Stereotypen als zentrales Merkmal postmigrantischen Theaters, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/366897