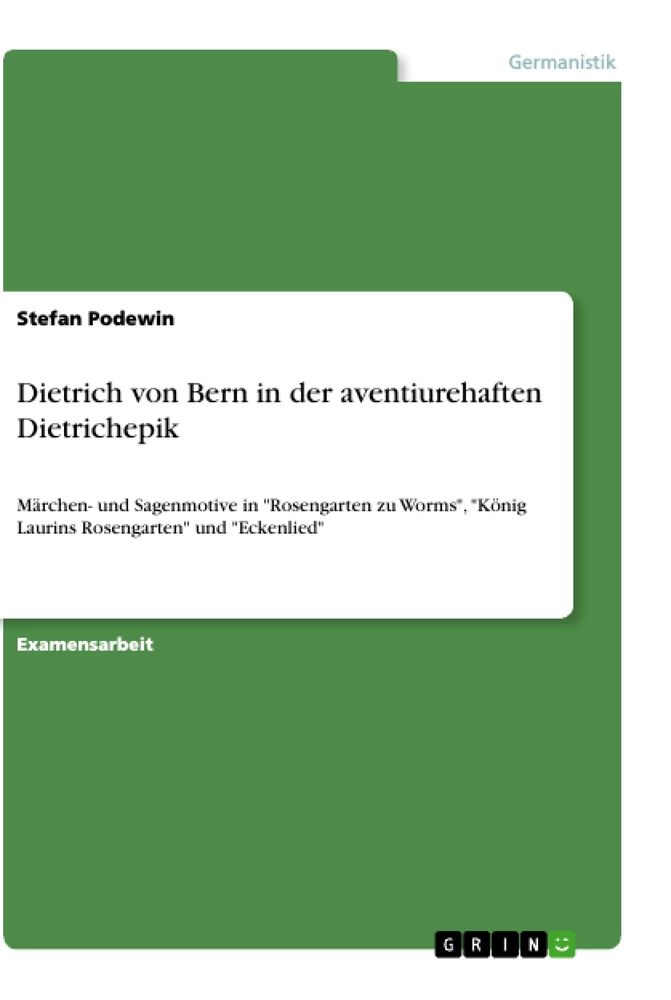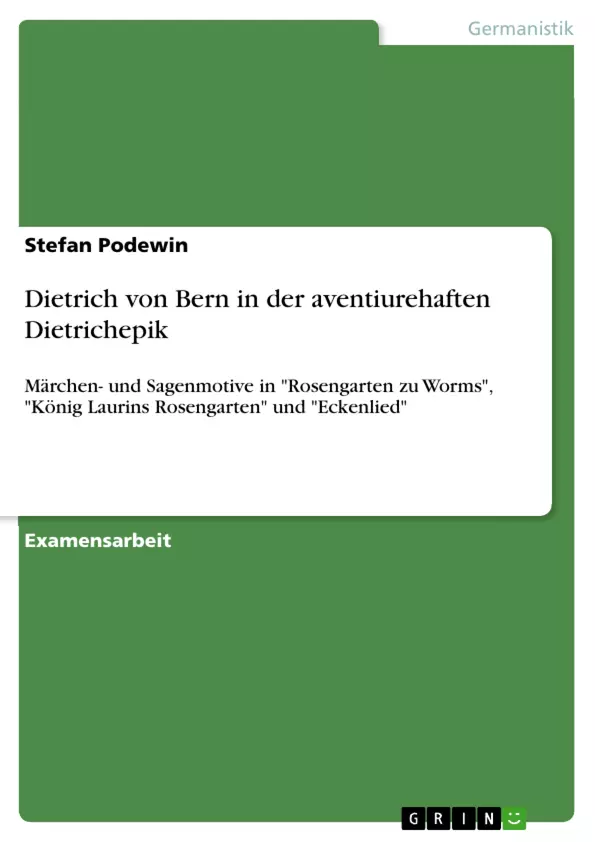Das Werk ist eine wissenschaftliche Arbeit, eingereicht 2009 zur Erlangung des Ersten Staatsexamens für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen. Zentral beschäftigt sich die Examensarbeit mit Dietrich von Bern, dem wohl bedeutendsten Helden mittelalterlicher deutscher Literatur und seiner literarischen Repräsentation in der sogenannten "aventiurehaften Dietrichepik". Als Grundlage dienen verschiedene Handschriften folgender aventiurehafter Dietrichepen: "Das Eckenlied", "König Laurins Rosengarten" und "Der Rosengarten zu Worms".
Um Dietrich von Bern völlig erfassen und verstehen zu können, muss berücksichtigt werden, wie das Gesamtbild seines Charakters über die Jahrhunderte präsentiert und verändert wurde. Daher sollen neben einer Kurzcharakteristik Dietrichs von Bern, wie ihn die historischen Dietrichepen repräsentieren, auch weitere dichterische und nicht-dichterische Quellen Eingang in diese Arbeit finden, da viele Historiographien, Chroniken, Heiligenlegenden etc. mit ihren Berichten über Theoderichs Wirken auf Erden, viel wichtiger aber noch durch Berichte über seinen Tod, den Ruf des gotischen Heerführers für Jahrhunderte prägten.
Diese Arbeit kann und will nicht den Anspruch einer absoluten Figurenanalyse Dietrichs in der aventiurehaften Dietrichepik erheben. Dafür müssten sämtliche aventiurehaften Dietrichepen samt ihrer Textvarianten so detailliert wie möglich bearbeitet werden, was jedoch die Möglichkeit einer Staatsarbeit übersteigen würde.
Neben den drei genannten Werken werden auch weitere aventiurehafte sowie historische Dietrichepen, wenn auch nur im geringen Umfang, an geeigneter Stelle in die Arbeit miteinbezogen, um anhand von Parallelen, aber auch Abweichungen, Dietrichs literarische Gestalt zu analysieren.
Beim Rosengarten zu Worms und bei König Laurins Rosengarten habe ich mich auf die Fassungen A , beim Eckenlied auf Fassung L gestützt, da die jeweiligen Fassungen in der germanistischen Forschung als Urformen der Texte bzw. den Urformen der Texte am nächsten kommend gelten.
Aufgrund der Tatsache, dass das ‚Eckenlied L’ nur fragmentarisch vorliegt, d.h. genauer nach Strophe 245,6 abbricht, habe ich mich auf das letztendliche Ziel von Dietrichs Reise im Eckenlied, nämlich seiner Ankunft bei den drei Königinnen auf Jochgrimm, gemäß der Fortsetzung aus ‚Eckenlied d’ gerichtet, wie es von Brévart dargelegt wird.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Die mhd. Dietrichepik: eine kurze Einführung
- 1.1 Historische Dietrichepik
- 1.2 Aventiurehafte Dietrichepik
- 1.3 Reihenkampfepen
- 1.4 Epen im Umfeld der mittelhochdeutschen Dietrichepik
- 2. Auf den Spuren Dietrichs von Bern
- 2.1 Das historische Vorbild
- 2.2 Überlieferungen von Theoderichs Leben und Tod über die Jahrhunderte
- 2.2.1 Der Tod als Strafe Gottes
- 2.2.2 Der Sturz in den Vulkan
- 2.2.3 Der Höllenreiter
- 2.3 Die historische Dietrichepik über Dietrich von Bern
- 3. Dietrich von Bern in der aventiurehaften Dietrichepik
- 3.1 Rosengarten zu Worms
- 3.1.1 Zum Aufbau des Textes
- 3.1.2 Märchenmotive im Rosengarten A
- 3.1.3 Sagenmotive im Rosengarten A
- 3.1.4 Dietrich von Bern und das Personal im Rosengarten A
- 3.2 König Laurins Rosengarten
- 3.2.1 Zum Aufbau des Textes
- 3.2.2 Märchenmotive im Laurin A
- 3.2.3 Sagenmotive im Laurin A
- 3.2.4 Dietrich von Bern und das Personal im Laurin A
- 3.3 Eckenlied
- 3.3.1 Zum Aufbau des Textes
- 3.3.2 Märchenmotive im Eckenlied L
- 3.3.3 Sagenmotive im Eckenlied L
- 2.4 Einige weitere Überlegungen zu Dietrich von Bern
- 4.1 Dietrich von Bern: Held oder Abenteurer?
- 4.2 Dietrich von Bern und Helden heutzutage
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die literarische Figur Dietrich von Bern in der aventiurehaften Dietrichepik. Ziel ist es, Dietrichs Charakter innerhalb dieser Epen zu analysieren und dabei Sagen- und Märchenmotive sowie sein historisches Vorbild zu berücksichtigen. Die Entwicklung seines Bildes über die Jahrhunderte wird ebenfalls beleuchtet.
- Die literarische Gestalt Dietrichs von Bern in der aventiurehaften Dietrichepik
- Der Einfluss von Sagen- und Märchenmotiven auf die Darstellung Dietrichs
- Vergleich der literarischen Figur mit dem historischen Vorbild Theoderich dem Großen
- Die Entwicklung des Bildes Dietrichs von Bern über die Jahrhunderte
- Analyse ausgewählter aventiurehafter Dietrichepen (Rosengarten zu Worms, König Laurins Rosengarten, Eckenlied)
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort führt in die Thematik ein und hebt die Bedeutung Dietrichs von Bern als Heldenfigur in der mittelalterlichen deutschen Literatur hervor. Es wird auf die historische Grundlage in der Gestalt Theoderichs des Großen hingewiesen und die unzureichende wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der aventiurehaften Dietrichepik im Vergleich zur Nibelungenforschung kritisiert. Die Arbeit selbst wird als Versuch einer detaillierten Analyse der literarischen Figur Dietrichs innerhalb der aventiurehaften Epik angekündigt, unter Berücksichtigung seiner historischen Entwicklung und der Einbeziehung weiterer Quellen. Die Auswahl der drei analysierten Werke (Rosengarten zu Worms, König Laurins Rosengarten, Eckenlied) wird begründet.
1. Die mhd. Dietrichepik: eine kurze Einführung: Dieses Kapitel liefert einen Überblick über die mittelhochdeutsche Dietrichepik. Es unterscheidet zwischen der historischen und der aventiurehaften Dietrichepik, beschreibt Reihenkampfepen und betrachtet die Epen im Kontext der mittelhochdeutschen Literatur. Der Abschnitt legt die grundlegenden literarischen und historischen Kontexte für die spätere Detailanalyse fest. Die Unterscheidung zwischen den verschiedenen Arten der Dietrichepen ist entscheidend für das Verständnis der gewählten Forschungsfokussierung auf die aventiurehaften Epen.
2. Auf den Spuren Dietrichs von Bern: Dieses Kapitel beleuchtet die historischen Wurzeln Dietrichs von Bern in der Gestalt Theoderichs des Großen. Es untersucht verschiedene Überlieferungen von Theoderichs Leben und Tod aus verschiedenen Jahrhunderten, einschließlich der Darstellung seines Todes als göttliche Strafe, seines Sturzes in den Vulkan und seiner Rolle als Höllenreiter. Die Analyse der historischen Überlieferungen dient als Vergleichsgrundlage für die spätere Analyse der literarischen Figur in den aventiurehaften Epen. Es wird deutlich, wie sich das Bild von Theoderich über Jahrhunderte hinweg transformierte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Mittelhochdeutsche Dietrichepik
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die literarische Figur Dietrich von Bern in der aventiurehaften mittelhochdeutschen Dietrichepik. Sie untersucht seinen Charakter, den Einfluss von Sagen- und Märchenmotiven, sein historisches Vorbild (Theoderich der Große) und die Entwicklung seines Bildes über die Jahrhunderte.
Welche Texte werden analysiert?
Die Arbeit konzentriert sich auf drei ausgewählte aventiurehafte Dietrichepen: den Rosengarten zu Worms, König Laurins Rosengarten und das Eckenlied. Diese werden hinsichtlich ihres Aufbaus, der Märchen- und Sagenmotive sowie der Darstellung Dietrichs von Bern und der anderen Figuren untersucht.
Wie wird die historische Figur Theoderich der Große in die Analyse einbezogen?
Die Arbeit vergleicht die literarische Figur Dietrichs von Bern mit ihrem historischen Vorbild, Theoderich dem Großen. Sie untersucht verschiedene Überlieferungen über Theoderichs Leben und Tod aus verschiedenen Jahrhunderten (z.B. Tod als Strafe Gottes, Sturz in den Vulkan, Höllenreiter), um die Transformation seines Bildes über die Zeit zu beleuchten und die literarische Entwicklung zu kontextualisieren.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: die literarische Gestalt Dietrichs in der aventiurehaften Dietrichepik, den Einfluss von Sagen- und Märchenmotiven auf seine Darstellung, den Vergleich mit dem historischen Vorbild, die Entwicklung seines Bildes über die Jahrhunderte und die detaillierte Analyse der drei ausgewählten aventiurehaften Epen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit enthält ein Vorwort, eine Einführung in die mittelhochdeutsche Dietrichepik (mit Unterscheidung zwischen historischer und aventiurehafter Epik), ein Kapitel zur historischen Entwicklung des Bildes Dietrichs von Bern, ein Kapitel zur Analyse der drei ausgewählten aventiurehaften Epen und abschließende Überlegungen zu Dietrich von Bern als Held oder Abenteurer und seiner Relevanz für die heutige Zeit.
Welche Arten der Dietrichepik werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen der historischen und der aventiurehaften Dietrichepik. Sie erklärt auch den Begriff der Reihenkampfepen und betrachtet alle drei im Kontext der mittelhochdeutschen Literatur. Die Fokussierung liegt auf der aventiurehaften Dietrichepik.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Das Ziel ist es, die literarische Figur Dietrich von Bern in der aventiurehaften Dietrichepik umfassend zu analysieren und sein Bild im Laufe der Zeit nachzuvollziehen. Dabei wird der Einfluss von historischen Überlieferungen, Sagen und Märchen berücksichtigt.
Was wird im Vorwort behandelt?
Das Vorwort führt in die Thematik ein, betont die Bedeutung Dietrichs von Bern als Heldenfigur, verweist auf die historische Grundlage in Theoderich dem Großen, kritisiert die unzureichende wissenschaftliche Beschäftigung mit der aventiurehaften Dietrichepik und kündigt die detaillierte Analyse der literarischen Figur an, unter Berücksichtigung der historischen Entwicklung und weiterer Quellen.
- Citation du texte
- Stefan Podewin (Auteur), 2009, Dietrich von Bern in der aventiurehaften Dietrichepik. Märchen- und Sagenmotive, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/367050