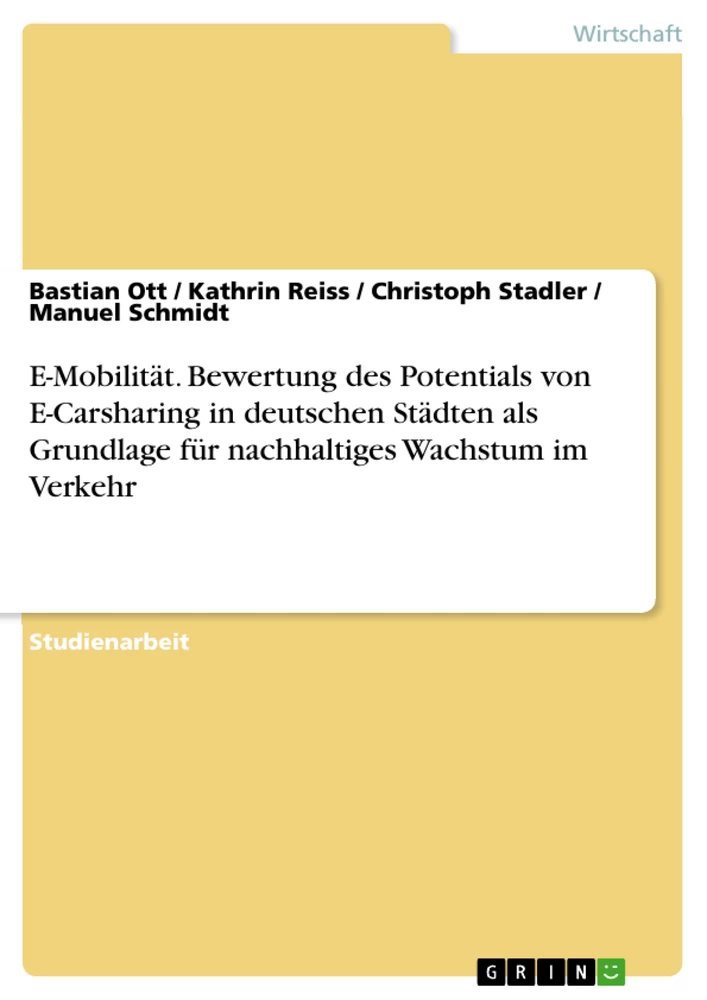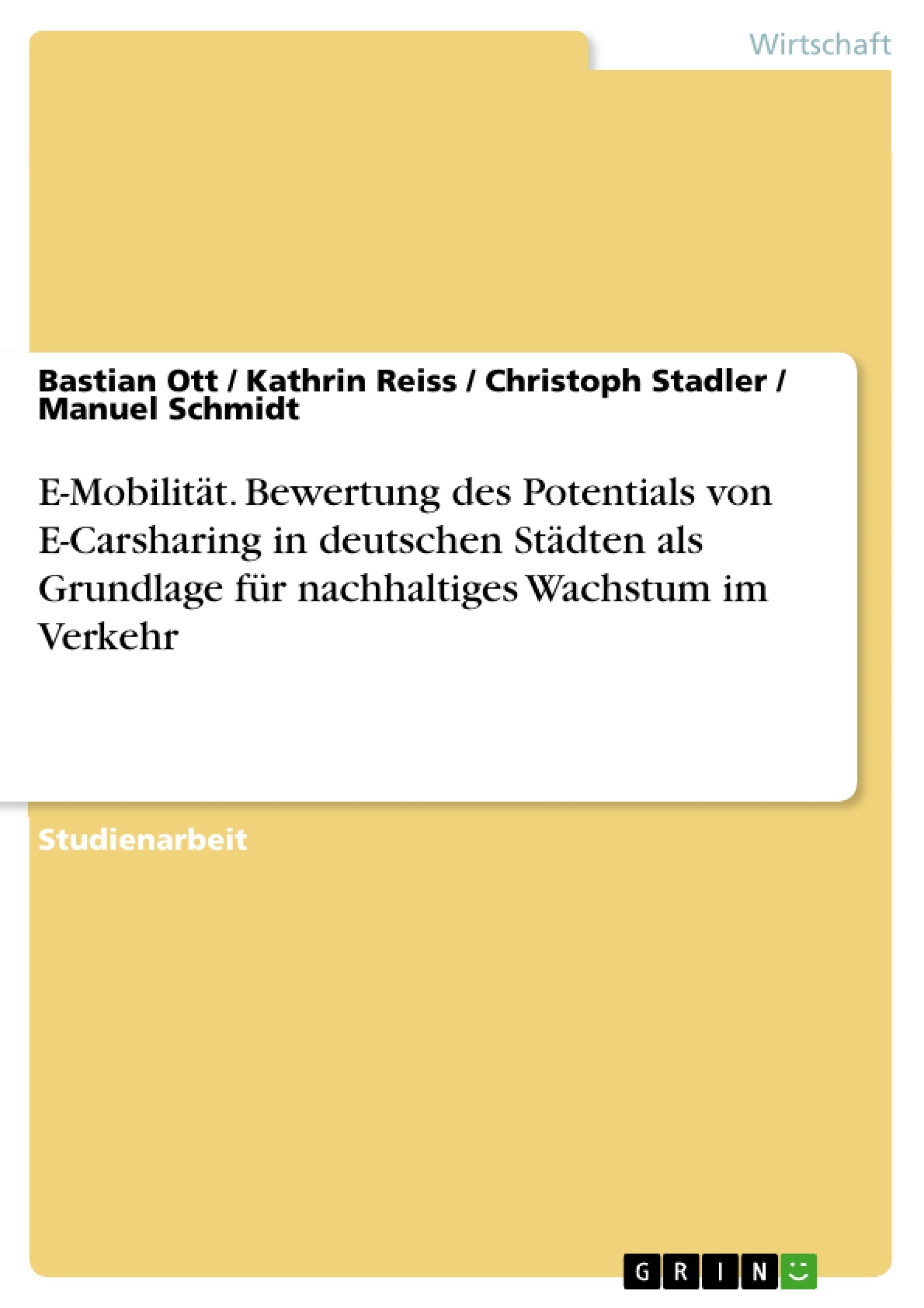In der Geschichte der Bundesrepublik führten seit den 50er Jahren das Wirtschaftswunder und die damit verbundenen technischen und ökonomischen Fortschritte zu einem enormen Boom in der Autoindustrie. Ob in der Freizeit oder auf dem Weg zur Arbeit, Mobilität gehört jeher zu den Grundbedürfnissen des Menschen. In Deutschland gilt das Auto seit je als Symbol für Freiheit, Status und Flexibilität.
Mit dem ersten Ölpreisschock, der zunehmenden Verkehrsdichte in Ballungsräumen und der globalen Erwärmung sowie der damit verbundenen Einsicht über die Begrenztheit des Wachstums, lässt sich ein bis heute andauernder Wandel im Verkehrsmarkt erkennen. Aufgrund dieser Herausforderungen sind nachhaltige Lösungskonzepte notwendig, um auch zukünftig maximale Mobilität, nachhaltiges und ökonomisches Wachstum garantieren zu können.
Neben den technischen und infrastrukturellen Veränderungen, kristallisierte sich in den letzten Jahren auch der Trend der Sharing-Economy als Entwicklung im Mobilitätssektor heraus. Wie sich gezeigt hat, ging in den vergangenen Jahren der Anteil der Pkw-Besitzer in Deutschland um ein gutes Drittel zurück. Stattdessen wurden vermehrt öffentliche Verkehrsmittel oder das Angebot von Organisationen wahrgenommen, die ein Teilen der Pkws unter mehreren Personen ermöglichen. Der Begriff des Carsharings ist seit vielen Jahren renommiert und wird stetig zunehmend täglich und auf globaler Ebene als Alternative zum eigenen Pkw genutzt.
Als eine Kombination aus den genannten Mobilitätsinnovationen, etablierte sich weiterhin weltweit das Modell des E-Carsharings. Immer häufiger integrieren Carsharing Organisationen die umweltfreundlichen Fahrzeuge in ihre Flotten, um eine doppelte Nachhaltigkeit zu erzielen. Trotz eindeutiger Vorteile und Potentiale dieses Modells, gibt es dennoch einige Hemmnisse für eine flächendeckende und globale Marktdurchdringung dieses Konzepts.
Ziel dieser Arbeit ist es deshalb, zu untersuchen, welche Kriterien, seien es Potentiale, Hemmnisse oder Parteien, bei der Bewertung von Mobilitätskonzepten im E-Carsharing in unterschiedlichster Weise eine Rolle spielen. Mithilfe von drei Praxisbeispielen, die unterschiedliche Erfolgsfaktoren aufweisen, wird der Kriterienkatalog unter Einbeziehung dieser Faktoren angewendet und die Städte in Bezug auf ihre Umsetzung von E-Carsharing bewertet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung (Kathrin Reiss)
- E-Mobilität im Kontext zu Green Growth
- Green Growth: Ursprung, Abgrenzung und Definition (Manuel Schmidt)
- E-Mobilität: Abgrenzung, Definition und Marktdurchdringung (Manuel Schmidt)
- Das Prinzip von Carsharing und seine Vor- und Nachteile (Kathrin Reiss)
- Potenziale von E-Carsharing aus globaler Sicht (Kathrin Reiss)
- Akteure und Einflussfaktoren im E-Carsharing
- Wachstumsfaktor Politik für die E-Mobilität (Bastian Ott)
- Wachstumsfaktor Politik für das E-Carsharing (Bastian Ott)
- Automobilhersteller als E-Carsharing-Anbieter (Christoph Stadler)
- Unternehmen als E-Carsharing-Nutzer (Christoph Stadler)
- Privatkonsumenten als Nutzer von E-Carsharing (Christoph Stadler)
- Kriterienkatalog zur Bewertung des Potentials von E-Carsharing
- Methodik und Funktionsweise des Kriterienkatalogs (Bastian Ott)
- Case Study 1: Die Stadt Stuttgart (Kathrin Reiss)
- Case Study 2: Die Stadt Freiburg (Manuel Schmidt)
- Case Study 3: Die Stadt Berlin (Christoph Stadler)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Studienarbeit befasst sich mit der Entwicklung und Anwendung eines Kriterienkatalogs zur Bewertung des Potentials von E-Carsharing in deutschen Städten. Die Arbeit zielt darauf ab, die Rolle des E-Carsharing im Kontext von Green Growth und nachhaltigem Verkehrswachstum zu analysieren.
- Green Growth und seine Bedeutung für die nachhaltige Entwicklung
- E-Mobilität und ihre Rolle im Verkehrssektor
- Das Konzept von Carsharing und seine Vor- und Nachteile
- Die Potenziale von E-Carsharing in deutschen Städten
- Der Einfluss von Akteuren und Einflussfaktoren auf die Entwicklung von E-Carsharing
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Relevanz von E-Carsharing im Kontext von Green Growth und nachhaltigem Verkehrswachstum. Kapitel 2 beleuchtet die Konzepte von Green Growth und E-Mobilität und stellt das Prinzip von Carsharing sowie seine Vor- und Nachteile dar. Kapitel 3 analysiert die Potenziale von E-Carsharing aus globaler Sicht und untersucht die Rolle von Akteuren und Einflussfaktoren im E-Carsharing-Markt. Kapitel 4 entwickelt einen Kriterienkatalog zur Bewertung des Potentials von E-Carsharing und analysiert anhand von Case Studies die Situation in den Städten Stuttgart, Freiburg und Berlin.
Schlüsselwörter
Green Growth, E-Mobilität, Carsharing, E-Carsharing, nachhaltiges Wachstum, Verkehrswachstum, Potenzialanalyse, Kriterienkatalog, Case Studies, Stuttgart, Freiburg, Berlin.
Häufig gestellte Fragen
Welches Potential hat E-Carsharing in deutschen Städten?
E-Carsharing bietet ein hohes Potential für nachhaltiges Wachstum (Green Growth), indem es umweltfreundliche Mobilität ohne den Besitz eines eigenen PKWs ermöglicht.
Was sind die größten Hemmnisse für E-Carsharing?
Zu den Hemmnissen gehören die noch lückenhafte Ladeinfrastruktur, hohe Anschaffungskosten der Fahrzeuge und die Reichweitenangst der Nutzer.
Welche Rolle spielt die Politik bei der E-Mobilität?
Die Politik ist ein entscheidender Wachstumsfaktor durch Förderprogramme, rechtliche Rahmenbedingungen und den Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur.
Wie unterscheiden sich die Case Studies Stuttgart, Freiburg und Berlin?
Die Städte weisen unterschiedliche Erfolgsfaktoren auf, von topographischen Herausforderungen in Stuttgart bis hin zu einer sehr hohen Anbieterdichte und Nutzerakzeptanz in Berlin.
Was versteht man unter "Green Growth" im Verkehr?
Es beschreibt ein Wirtschaftswachstum, das ökologisch nachhaltig ist und Ressourcen schont, wobei E-Mobilität und Sharing-Modelle zentrale Bausteine sind.
- Citar trabajo
- Bastian Ott (Autor), Kathrin Reiss (Autor), Christoph Stadler (Autor), Manuel Schmidt (Autor), 2017, E-Mobilität. Bewertung des Potentials von E-Carsharing in deutschen Städten als Grundlage für nachhaltiges Wachstum im Verkehr, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/367111