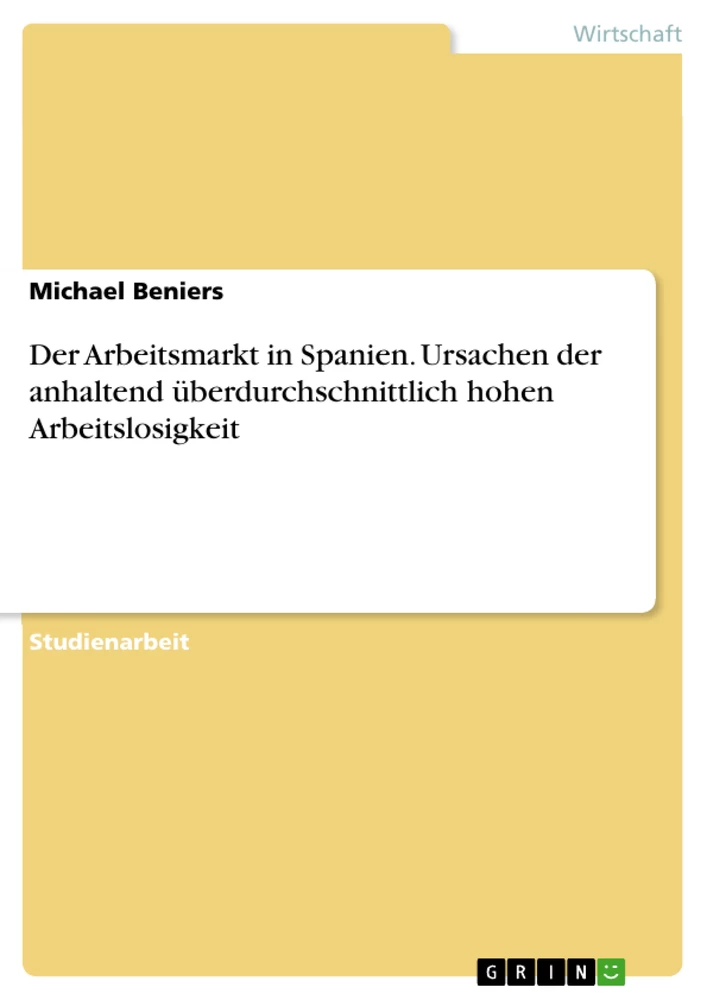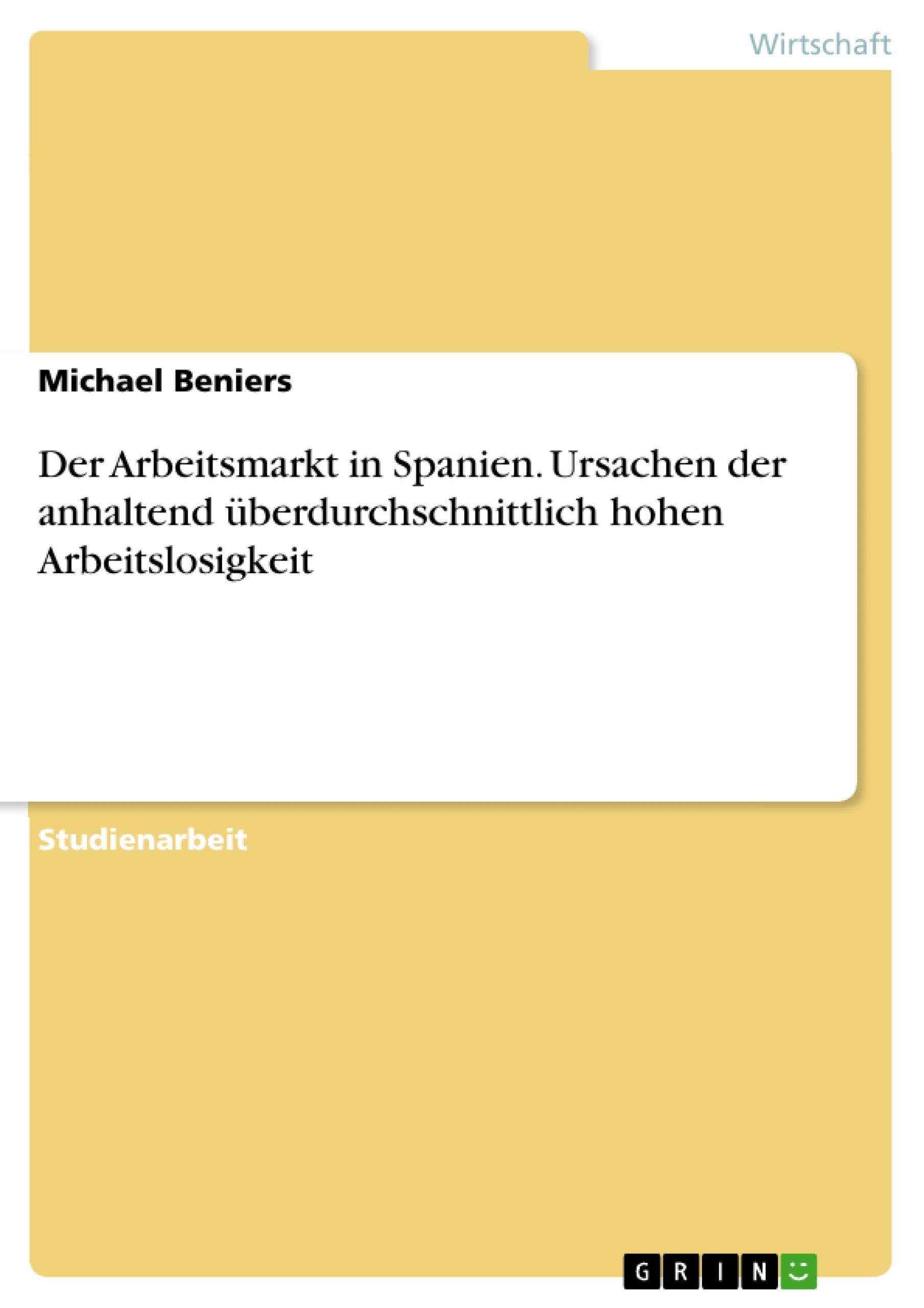Um das Problem der derzeit hohen Arbeitslosigkeit in Spanien zu begründen, reicht es nicht aus, nur die letzte Wirtschaftskrise zu betrachten. Die anhaltend überdurchschnittliche Arbeitslosigkeit und ihr vergleichsweise hoher Anstieg durch die Krise lassen erahnen, dass das Problem im Kern des spanischen Arbeitsmarktes selbst steckt.
Das Ziel dieser Seminararbeit ist es, die Ursachen für die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit in Spanien zu beleuchten und zu erklären. Dazu werden zu Beginn einige ausgewählte ökonomische Kennzahlen der spanischen Volkswirtschaft und ihre Entwicklung im Zeitverlauf betrachtet. Im darauf folgenden Kapitel werden die wichtigsten Gründe für die hohe Arbeitslosigkeit analysiert, wobei zuerst der duale Arbeitsmarkt und im nächsten Abschnitt die Finanz- und Immobilienkrise 2007 thematisiert werden. Der Fokus liegt hierbei auf dem Immobilienmarkt, um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu überschreiten. Anschließend werden die letzten Arbeitsmarktreformen und ihre bisherigen Ergebnisse betrachtet. Zum Abschluss gibt es ein kurzes Fazit, das die wichtigsten Punkte zusammenfasst und schlussendlich die Frage der Ursachen der anhaltenden Arbeitslosigkeit versucht zu klären."
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Entwicklung ausgewählter ökonomischer Kennzahlen der spanischen Volkswirtschaft
- 3. Gründe für die hohe Arbeitslosigkeit in Spanien
- 3.1. Dualer Arbeitsmarkt
- 3.1.1. Entstehung des dualen Arbeitsmarktes in Spanien
- 3.1.2. Struktur des dualen Arbeitsmarktes in Spanien
- 3.2. Immobilienkrise 2007
- 3.2.1. Ursachen der Krise in Spanien
- 3.2.2. Auswirkungen der Krise auf den spanischen Arbeitsmarkt
- 4. Arbeitsmarktreformen 2010 und 2012 in Spanien
- 4.1. Änderungen
- 4.2. Bisherige Ergebnisse
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Ursachen der anhaltend hohen Arbeitslosigkeit in Spanien. Sie analysiert die Entwicklung relevanter ökonomischer Kennzahlen, beleuchtet die strukturellen Probleme des spanischen Arbeitsmarktes und untersucht die Auswirkungen der Immobilienkrise von 2007. Darüber hinaus werden die Arbeitsmarktreformen der letzten Jahre und ihre Auswirkungen auf die Arbeitslosigkeit beleuchtet.
- Entwicklung des spanischen Arbeitsmarktes im Vergleich zu anderen EU-Ländern
- Einfluss des dualen Arbeitsmarktes auf die Arbeitslosigkeit
- Auswirkungen der Immobilienkrise auf den spanischen Arbeitsmarkt
- Analyse der Arbeitsmarktreformen der letzten Jahre
- Perspektiven für die zukünftige Entwicklung der Arbeitslosigkeit in Spanien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der anhaltend hohen Arbeitslosigkeit in Spanien dar und skizziert die Problematik im Kontext der globalen Finanzkrise. Kapitel 2 analysiert die Entwicklung ausgewählter ökonomischer Kennzahlen der spanischen Volkswirtschaft, um einen Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung und die Arbeitsmarktsituation zu geben. Kapitel 3 beleuchtet die Ursachen für die hohe Arbeitslosigkeit in Spanien, wobei der Fokus auf dem dualen Arbeitsmarkt und der Immobilienkrise liegt. In Kapitel 4 werden die Arbeitsmarktreformen der Jahre 2010 und 2012 in Spanien analysiert, und es werden die bisherigen Ergebnisse der Reformen beleuchtet.
Schlüsselwörter
Spanische Arbeitslosigkeit, dualer Arbeitsmarkt, Immobilienkrise, Arbeitsmarktreformen, EU-Vergleich, Wirtschaftspolitik, ökonomische Kennzahlen, Jugendarbeitslosigkeit, Langzeitarbeitslosigkeit.
- Arbeit zitieren
- Michael Beniers (Autor:in), 2015, Der Arbeitsmarkt in Spanien. Ursachen der anhaltend überdurchschnittlich hohen Arbeitslosigkeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/367124