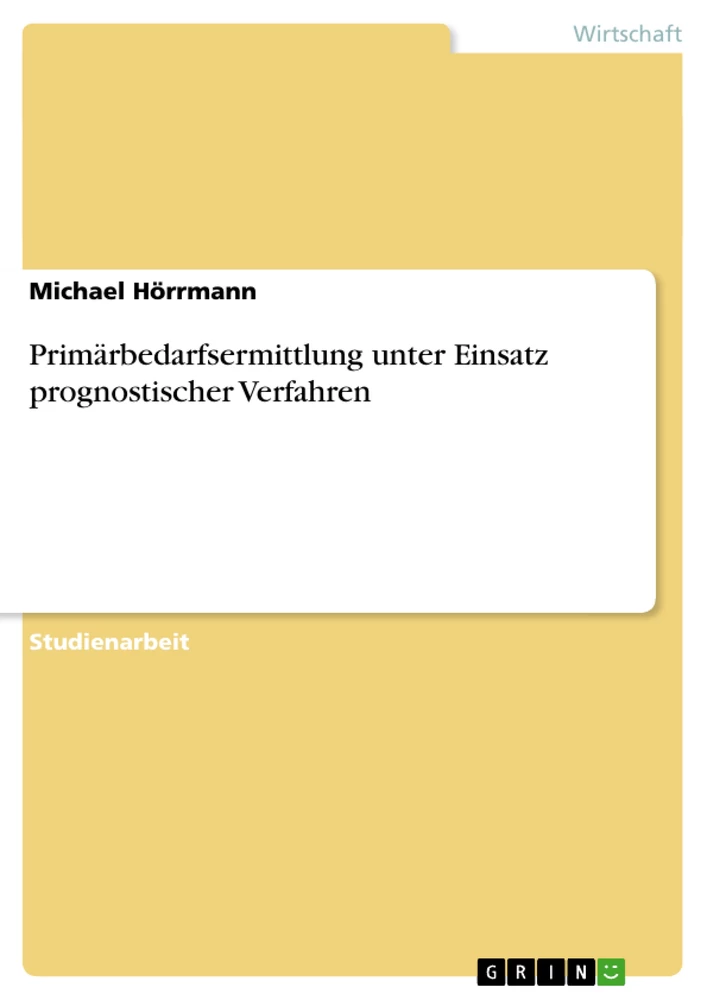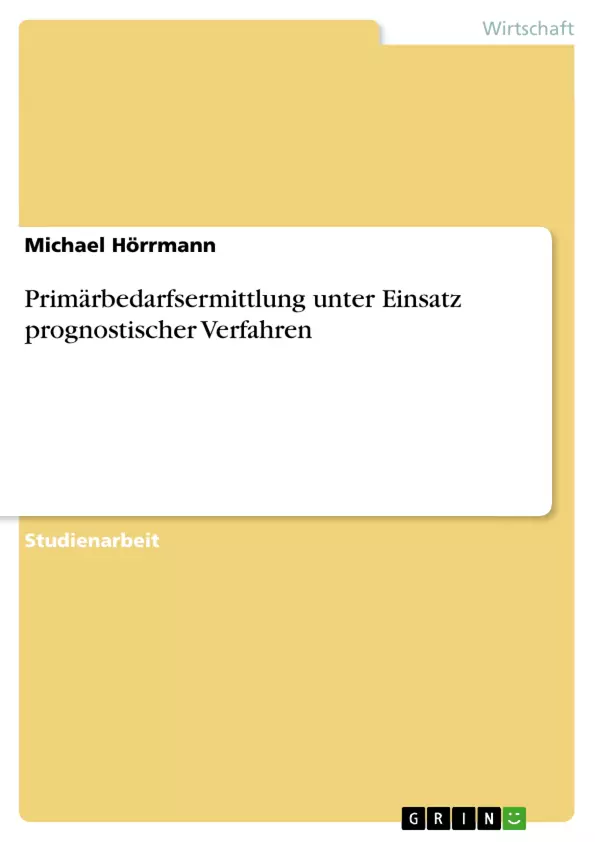In der betriebswirtschaftlichen Praxis ist es fast unerlässlich, so gut und so weit es geht in die Zukunft zu planen. Zukünftige Nachfragegrößen sollten schon vor dem tatsächlichen Eintreffen bekannt sein, um die Produktion, insbesondere Materialbedarf, Maschinenbedarf, Lagerhaltung etc., im Vorfeld planen zu können. Die Genauigkeit der Bedarfsermittlung spielt dabei eine große Rolle, denn nach ihr richtet sich die Größe der Sicherheitsbestände in der Lagerhaltung. Das Ziel ist hierbei, die Sicherheitsbestände so klein wie möglich zu halten, damit möglichst wenig Finanzmittel vom Lager gebunden werden. 1 Andererseits ist es auch zu vermeiden, die Sicherheitsbestände zu klein werden zu lassen, weil sonst unter Umständen nicht geliefert, also der Bedarf nicht befriedigt werden kann, und auch dies kommt einem Verlust gleich. Es gilt darum, den Bedarf an den abzusetzenden Produkten möglichst exakt vorherzusagen. Darum hat die prognostische Primärbedarfsermittlung einen großen Stellenwert. Dabei gibt es eine große Anzahl verschiedener Verfahren. Die vorliegende Arbeit möchte einen Überblick über einige von ihnen geben und dabei auch Kriterien aufzeigen, nach denen einzelne Verfahren ausgewählt werden und später im Hinblick auf deren Genauigkeit überprüft werden können. Nach einigen einführenden Bemerkungen im ersten Kapitel und der Schaffung der begrifflichen Grundlagen im zweiten Kapitel, behandelt die vorliegende Arbeit in Kapitel 3 einige gängige prognostische Verfahren zur Primärbedarfsermittlung, wobei diese nach den Bedarfsverlaufsarten untergliedert sind. Es liegt in der Natur der Sache, dass bei Prognosen auch immer Abweichungen zwischen Prognosewerten und den tatsächlich realisierten Werten vorkommen. Daher werden im vierten Kapitel verschiedene Fehlermaße dargestellt und deren Nutzen für zukünftige weitere Prognosen aufgezeigt. Im fünften Kapitel werden die behandelten Themen abschließend zusammengefasst. 1 Vgl. Hackstein, R. (1989), S.133
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 1.1 Gegenstand und Zielsetzung der Arbeit
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2. Begriffliche Grundlagen
- 2.1 Primärbedarf
- 2.2 Prognostische Verfahren
- 3. Bedarfsermittlung bei verschiedenen Bedarfsverlaufsarten
- 3.1 Bedarfsermittlung bei konstantem Bedarfsverlauf
- 3.1.1 Einfacher Mittelwert
- 3.1.2 Gleitender Mittelwert
- 3.1.3 Gewogene Mittelwerte
- 3.1.4 Exponentielle Glättung erster Ordnung
- 3.2 Bedarfsermittlung bei trendförmigem Bedarfsverlauf
- 3.2.1 Methode der kleinsten Quadrate
- 3.2.2 Exponentielle Glättung erster Ordnung mit Trendkorrektur
- 3.2.3 Exponentielle Glättung zweiter Ordnung
- 3.3 Bedarfsermittlung bei saisonalem Bedarfsverlauf
- 3.3.1 Anwendung der bisherigen Verfahren
- 3.3.2 Zeitreihendekomposition
- 3.3.3 Das Verfahren von Winters
- 3.4 Bedarfsermittlung bei sporadischem Bedarfsverlauf
- 3.4.1 Verfahren von Wedekind
- 3.4.2 Verfahren von Trux
- 4. Prognosefehler
- 4.1 Standardabweichung
- 4.2 Mittlere absolute Abweichung
- 4.3 Abweichungssignal
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit zielt darauf ab, einen Überblick über verschiedene Verfahren der prognostischen Primärbedarfsermittlung zu geben. Die Arbeit untersucht verschiedene Methoden und Kriterien für die Auswahl und die Genauigkeitsüberprüfung dieser Verfahren.
- Vergleich verschiedener Verfahren zur Primärbedarfsermittlung
- Kriterien zur Auswahl geeigneter Verfahren je nach Bedarfsverlauf
- Analyse und Bewertung von Prognosefehlern
- Methoden zur Fehlerminimierung und -kontrolle
- Anwendung der Verfahren auf unterschiedliche Bedarfsverlaufsarten (konstant, trendförmig, saisonal, sporadisch)
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der prognostischen Primärbedarfsermittlung ein und erläutert die Bedeutung genauer Bedarfsprognosen für die Produktionsplanung und -steuerung. Es wird die Zielsetzung der Arbeit definiert, welche darin besteht, einen Überblick über verschiedene Verfahren zu geben und Kriterien für deren Auswahl und Überprüfung aufzuzeigen. Der Aufbau der Arbeit wird skizziert.
2. Begriffliche Grundlagen: Das Kapitel definiert den Primärbedarf als Marktnachfrage nach verkaufsfähigen Erzeugnissen und unterscheidet ihn vom Sekundär- und Tertiärbedarf. Es werden die programmgesteuerte und die verbrauchsgesteuerte Bedarfsermittlung erläutert. Der Fokus liegt auf der verbrauchsgesteuerten Bedarfsermittlung, die stochastische Verfahren zur Prognose des Primärbedarfs nutzt. Qualitative und quantitative Prognosemethoden werden unterschieden, wobei die Arbeit sich auf quantitative Verfahren konzentriert.
3. Bedarfsermittlung bei verschiedenen Bedarfsverlaufsarten: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über verschiedene Verfahren zur verbrauchsorientierten Bedarfsermittlung, klassifiziert nach Bedarfsverlaufsarten (konstant, trendförmig, saisonal, sporadisch). Es werden für jeden Verlaufstyp verschiedene Methoden detailliert beschrieben, inklusive ihrer Berechnungsformeln und Vor- und Nachteile. Die Bedeutung der Auswahl des richtigen Verfahrens basierend auf dem jeweiligen Bedarfsverlauf wird betont.
4. Prognosefehler: Das Kapitel widmet sich der Analyse von Prognosefehlern. Es werden die Standardabweichung und die mittlere absolute Abweichung als Messgrößen für die Prognosegenauigkeit eingeführt. Das Konzept des Abweichungssignals zur Erkennung von systematischen Fehlern und zur Steuerung des Prognoseprozesses wird erläutert. Die Bedeutung der Fehleranalyse für die Verbesserung zukünftiger Prognosen wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Primärbedarfsermittlung, Prognose, Prognoseverfahren, Bedarfsverlauf, konstanter Bedarfsverlauf, trendförmiger Bedarfsverlauf, saisonaler Bedarfsverlauf, sporadischer Bedarfsverlauf, exponentielle Glättung, Methode der kleinsten Quadrate, Prognosefehler, Standardabweichung, mittlere absolute Abweichung, Abweichungssignal, Produktionsplanung, Materialbedarfsplanung.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Prognostische Primärbedarfsermittlung
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit bietet einen umfassenden Überblick über verschiedene Verfahren der prognostischen Primärbedarfsermittlung. Sie untersucht Methoden zur Bedarfsermittlung und Kriterien für deren Auswahl und Genauigkeitsüberprüfung.
Welche Bedarfsverlaufsarten werden betrachtet?
Die Arbeit behandelt die Bedarfsermittlung für verschiedene Bedarfsverlaufsarten: konstanten, trendförmigen, saisonalen und sporadischen Verlauf. Für jeden Typ werden spezifische Verfahren erläutert.
Welche Verfahren zur Primärbedarfsermittlung werden beschrieben?
Es werden zahlreiche Verfahren detailliert beschrieben, darunter der einfache Mittelwert, gleitende Mittelwerte, gewogene Mittelwerte, exponentielle Glättung (erster und zweiter Ordnung), die Methode der kleinsten Quadrate, das Verfahren von Winters und Methoden für sporadischen Bedarf (Wedekind, Trux). Die jeweiligen Berechnungsformeln und Vor- und Nachteile werden diskutiert.
Wie werden Prognosefehler analysiert?
Die Analyse von Prognosefehlern erfolgt mithilfe der Standardabweichung, der mittleren absoluten Abweichung und des Abweichungssignals. Die Bedeutung der Fehleranalyse für die Verbesserung zukünftiger Prognosen wird hervorgehoben.
Welche Kriterien dienen der Auswahl geeigneter Verfahren?
Die Auswahl des geeigneten Verfahrens hängt maßgeblich vom jeweiligen Bedarfsverlauf ab. Die Arbeit liefert Kriterien zur Auswahl und Bewertung der Verfahren, um die Genauigkeit der Prognose zu maximieren.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Einführung, 2. Begriffliche Grundlagen (Primärbedarf, Prognosemethoden), 3. Bedarfsermittlung bei verschiedenen Bedarfsverlaufsarten, 4. Prognosefehler und 5. Zusammenfassung. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der prognostischen Primärbedarfsermittlung.
Was sind die Schlüsselwörter der Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Primärbedarfsermittlung, Prognose, Prognoseverfahren, Bedarfsverlauf, konstanter Bedarfsverlauf, trendförmiger Bedarfsverlauf, saisonaler Bedarfsverlauf, sporadischer Bedarfsverlauf, exponentielle Glättung, Methode der kleinsten Quadrate, Prognosefehler, Standardabweichung, mittlere absolute Abweichung, Abweichungssignal, Produktionsplanung, Materialbedarfsplanung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Seminararbeit?
Die Seminararbeit zielt darauf ab, einen umfassenden Überblick über verschiedene Verfahren der prognostischen Primärbedarfsermittlung zu geben und Kriterien für deren Auswahl und Genauigkeitsüberprüfung aufzuzeigen. Der Vergleich verschiedener Verfahren und die Analyse von Prognosefehlern stehen im Mittelpunkt.
- Quote paper
- Michael Hörrmann (Author), 2003, Primärbedarfsermittlung unter Einsatz prognostischer Verfahren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36712