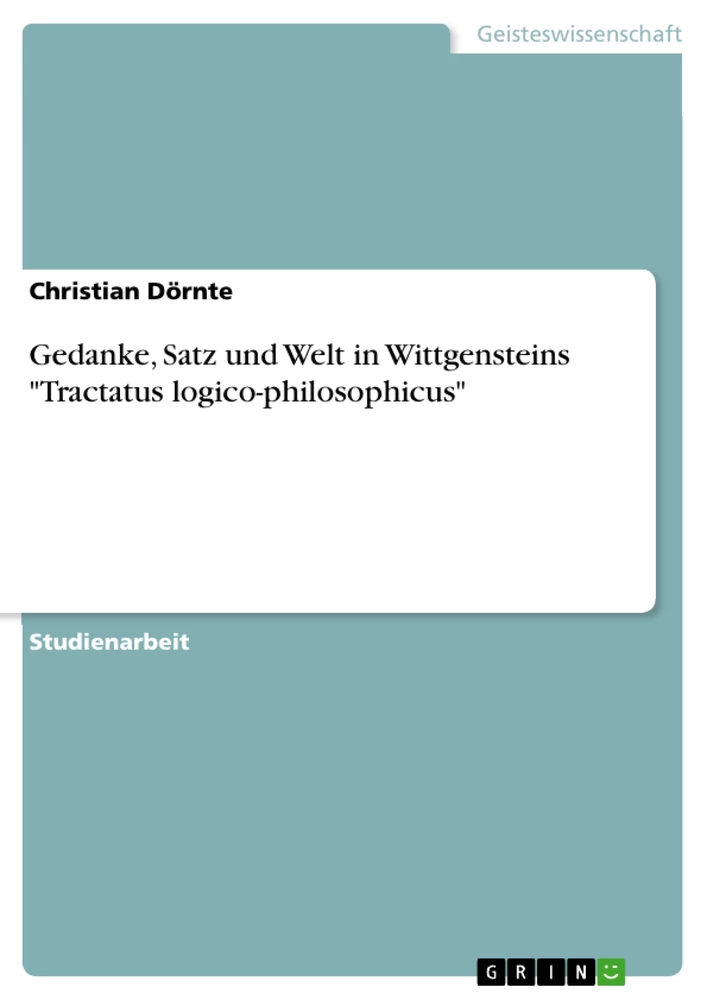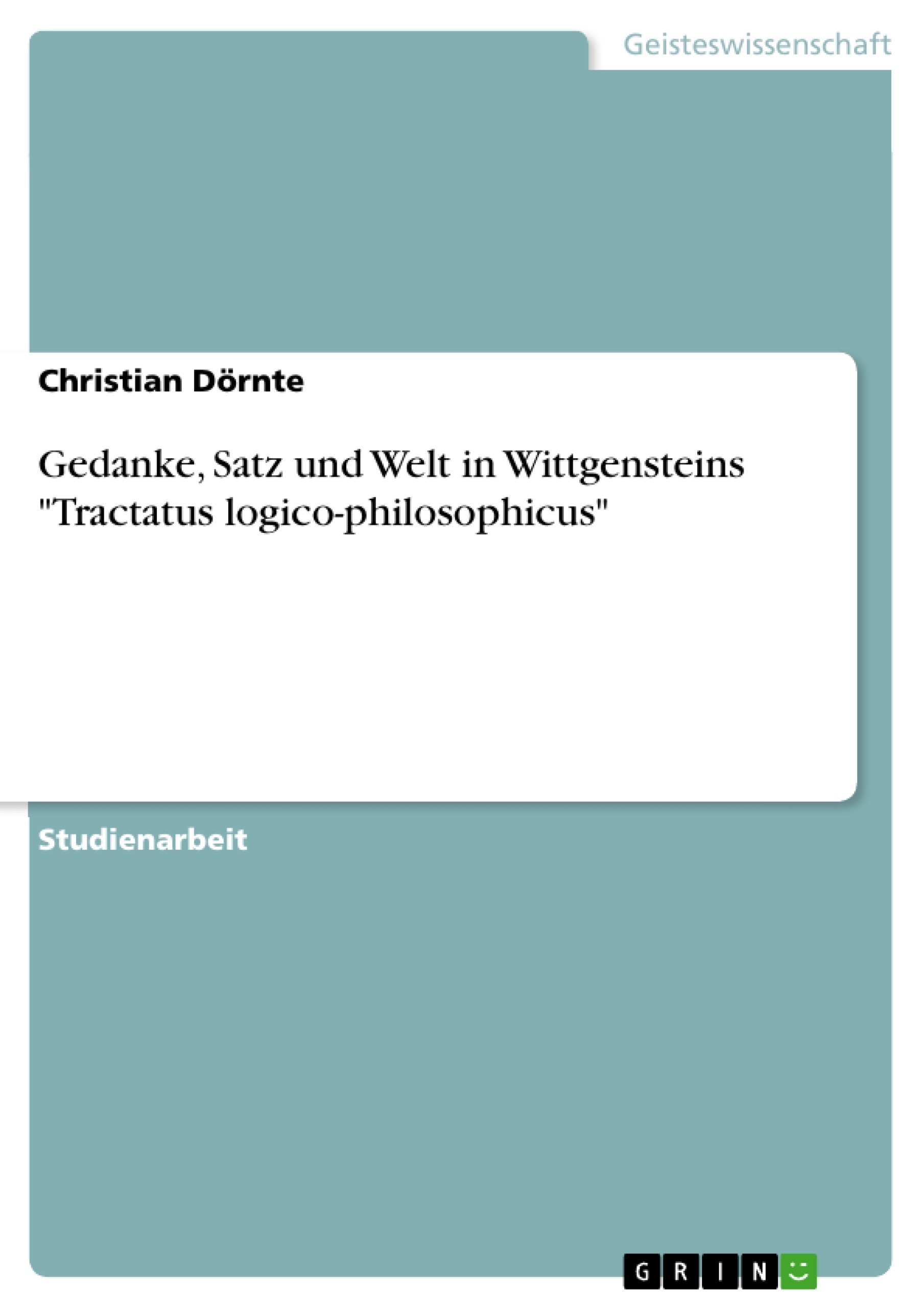Thema dieser Hausarbeit ist das Verhältnis der Begriffe Gedanke, Satz und Welt in Wittgensteins "Tractatus logico-philosophicus". Um das Verhältnis dieser Begriffe untereinander zu analysieren, befasse ich mich in Kapitel 1 mit der Frage nach dem logischen Denken und der nach dem logischen Bild, um zu klären, was Wittgenstein zufolge unter einem Gedanken zu verstehen ist.
In Kapitel 2 geht es um die Unterscheidung von sinnvollen, sinnlosen und unsinnigen Sätzen und darum, warum nur sinnvolle Sätze eine Beschreibung der Welt liefern können. Interessanterweise bezeichnet Wittgenstein seine eigenen Sätze, d. h. die des Tractatus, als unsinnige Sätze. Daher soll in Kapitel 3 die Frage danach beantwortet werden, was der Fall sein muss, damit wir diese als unsinnige Sätze erkennen können. Eine weitere Frage, die sich daraus ergibt, ist, ob wir diese Sätze überhaupt verstehen können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Der Gedanke
- 1.1 Das logische Denken
- 1.2 Das logische Bild
- 2. Der Satz
- 2.1 Der sinnvolle Satz
- 2.2 Der sinnlose Satz
- 2.3 Der unsinnige Satz
- 3. Die Welt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das Verhältnis von Gedanke, Satz und Welt im Tractatus logico-philosophicus Wittgensteins. Sie untersucht die von Wittgenstein verwendeten Begriffe als Termini einer internen Terminologie, fokussiert auf die Interdependenz dieser zentralen Konzepte und beleuchtet deren Rolle im Verständnis des Gesamtwerks.
- Der Begriff des logischen Bildes der Tatsachen und seine Beziehung zum Gedanken.
- Die Unterscheidung zwischen sinnvollen, sinnlosen und unsinnigen Sätzen und ihre Bedeutung für die Beschreibung der Welt.
- Wittgensteins Konzeption von Logik und deren Verhältnis zu Psychologie.
- Die Natur des logischen Bildes und dessen Rolle in der Darstellung der Wirklichkeit.
- Die Frage nach dem Verständnis und der Erkennbarkeit von Wittgensteins eigenen Sätzen als unsinnig bezeichnet.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Diese Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor: die Analyse des Verhältnisses von Gedanke, Satz und Welt im Tractatus logico-philosophicus. Sie begründet die methodische Herangehensweise, die auf der Interpretation der Begriffe als Termini einer internen Terminologie basiert, und skizziert den Aufbau der Arbeit mit einer kurzen Zusammenfassung der einzelnen Kapitel. Die zentrale These ist, dass ein Verständnis dieser drei Begriffe fundamental für das Verständnis des gesamten Tractatus ist. Der Bezug auf Mayer's "Quasidefinitionen" legt den Grundstein für eine systematische Betrachtung der Wittgensteinschen Argumentation. Die Einleitung verweist auch auf die seltsame Charakterisierung der Sätze des Tractatus durch Wittgenstein selbst als unsinnig und kündigt die Auseinandersetzung damit in Kapitel 3 an.
1. Der Gedanke: Dieses Kapitel untersucht den Begriff des Gedankens im Tractatus als "logisches Bild der Tatsachen". Es analysiert die Definition des Gedankens anhand der Hauptsätze des Tractatus und erörtert die Bedeutung des "logischen Bildes". Die Analyse beleuchtet die Frage, was ein Bild zu einem logischen Bild macht, und verknüpft dies mit der Frage nach der Natur von Logik und Denken bei Wittgenstein. Das Kapitel diskutiert Wittgensteins antipsychologistische Position und hebt die Apriorität und Transzendentalität der Logik hervor, während es den Unterschied zwischen "alter" und "neuer" Logik aufzeigt. Schließlich analysiert der Text die Abgrenzung des Studiums der Zeichensprache (und somit der Denkprozesse) von unwesentlichen psychologischen Untersuchungen. Das Kapitel verwendet die Hauptsätze 2, 3 und 4 sowie diverse Bemerkungen aus dem Tractatus als Basis für die Argumentation.
2. Der Satz: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Unterscheidung zwischen sinnvollen, sinnlosen und unsinnigen Sätzen im Tractatus. Es analysiert die Funktion des Satzes als Mittel zur Abbildung der Welt und erörtert, warum nur sinnvolle Sätze eine adäquate Beschreibung der Welt liefern können. Die Kapitelstruktur deutet auf eine detaillierte Untersuchung der unterschiedlichen Satzarten hin, um die Grenzen und Möglichkeiten der sprachlichen Darstellung der Wirklichkeit im Denken Wittgensteins zu beleuchten. Die Unterscheidung der Satzarten ist entscheidend für das Verständnis von Wahrheit und Abbildung im Rahmen des gesamten Werkes. Die Diskussion über sinnvolle Sätze als logisches Abbild von Sachverhalten steht im Zentrum der Argumentation.
3. Die Welt: Dieses Kapitel, angesichts der vorangegangenen Analyse, wird sich voraussichtlich mit der Bedeutung des Begriffs "Welt" im Kontext von Gedanke und Satz auseinandersetzen. Es wird wahrscheinlich klären, wie die Welt durch die sinnvollen Sätze, welche die Gedanken repräsentieren, abgebildet wird. Der Schwerpunkt wird vermutlich auf der Beziehung zwischen der sprachlichen Darstellung und der Wirklichkeit liegen. Die Erörterung der von Wittgenstein selbst als unsinnig bezeichneten Sätze des Tractatus wird hier zentral sein, da diese Sätze ein besonderes Problem darstellen, um die Grenzen der Sprache und die Möglichkeiten der philosophischen Aussage zu klären.
Schlüsselwörter
Tractatus logico-philosophicus, Wittgenstein, Gedanke, Satz, Welt, logisches Bild, sinnvoller Satz, sinnloser Satz, unsinniger Satz, Logik, Psychologie, antipsychologistische Position, Bild, Wirklichkeit, Tatsache, Sachverhalt.
Häufig gestellte Fragen zum Tractatus logico-philosophicus
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Verhältnis von Gedanke, Satz und Welt im Tractatus logico-philosophicus von Wittgenstein. Sie untersucht die verwendeten Begriffe als interne Terminologie und fokussiert auf deren Interdependenz und Rolle im Verständnis des Gesamtwerks.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Begriff des logischen Bildes der Tatsachen und seine Beziehung zum Gedanken, die Unterscheidung zwischen sinnvollen, sinnlosen und unsinnigen Sätzen und deren Bedeutung für die Weltbeschreibung, Wittgensteins Logikkonzeption und deren Verhältnis zur Psychologie, die Natur des logischen Bildes und seine Rolle in der Wirklichkeitsdarstellung sowie die Frage nach dem Verständnis von Wittgensteins eigenen Sätzen als unsinnig bezeichnet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, drei Kapitel (Der Gedanke, Der Satz, Die Welt) und ein Kapitel mit Schlüsselbegriffen. Die Einleitung stellt das Thema und die methodische Herangehensweise vor und skizziert den Aufbau. Jedes Kapitel behandelt einen der drei zentralen Begriffe (Gedanke, Satz, Welt) im Detail und analysiert dessen Rolle im Tractatus. Die Einleitung hebt zudem die seltsame Selbstcharakterisierung der Sätze des Tractatus durch Wittgenstein als unsinnig hervor, welches im dritten Kapitel weiter untersucht wird.
Was ist der zentrale Inhalt des Kapitels "Der Gedanke"?
Dieses Kapitel untersucht den Gedanken als "logisches Bild der Tatsachen", analysiert dessen Definition anhand der Hauptsätze des Tractatus und erörtert die Bedeutung des "logischen Bildes". Es beleuchtet, was ein Bild zu einem logischen Bild macht, verknüpft dies mit Logik und Denken bei Wittgenstein, diskutiert dessen antipsychologistische Position und hebt die Apriorität und Transzendentalität der Logik hervor. Der Unterschied zwischen "alter" und "neuer" Logik sowie die Abgrenzung des Studiums der Zeichensprache von psychologischen Untersuchungen werden ebenfalls behandelt. Hauptsätze 2, 3 und 4 sowie diverse Bemerkungen aus dem Tractatus bilden die Argumentationsbasis.
Was ist der zentrale Inhalt des Kapitels "Der Satz"?
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Unterscheidung zwischen sinnvollen, sinnlosen und unsinnigen Sätzen. Es analysiert die Funktion des Satzes als Mittel zur Weltabbildung und erörtert, warum nur sinnvolle Sätze eine adäquate Weltbeschreibung liefern. Die Kapitelstruktur deutet auf eine detaillierte Untersuchung der unterschiedlichen Satzarten hin, um die Grenzen und Möglichkeiten der sprachlichen Wirklichkeitsdarstellung zu beleuchten. Die Unterscheidung ist entscheidend für das Verständnis von Wahrheit und Abbildung im Werk. Die Diskussion über sinnvolle Sätze als logisches Abbild von Sachverhalten steht im Zentrum.
Was ist der erwartete zentrale Inhalt des Kapitels "Die Welt"?
Dieses Kapitel wird sich mit der Bedeutung des Begriffs "Welt" im Kontext von Gedanke und Satz auseinandersetzen. Es wird klären, wie die Welt durch sinnvolle Sätze (welche die Gedanken repräsentieren) abgebildet wird und sich auf die Beziehung zwischen sprachlicher Darstellung und Wirklichkeit konzentrieren. Die Erörterung der von Wittgenstein als unsinnig bezeichneten Sätze des Tractatus wird hier zentral sein, um die Grenzen der Sprache und die Möglichkeiten philosophischer Aussagen zu klären.
Welche Schlüsselbegriffe werden in der Arbeit verwendet?
Schlüsselbegriffe sind: Tractatus logico-philosophicus, Wittgenstein, Gedanke, Satz, Welt, logisches Bild, sinnvoller Satz, sinnloser Satz, unsinniger Satz, Logik, Psychologie, antipsychologistische Position, Bild, Wirklichkeit, Tatsache, Sachverhalt.
Welche Methode wird in dieser Arbeit angewendet?
Die Arbeit interpretiert die Begriffe des Tractatus als Termini einer internen Terminologie. Der Bezug auf Mayer's "Quasidefinitionen" legt den Grundstein für eine systematische Betrachtung der Wittgensteinschen Argumentation.
Was ist die zentrale These der Arbeit?
Ein Verständnis der Begriffe Gedanke, Satz und Welt ist fundamental für das Verständnis des gesamten Tractatus logico-philosophicus.
- Arbeit zitieren
- Christian Dörnte (Autor:in), 2017, Gedanke, Satz und Welt in Wittgensteins "Tractatus logico-philosophicus", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/367154