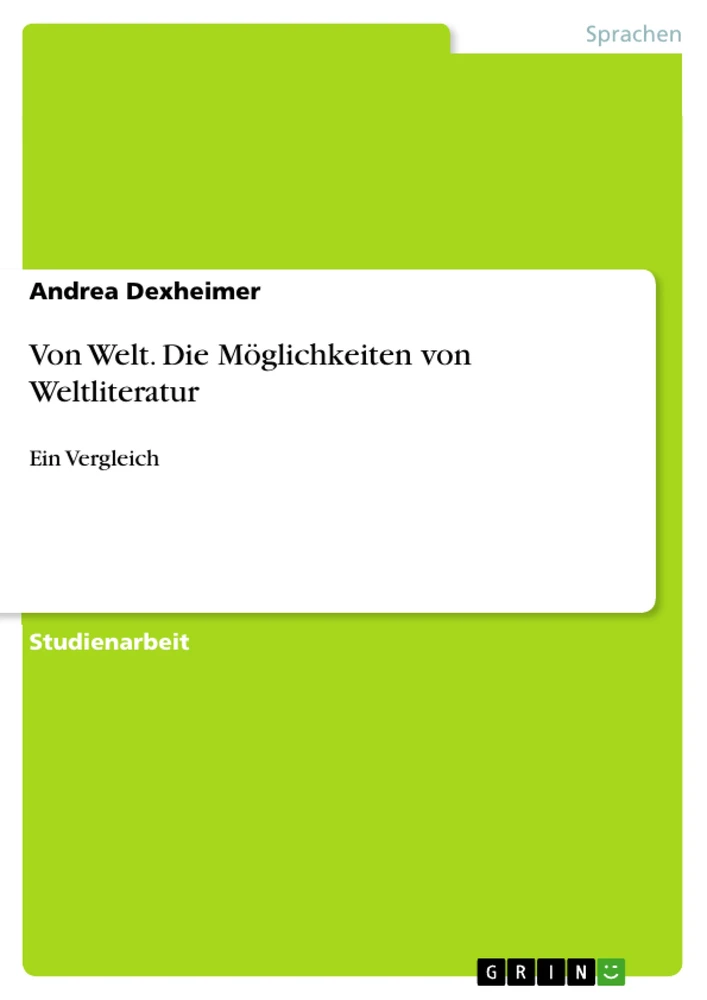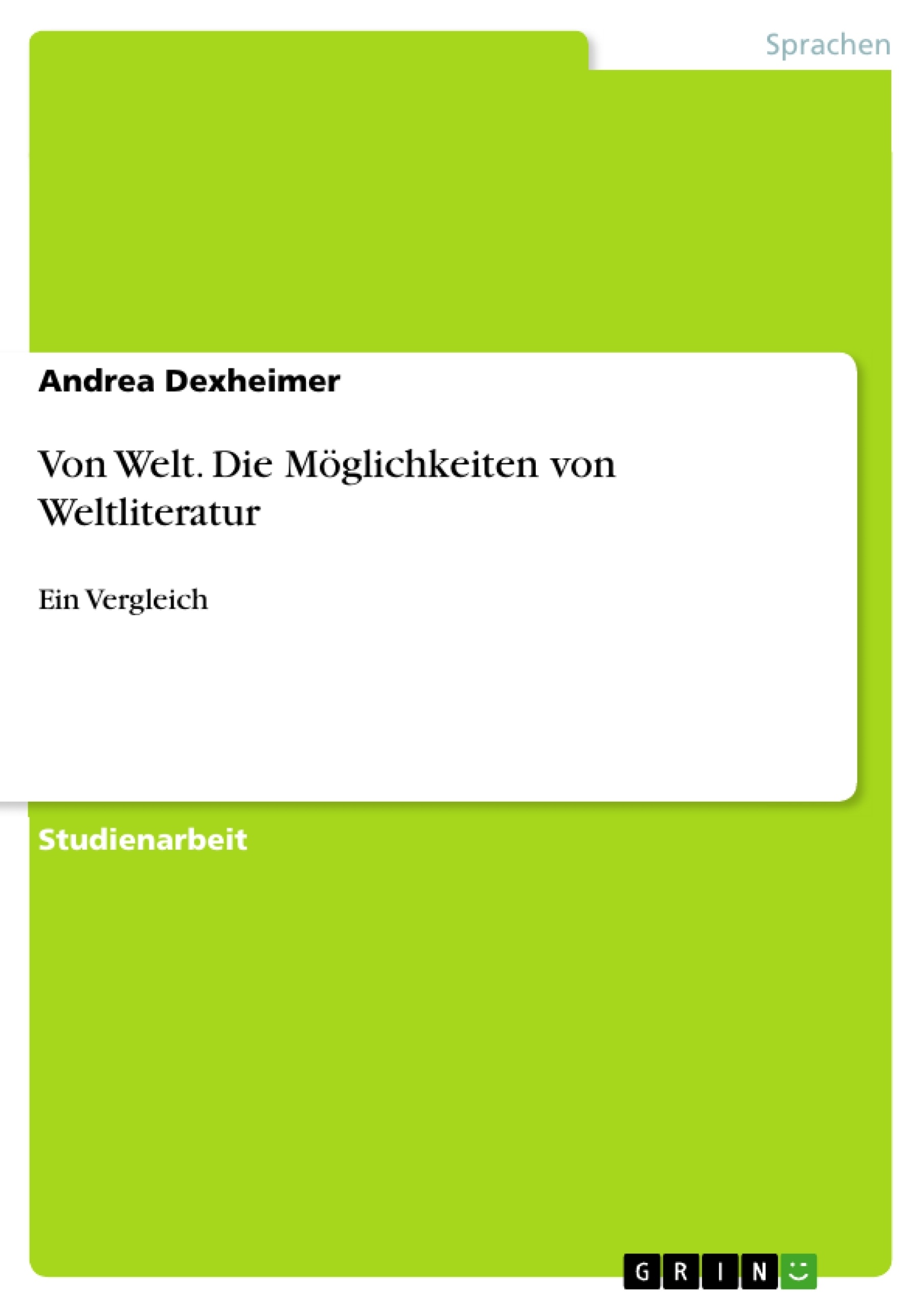Die Theoretiker der Biokosmisten postulieren die Unsterblichkeit als ein Recht der Individuen. Neben der Überschreitung der natürlichen Grenze des Todes wird den Mitgliedern der kommunistischen Gesellschaft ein Recht auf die Übertretung räumlicher Hindernisse zugestanden. Boris Groys resümiert die Tendenz der Bewegung, den ganzen kosmischen Raum zu besetzen und die totale Gesellschaft als interplanetar agierend zu sehen. In diesen Ansprüchen wird der Kunst ein zentraler Raum zugestanden, in dem sie als Ausdruck der fortschreitenden Technik in ihren Darstellungen den Konfrontationen mit natürlichen Grenzen vorangeht. In der menschlichen Kreativität komme zugleich der Ausdruck des Kosmos zum Tragen. Vor dem Hintergrund der russischen Biokosmisten zu Beginn des 20. Jahrhunderts beschrieben russische Schriftsteller und Philosophen wie Lev Trotzkij und Konstantin Ciolkovskij in utopischer Weise die Übertretung von räumlichen und zeitlichen Beschränkungen. In der Nachfolge Nikolaj Fedorows wurde ein neues Menschenbild in einem Weltverständnis entworfen, das natürliche Grenzen für den Menschen nicht mehr anrechnen kann, da der Mensch selbst nur als technisches Zusammenspiel seiner Biomasse gesehen wird. Dieser Ansatz soll dem Vergleich der Positionen und der Möglichkeit um Weltliteratur vorangestellt werden, da er eine Öffnung der Grenzen fokussiert, die sich auch und gerade über die Kunst ereignet. Die Biokosmisten wirkten aus einem universalistisch-globalen Anspruch heraus, der weder die zeitliche Grenze des Todes noch den räumlichen Horizont des Nationalstaates oder des Planeten als Beschränkung anerkannte.
Das utopische Moment wird gleichsam für das Programm einer Weltliteratur konstitutiv, wie es von Johann Wolfgang Goethe zu Beginn des 19. Jahrhunderts formuliert und fast 200 Jahre später von Gayatri Chakravorty Spivak thematisiert wird. In diesem Kontext nach der Definition einer Weltliteratur zu suchen, wird das Modell einer Kunst auf den Plan rufen, die unabhängig von ihrem Standpunkt auf dem Globus nach Möglichkeiten zur Horizontüberschreitung sucht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Am Punkt Null
- 2. Rückgriff auf die Wiege der „Weltliteratur“
- 2.1. Goethes Ausgangspunkte
- 2.2. Utopische Aspekte des Begriffes
- 2.3. Völkerverständigung
- 2.4. Weltliche Orientierung
- 3. Sprung in der Geschichte
- 4. Postkoloniale Aspekte
- 4.1. Definition neuer Räume
- 4.2. Literatur, Kultur und Lesetechnik
- 4.3. Natur und Fruchtbarkeit
- 4.4. Planetarity as a Discipline
- 5. Begriffsanalyse
- 5.1. Welt
- 5.2. Literatur
- 5.3. Synthese
- 6. Möglichkeit der „Welt-Literatur“
- 6.1. Sprache als Grenze und Möglichkeit
- 6.2. Höhenkamm, Trivialliteratur und Bücherverbrennung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den Begriff der Weltliteratur anhand eines Vergleichs verschiedener Perspektiven. Die Arbeit analysiert die utopischen Aspekte des Begriffs, seine postkolonialen Implikationen und die Rolle von Sprache und Kultur in seiner Definition. Ein zentraler Fokus liegt auf der Auseinandersetzung mit Goethes Konzept der Weltliteratur und dessen Relevanz im Kontext poststrukturalistischer Theorien.
- Utopische Aspekte des Weltliteratur-Begriffs
- Postkoloniale Perspektiven auf Weltliteratur
- Die Rolle der Sprache in der Definition von Weltliteratur
- Goethes Konzept der Weltliteratur und seine historische Entwicklung
- Der Einfluss poststrukturalistischer Theorien auf das Verständnis von Weltliteratur
Zusammenfassung der Kapitel
1. Am Punkt Null: Dieses Kapitel beginnt mit einer Auseinandersetzung mit Roland Barthes' "Le Degré zéro de l'écriture" und dessen Einfluss auf das Verständnis von Sprache und Literatur als Zeichensysteme. Barthes' Theorie, die Sprache als ein dynamisches, instabiles Sinngebilde beschreibt, dient als Ausgangspunkt für die Untersuchung der Weltliteratur als ein komplexes, vielschichtiges Konzept, das sich keiner starren Definition entzieht. Die Arbeit verdeutlicht, wie Barthes' Perspektive auf die Doppelfunktion des Signifikanten (leere Form und erfüllter Sinn) die Betrachtung des Begriffs "Weltliteratur" beeinflusst und eine flexible Annäherung ermöglicht. Das Kapitel etabliert ein kritisches Fundament, welches die folgenden Kapitel strukturiert, indem es eine Abkehr von starren Definitionen fordert und die Perspektiven Goethes und Spivaks als Ausgangspunkte einer differenzierten Analyse positioniert.
2. Rückgriff auf die Wiege der „Weltliteratur“: Dieses Kapitel befasst sich mit Goethes Konzept der Weltliteratur, indem es seine Entstehung im Kontext des sich wandelnden Zeit- und Raumempfindens analysiert und ihn als Gegenentwurf zum romantischen Nationalismus präsentiert. Es beleuchtet Goethes Vierstufenmodell der gesellschaftlichen und literarischen Entwicklung, wobei die höchste Stufe eine universale Epoche darstellt, die durch die Vereinigung aller gebildeten Kreise und den Austausch von Literaturen gekennzeichnet ist. Goethes Vision einer Weltliteratur als „geistiger Handelsverkehr“ zur Förderung der Kommunikation und des Verständnisses zwischen Nationen wird hier als zentrale These des Kapitels präsentiert und auf ihre utopischen und praktischen Implikationen untersucht. Goethes Fokus auf das „allgemein Menschliche“ als verbindendes Element wird zudem hervorgehoben.
2.1. Goethes Ausgangspunkte: Dieses Unterkapitel detailliert Goethes Äußerungen über Weltliteratur, die fünf Jahre vor seinem Tod zu akkumulieren begannen. Sein Verständnis von Weltliteratur als etwas „Höheres“ als die Nationaliteratur und als Mittel zur Konfliktlösung zwischen Nationen wird eingehend analysiert. Der Kontext des nachnapoleonischen Deutschlands und der Herausforderungen einer sich formierenden nationalen Identität werden als wichtige Rahmenbedingungen für Goethes Gedanken zur Weltliteratur hervorgehoben. Die Rolle der Literatur als Mittel zur Schaffung einer neuen nationalen Identität und als Instrument der internationalen Verständigung wird explizit untersucht.
4. Postkoloniale Aspekte: Dieses Kapitel thematisiert die postkolonialen Implikationen des Weltliteratur-Begriffs. Es untersucht, wie der Begriff neue Räume der Literatur definiert, die Rolle von Literatur, Kultur und Lesetechnik in diesem Kontext und die Bedeutung von Natur und Fruchtbarkeit innerhalb postkolonialer literarischer Diskussionen. Das Kapitel integriert die Perspektive der „Planetarity as a Discipline“, um die Herausforderungen und Möglichkeiten der Weltliteratur in einem globalisierten Kontext zu reflektieren. Die Diskussion umfasst somit nicht nur den Text, sondern auch die kritische Analyse des Begriffs selbst in seiner Anwendung auf diverse kulturelle Kontexte.
5. Begriffsanalyse: Dieses Kapitel analysiert den Begriff „Weltliteratur“ in seinen einzelnen Komponenten: „Welt“ und „Literatur“. Es erörtert die Schwierigkeiten einer umfassenden Definition und versucht eine Synthese der verschiedenen, im vorherigen Teil der Arbeit präsentierten Perspektiven zu erreichen. Durch die detaillierte Auseinandersetzung mit den einzelnen Begriffen wird eine tiefere Analyse der Gesamtbedeutung erreicht. Die Analyse dient als Brückenschlag zwischen den theoretischen Überlegungen und den implizierten Folgen der Definition von Weltliteratur.
Schlüsselwörter
Weltliteratur, Goethe, Postkolonialismus, Sprache, Kultur, Utopie, Barthes, Spivak, Begriffsanalyse, Nationalismus, Globalisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Weltliteratur": Eine Seminararbeit
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht den vielschichtigen Begriff der "Weltliteratur" aus verschiedenen Perspektiven. Sie analysiert dessen utopische Aspekte, postkoloniale Implikationen und die Rolle von Sprache und Kultur in seiner Definition. Ein Schwerpunkt liegt auf Goethes Konzept und dessen Relevanz im Kontext poststrukturalistischer Theorien.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt unter anderem die utopischen Aspekte des Weltliteratur-Begriffs, postkoloniale Perspektiven darauf, die Rolle der Sprache in seiner Definition, Goethes Konzept und dessen historische Entwicklung, sowie den Einfluss poststrukturalistischer Theorien auf das Verständnis von Weltliteratur.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Kapitel 1 ("Am Punkt Null") beginnt mit einer Auseinandersetzung mit Roland Barthes' Theorie der Sprache als Ausgangspunkt. Kapitel 2 ("Rückgriff auf die Wiege der „Weltliteratur“) befasst sich mit Goethes Konzept und dessen Kontext. Kapitel 4 ("Postkoloniale Aspekte") untersucht die postkolonialen Implikationen des Begriffs. Kapitel 5 ("Begriffsanalyse") analysiert die Komponenten "Welt" und "Literatur". Kapitel 6 ("Möglichkeit der „Welt-Literatur“) befasst sich mit Sprache als Grenze und Möglichkeit sowie mit Höhenkamm, Trivialliteratur und Bücherverbrennung. Zusätzlich gibt es Unterkapitel zu Goethes Ausgangspunkten, Definition neuer Räume, Literatur, Kultur und Lesetechnik, Natur und Fruchtbarkeit, sowie Planetarity as a Discipline.
Wie wird Goethes Konzept der Weltliteratur behandelt?
Goethes Konzept wird als zentraler Bezugspunkt analysiert, indem seine Entstehung im Kontext des sich wandelnden Zeit- und Raumempfindens untersucht und als Gegenentwurf zum romantischen Nationalismus präsentiert wird. Sein Vierstufenmodell der gesellschaftlichen und literarischen Entwicklung und seine Vision einer Weltliteratur als "geistiger Handelsverkehr" werden detailliert betrachtet.
Welche Rolle spielt der Postkolonialismus in der Arbeit?
Der Postkolonialismus spielt eine wichtige Rolle, indem die Arbeit die postkolonialen Implikationen des Weltliteratur-Begriffs untersucht und analysiert, wie der Begriff neue Räume der Literatur definiert und die Rolle von Literatur, Kultur und Lesetechnik in diesem Kontext betrachtet wird. Die Bedeutung von Natur und Fruchtbarkeit innerhalb postkolonialer literarischer Diskussionen wird ebenfalls thematisiert.
Welche Bedeutung hat die Sprache in der Arbeit?
Die Sprache spielt eine zentrale Rolle, da die Arbeit die Rolle der Sprache in der Definition von Weltliteratur untersucht und die Schwierigkeiten einer umfassenden Definition aufgrund sprachlicher und kultureller Unterschiede beleuchtet. Der Einfluss von Sprache als Grenze und Möglichkeit für die Weltliteratur wird diskutiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Weltliteratur, Goethe, Postkolonialismus, Sprache, Kultur, Utopie, Barthes, Spivak, Begriffsanalyse, Nationalismus, Globalisierung.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit verwendet einen vergleichenden Ansatz, indem sie verschiedene Perspektiven auf den Begriff der Weltliteratur gegenüberstellt und analysiert. Es werden sowohl theoretische als auch historische Ansätze verwendet, um den Begriff zu beleuchten.
- Citar trabajo
- Andrea Dexheimer (Autor), 2013, Von Welt. Die Möglichkeiten von Weltliteratur, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/367253