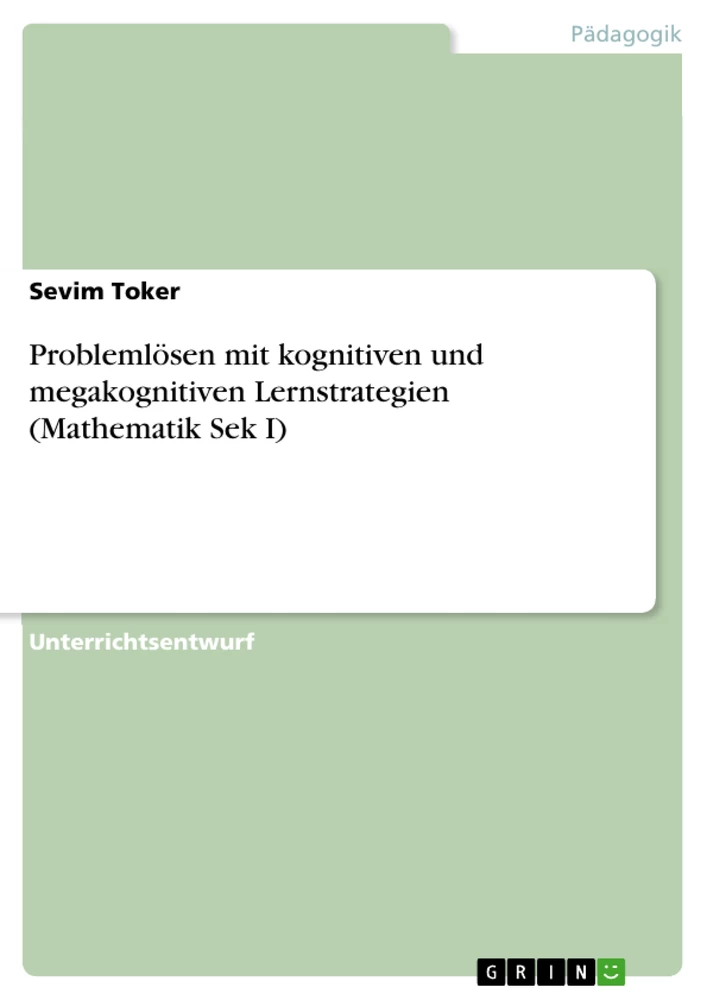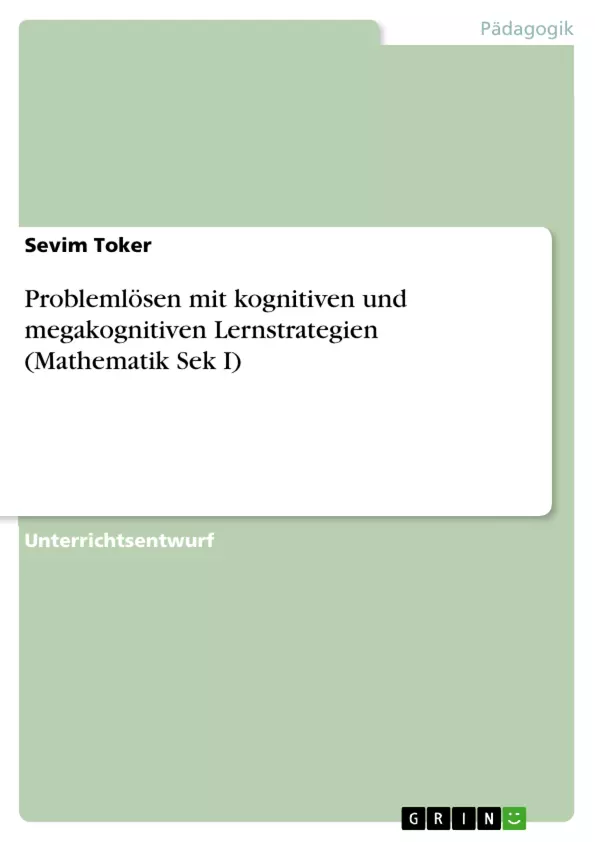Die Analyse und Optimierung von Lern- und Lehrprozessen im Unterricht steht im Mittelpunkt didaktischer und unterrichtlicher Überlegungen. Dabei spielt der Aufbau von Lernkompetenzen eine zentrale Rolle. Die Verwendung von Strategien des Lernens (und auch des Lehrens) gilt als wichtige Einflussgröße und wesentliche Bedingung, wenn es um erfolgreiches, insbesondere selbstgesteuertes Lernen geht. Die Lehr- und Lernforschung zeigt nämlich, dass gerade Lernstrategien von Lernenden eine herausragende Bedeutung für Lehr- und Lernprozesse in schulischen, aber auch außerschulischen Lernorten haben. Ein Heranwachsender, der weiß, wie er sich neues Wissen erschließen kann, lernt effektiver und eigenständiger, als diejenigen, die über diese Fähigkeiten nicht verfügen. Die besondere Stellung von Lernstrategien erschließt sich damit vor allem auch aus der zentralen Rolle, die „sie für den lebenslangen Prozess des Lernens und Weiterlernens... spielt“. So ist in der pädagogisch-psychologischen Forschung die Frage in den Vordergrund gerückt, wie Lernende befähigt werden können, ihr Lernen selbst in die Hand zu nehmen und Strategien zu entwickeln, die das Lernen und insbesondere Problemlöseprozesse stützen können.
Die gegenwärtige Schulpraxis zeigt jedoch, dass Lernstrategien und ihre Vermittlung einen untergeordneten Stellenwert einnehmen. So deuten die Ergebnisse der internationalen Vergleichsstudien PISA und TIMSS darauf hin, dass neben den fachspezifischen Kompetenzen unter anderem die Fähigkeiten zum selbstregulierten und problemlösenden Lernen deutscher Schüler unter dem internationalen Durchschnitt liegen. Wenn aber Lernstrategien die Rolle von Schlüsselkompetenz zukommt, so liegt die Aufgabe von Lehrkräften darin, ein fundiertes Wissen über grundlegende Kategorien von Lernstrategien sowie einen guten Überblick über mögliche Ausdifferenzierungen und Anwendungsmöglichkeiten dieser Strategien aufzubauen, sodass Lernende am Ende ihrer Schulzeit über ein breites und gut trainiertes Repertoire von Lernstrategien verfügen.
Hier setzt die vorliegende Theorie-Praxis-Arbeit an. Das Ziel ist, ausgehend von konzeptuellen Überlegungen anhand einer Unterrichtsreihe mit Aufgabenbeispielen und Materialien ein Problemlösetraining zu entwickeln, dass praktische Möglichkeiten zur Förderung von kognitiven und metakognitiven Lernstrategien für das Problemlösen im Mathematikunterricht aufzeigt.
Inhaltsverzeichnis
- BEDEUTUNG DER THEMATIK UND DARSTELLUNG DER ZIELVORSTELLUNG
- THEORETISCHE GRUNDLAGEN
- DER LERNBEGRIFF
- KOGNITIONSPSYCHOLOGISCHE KATEGORISIERUNG VON LERNSTRATEGIEN
- LERNSTRATEGIEN BEIM MATHEMATISCHEN PROBLEMLÖSEN
- DARSTELLUNG DES FORSCHUNGSSTANDES
- THEORIE-PRAXIS-TRANSFER
- DIREKTE VS. INDIREKTE FÖRDERUNG DES EINSATZES VON LERNSTRATEGIEN
- UNTERRICHTSKONZEPT ZUM PROBLEMLÖSENLERNEN
- ZIELE DES KONZEPTS ZUM PROBLEMLÖSENLERNEN
- UNTERRICHTSREIHE ZUM PROBLEMLÖSETRAINING MIT AUFGABEN UND MATERIALIEN
- DISKUSSION UND AUSBLICK
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Theorie-Praxis-Arbeit verfolgt das Ziel, ein Problemlösetraining zu entwickeln, das die Förderung von kognitiven und metakognitiven Lernstrategien im Mathematikunterricht der Sek I unterstützt. Dabei soll anhand einer Unterrichtsreihe mit Aufgabenbeispielen und Materialien ein praktischer Einblick in die Umsetzungsmöglichkeiten gegeben werden.
- Bedeutung von Lernstrategien für erfolgreiches, selbstgesteuertes Lernen
- Kognitionspsychologische Kategorisierung von Lernstrategien
- Anwendungsbeispiele von Lernstrategien im Mathematikunterricht
- Entwicklung und Umsetzung einer Unterrichtsreihe zum Problemlösetraining
- Diskussion der Chancen und Grenzen des entwickelten Lernstrategietrainings
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Bedeutung von Lernstrategien und die Zielsetzung der Arbeit, ein Problemlösetraining zu entwickeln. Es wird auf die zentrale Rolle von Lernstrategien für erfolgreiches Lernen und die Notwendigkeit ihrer Förderung in der Schulpraxis hingewiesen. Die Ergebnisse internationaler Vergleichsstudien wie PISA und TIMSS werden herangezogen, um die Relevanz von Lernstrategien zu unterstreichen.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit den theoretischen Grundlagen der Thematik. Es werden verschiedene Definitionen des Lernbegriffs vorgestellt und der Schwerpunkt auf die kognitionspsychologische Perspektive gelegt. Der Begriff der Lernstrategie wird aus verschiedenen theoretischen Denkrichtungen beleuchtet und kategorisiert. Ein Überblick über den aktuellen Stand der Lernstrategien-Forschung rundet dieses Kapitel ab.
Das dritte Kapitel fokussiert auf den Transfer der Theorie in die Praxis. Es werden verschiedene Ansätze zur Förderung von Lernstrategien im Mathematikunterricht vorgestellt, wobei die direkte und indirekte Förderung von Lernstrategien im Mittelpunkt stehen. Das Kapitel beinhaltet die Darstellung eines Unterrichtskonzepts zum Problemlösenlernen und die Definition der Ziele dieses Konzepts. Außerdem wird eine Unterrichtsreihe zum Problemlösetraining mit Aufgabenbeispielen und Materialien vorgestellt.
Schlüsselwörter
Lernstrategien, kognitiv, metakognitiv, Problemlösen, Mathematikunterricht, Sek I, Unterrichtsreihe, Aufgabenbeispiele, Materialien, Theorie-Praxis-Transfer, Forschungsstand, PISA, TIMSS, selbstgesteuertes Lernen, Problemlösekompetenz
Häufig gestellte Fragen
Was sind kognitive Lernstrategien im Mathematikunterricht?
Das sind Strategien zur unmittelbaren Informationsverarbeitung, wie das Skizzieren einer Aufgabe, das Zusammenfassen von Informationen oder das Anwenden von Formeln.
Was versteht man unter metakognitiven Lernstrategien?
Metakognitive Strategien dienen der Planung, Überwachung und Kontrolle des eigenen Lernprozesses (z. B. „Habe ich die Aufgabe richtig verstanden?“, „Ist mein Lösungsweg sinnvoll?“).
Warum ist Problemlösenlernen in der Sekundarstufe I so wichtig?
Es fördert die Selbstständigkeit der Schüler. Wer Strategien kennt, kann sich neues Wissen effektiver erschließen, was eine Schlüsselkompetenz für lebenslanges Lernen ist.
Was kritisieren Studien wie PISA und TIMSS am deutschen Unterricht?
Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass deutsche Schüler im internationalen Vergleich Defizite beim selbstregulierten und problemlösenden Lernen haben.
Was ist der Unterschied zwischen direkter und indirekter Förderung von Strategien?
Direkte Förderung bedeutet, Strategien explizit zu benennen und zu trainieren. Indirekte Förderung schafft Lernumgebungen, die den Einsatz von Strategien implizit erfordern.
Welche Materialien bietet das entwickelte Unterrichtskonzept?
Die Arbeit enthält Aufgabenbeispiele und Materialien für ein Problemlösetraining, das speziell auf die Förderung kognitiver und metakognitiver Prozesse ausgerichtet ist.
- Quote paper
- Sevim Toker (Author), 2017, Problemlösen mit kognitiven und megakognitiven Lernstrategien (Mathematik Sek I), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/367266