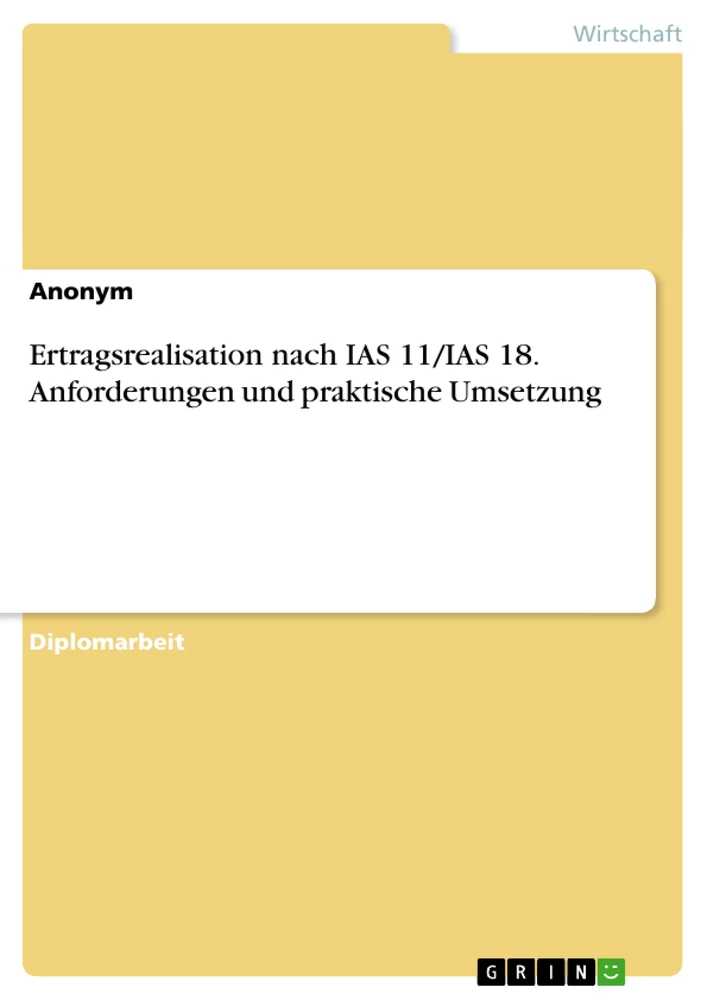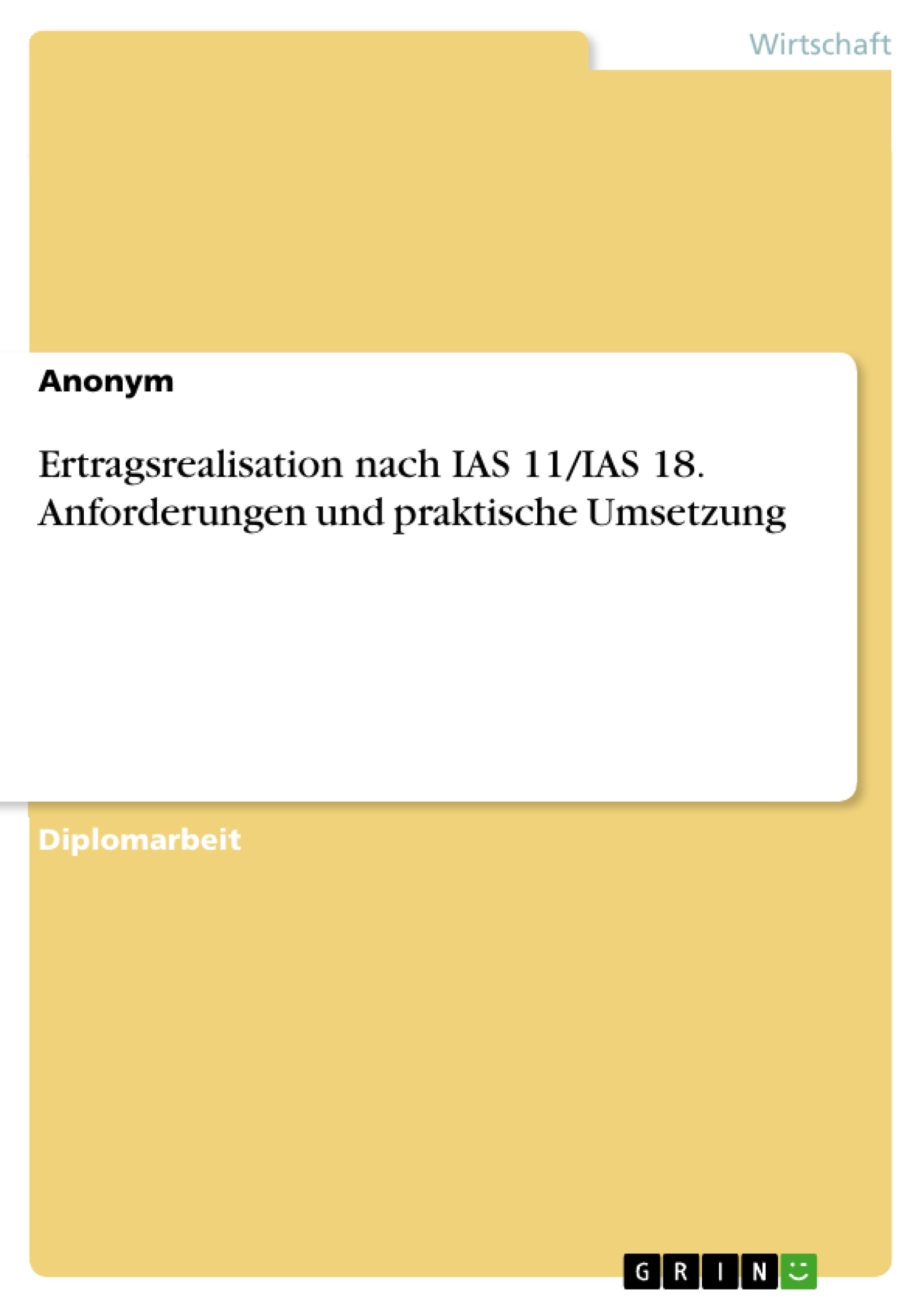Die IFRS-Rechnungslegung wird in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen. Ein zentrales Element in diesem Zusammenhang ist die EU-Verordnung, die kapitalmarktorientierte Unternehmen ab 2005 bzw. 2007 zur Aufstellung eines Konzernabschlusses nach internationalen Normen verpflichtet. Aber auch die aus der Verordnung resultierenden Mitgliedstaatenwahlrechte für Konzernab-schlüsse nicht börsennotierter Unternehmen sowie die immer lauter werdende Diskussion über die Anwendbarkeit der Regelungen des IASB für mittelstän-dische Unternehmen werden die Verbreitung von IFRS-Abschlüssen erhöhen. Zumindest mittel- bis langfristig wird es also sukzessive zu einer weitgehenden Ablösung der nationalen Rechnungslegungsvorschriften kommen. Von den Anwendern der Vorschriften erfordert diese Entwicklung in verschiedenen Bereichen ein völliges Umdenken, da die internationalen Vorschriften zum Teil erheblich von den bisher national gültigen Regelungen divergieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Vorgehensweise und Ziel der Arbeit
- 2 Grundlegende Vorbemerkungen zur Ertragsrealisation nach IFRS und HGB
- 3 Ertragsrealisation im Zusammenhang mit Verkaufsvorgängen
- 3.1 Generelle Voraussetzungen für die Ertragsrealisation bei Kaufverträgen nach IFRS
- 3.2 Generelle Voraussetzungen für die Ertragsrealisation bei Kaufverträgen nach HGB
- 3.3 Berücksichtigung von besonderen Vertragsgestaltungen
- 3.3.1 Kommissionsgeschäfte
- 3.3.2 Bill-and-hold sales
- 3.3.3 Lay-away sales
- 3.3.4 Buyback agreements
- 3.3.5 Vereinbarung von Rücktritts- und Rückgaberechten
- 3.3.6 Lieferung unter Eigentumsvorbehalt
- 3.4 Berücksichtigung von bilanziellen Sonderfällen
- 3.4.1 Ausstehende Nebenleistungen und Mehrkomponentenverträge
- 3.4.2 Annahmeverzug
- 3.5 Bewertung der Umsatzerlöse aus Kaufverträgen
- 3.5.1 Generelle Bewertungsvorschrift
- 3.5.2 Tauschgeschäfte
- 3.5.3 Berücksichtigung von Abschreibungen auf Forderungen
- 3.6 Angabepflichten im Zusammenhang mit Kaufverträgen
- 3.7 Zwischenergebnis
- 4 Ertragsrealisation bei langfristigen Auftragsfertigungen und Dienstleistungen
- 4.1 Charakterisierung der langfristigen Auftragsfertigungen
- 4.1.1 Begriff der langfristigen Auftragsfertigungen und Dienstleistungen
- 4.1.2 Risiken langfristiger Auftragsfertigungen und Dienstleistungen
- 4.1.3 Alternative Vertragsgestaltungen
- 4.2 Behandlung von langfristigen Auftragsfertigungen und Dienstleistungen nach IFRS
- 4.2.1 POC-Methode als Regelfall
- 4.2.1.1 Wesen und Anwendungsvoraussetzungen der POC-Methode
- 4.2.1.2 Zusammenfassung und Segmentierung von Aufträgen
- 4.2.1.3 Ausweis in Bilanz und GuV
- 4.2.1.4 Probleme der Ermittlung der Auftragserlöse
- 4.2.1.5 Probleme der Ermittlung der Auftragskosten
- 4.2.1.6 Probleme der Ermittlung des Fertigstellungsgrads
- 4.2.1.7 Berücksichtigung veränderter Schätzungen
- 4.2.2 Zero-profit-margin-method und Verlustantizipation
- 4.2.3 Angabepflichten
- 4.2.1 POC-Methode als Regelfall
- 4.3 Behandlung von langfristigen Auftragsfertigungen und Dienstleistungen nach HGB
- 4.3.1 CC-Methode als Regelfall
- 4.3.2 Ausweis in Bilanz, GuV und Anhang
- 4.3.3 Teilgewinnrealisierung durch Teilabnahme
- 4.3.4 Aktivierung von Selbstkosten
- 4.3.5 Anwendung der POC-Methode nach HGB
- 4.4 Kritische Würdigung der POC und CC-Methode
- 4.5 Zwischenergebnis
- 4.1 Charakterisierung der langfristigen Auftragsfertigungen
- 5 Ertragsrealisation im Zusammenhang mit Nutzungsüberlassungsverträgen
- 5.1 Zinserträge
- 5.2 Nutzungsentgelte
- 5.3 Dividendenerträge
- 5.4 Nichtrückerstattungsfähige Vorrauszahlungen
- 5.5 Angabepflichten im Zusammenhang mit Nutzungsüberlassungsverträgen
- 5.6 Zwischenergebnis
- 6 Analyse der Bilanzierungspraxis deutscher Unternehmen
- 6.1 Ziel der Analyse
- 6.2 Vorgehensweise
- 6.3 Analyseergebnisse
- 6.3.1 Übergreifende Bilanzierungsfragen
- 6.3.1.1 Aufgliederung von Erlösbestandteilen
- 6.3.1.2 Angaben zu Tauschgeschäften
- 6.3.1.3 Berücksichtigung von Eventualverbindlichkeiten und Eventualforderungen
- 6.3.1.4 Bewertung der Umsatzerlöse
- 6.3.2 Behandlung von Verkaufsvorgängen
- 6.3.2.1 Generelle Angaben zur Ertragsrealisation
- 6.3.2.2 Besondere Kaufvertragsgestaltungen
- 6.3.2.3 Berücksichtigung von bilanziellen Sonderfällen
- 6.3.3 Behandlung von Auftragsfertigungen und Dienstleistungen
- 6.3.3.1 Anwendung der POC-Methode
- 6.3.3.2 Informationen über Anwendungsvoraussetzungen
- 6.3.3.3 Ausweis in Bilanz und GuV
- 6.3.3.4 Ermittlung des Fertigstellungsgrads
- 6.3.3.5 Anhangangaben
- 6.3.3.6 Bedeutung der Teilgewinnrealisierung
- 6.3.3.7 Realisierung von konventionellen Dienstleistungserträgen
- 6.3.4 Behandlung von Nutzungsüberlassungsverträgen
- 6.3.4.1 Zinserträge
- 6.3.4.2 Nutzungsentgelte
- 6.3.4.3 Dividenden
- 6.4 Zusammenfassung der Analyseergebnisse
- 6.3.1 Übergreifende Bilanzierungsfragen
- 7 Abschließende Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Ertragsrealisation nach IAS 11/IAS 18 und deren praktische Umsetzung. Ziel ist es, die Anforderungen der IFRS und des HGB im Kontext der Ertragsrealisation zu beleuchten und die Unterschiede aufzuzeigen. Die Arbeit analysiert die Bilanzierungspraxis deutscher Unternehmen.
- Anforderungen der IFRS und des HGB an die Ertragsrealisation
- Praktische Umsetzung der Ertragsrealisation in verschiedenen Geschäftsmodellen
- Analyse der Bilanzierungspraxis deutscher Unternehmen
- Vergleich der POC- und CC-Methode bei langfristigen Aufträgen
- Berücksichtigung besonderer Vertragsgestaltungen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Diplomarbeit ein, beschreibt die Problemstellung der Ertragsrealisation nach IAS 11/IAS 18 und skizziert die Vorgehensweise sowie die Ziele der Arbeit. Es legt den Rahmen für die folgenden Kapitel fest und formuliert die Forschungsfrage.
2 Grundlegende Vorbemerkungen zur Ertragsrealisation nach IFRS und HGB: Dieses Kapitel legt die grundlegenden Unterschiede zwischen den Rechnungslegungsstandards IFRS und HGB im Bereich der Ertragsrealisation dar. Es dient als Basis für das Verständnis der folgenden Kapitel, in denen konkrete Beispiele und Fallstudien behandelt werden. Die verschiedenen Prinzipien und Methoden werden einander gegenübergestellt, um die Unterschiede in der Anwendung und den resultierenden Auswirkungen auf die Bilanzierung transparent zu machen.
3 Ertragsrealisation im Zusammenhang mit Verkaufsvorgängen: Dieses Kapitel behandelt die Ertragsrealisation bei Kaufverträgen unter Berücksichtigung von IFRS und HGB. Es analysiert generelle Voraussetzungen, besondere Vertragsgestaltungen (z.B. Kommissionsgeschäfte, Bill-and-hold sales), bilanziellen Sonderfälle (z.B. ausstehende Nebenleistungen, Annahmeverzug) und die Bewertung der Umsatzerlöse. Der Fokus liegt auf der detaillierten Beschreibung der jeweiligen Vorschriften und der Herausarbeitung von Unterschieden und Gemeinsamkeiten der beiden Rechnungslegungsstandards.
4 Ertragsrealisation bei langfristigen Auftragsfertigungen und Dienstleistungen: Dieses Kapitel befasst sich mit der Ertragsrealisation bei langfristigen Projekten. Es beschreibt die Charakteristika solcher Aufträge, die Risiken und alternative Vertragsgestaltungen. Die Schwerpunkte liegen auf der POC-Methode (nach IFRS) und der CC-Methode (nach HGB), einschließlich ihrer Anwendung, Probleme bei der Ermittlung von Auftragserlösen und -kosten sowie der Bestimmung des Fertigstellungsgrads. Ein Vergleich beider Methoden und deren kritische Würdigung schließen das Kapitel ab.
5 Ertragsrealisation im Zusammenhang mit Nutzungsüberlassungsverträgen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Ertragsrealisation bei der Überlassung von Vermögenswerten gegen Entgelt. Es beleuchtet verschiedene Arten von Erträgen, wie Zinserträge, Nutzungsentgelte und Dividendenerträge, sowie die Behandlung von nichtrückerstattungsfähigen Vorauszahlungen. Die Kapitel erläutert die anzuwendenden Vorschriften und die damit verbundenen Angabepflichten nach IFRS und HGB.
6 Analyse der Bilanzierungspraxis deutscher Unternehmen: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse einer empirischen Analyse der Bilanzierungspraxis deutscher Unternehmen hinsichtlich der Ertragsrealisation. Es untersucht die Anwendung der IFRS und HGB in der Praxis und beleuchtet Abweichungen von den theoretischen Vorgaben. Die Analyse deckt verschiedene Bereiche ab, wie die Behandlung von Verkaufsvorgängen, langfristigen Aufträgen und Nutzungsüberlassungsverträgen.
Schlüsselwörter
Ertragsrealisation, IAS 11, IAS 18, IFRS, HGB, Kaufverträge, langfristige Auftragsfertigungen, Dienstleistungen, Nutzungsüberlassungsverträge, POC-Methode, CC-Methode, Bilanzierungspraxis, deutsche Unternehmen, Rechnungslegung.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Ertragsrealisation nach IFRS und HGB
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Ertragsrealisation nach den International Accounting Standards (IFRS), insbesondere IAS 11 und IAS 18, und vergleicht diese mit den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB). Sie analysiert die praktische Umsetzung in der Bilanzierungspraxis deutscher Unternehmen und beleuchtet die Unterschiede in den Anforderungen und der Anwendung beider Rechnungslegungsstandards.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Ertragsrealisation in verschiedenen Kontexten: Kaufverträge (mit Berücksichtigung besonderer Vertragsgestaltungen wie Kommissionsgeschäfte oder Bill-and-hold-Verkäufe), langfristige Auftragsfertigungen und Dienstleistungen (mit Fokus auf die POC- und CC-Methode), sowie Nutzungsüberlassungsverträge (z.B. Zinserträge, Nutzungsentgelte). Ein weiterer Schwerpunkt ist die Analyse der Bilanzierungspraxis deutscher Unternehmen.
Welche Methoden werden verwendet?
Die Arbeit kombiniert deskriptive und analytische Methoden. Sie beschreibt die theoretischen Anforderungen der IFRS und des HGB zur Ertragsrealisation und analysiert die Bilanzierungspraxis deutscher Unternehmen anhand empirischer Daten. Der Vergleich der POC- und CC-Methode bei langfristigen Aufträgen ist ein zentraler Bestandteil der Analyse.
Was sind die wichtigsten Unterschiede zwischen der Ertragsrealisation nach IFRS und HGB?
Die Arbeit deckt die grundlegenden Unterschiede zwischen IFRS und HGB in Bezug auf die Ertragsrealisation auf. Dies umfasst unterschiedliche Prinzipien der Ertragsrealisierung, verschiedene Methoden zur Bewertung von Umsatzerlösen und unterschiedliche Anforderungen an die Bilanzierung in verschiedenen Geschäftsmodellen. Konkrete Beispiele und Fallstudien verdeutlichen diese Unterschiede.
Welche Rolle spielen die POC- und CC-Methode?
Die POC-Methode (Percentage of Completion) wird im IFRS-Kontext bei langfristigen Aufträgen angewendet, während die CC-Methode (Completed Contract) im HGB-Kontext üblicher ist. Die Arbeit vergleicht beide Methoden detailliert, analysiert deren Anwendungsprobleme (z.B. Ermittlung des Fertigstellungsgrads, Auftragserlöse und -kosten) und bewertet deren Vor- und Nachteile kritisch.
Welche besonderen Vertragsgestaltungen werden berücksichtigt?
Die Arbeit analysiert verschiedene besondere Vertragsgestaltungen, die die Ertragsrealisation beeinflussen, wie beispielsweise Kommissionsgeschäfte, Bill-and-hold sales, Lay-away sales, Buyback agreements, Vereinbarungen von Rücktritts- und Rückgaberechten sowie Lieferungen unter Eigentumsvorbehalt. Die Auswirkungen dieser Gestaltungen auf die Bilanzierung nach IFRS und HGB werden erläutert.
Wie wird die Bilanzierungspraxis deutscher Unternehmen untersucht?
Die Arbeit enthält eine empirische Analyse der Bilanzierungspraxis deutscher Unternehmen. Diese Analyse untersucht, wie deutsche Unternehmen die Anforderungen der IFRS und des HGB in der Praxis umsetzen und welche Abweichungen von den theoretischen Vorgaben bestehen. Die Ergebnisse werden in Bezug auf verschiedene Bereiche der Ertragsrealisation dargestellt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Grundlegende Vorbemerkungen zur Ertragsrealisation, Ertragsrealisation bei Verkaufsvorgängen, Ertragsrealisation bei langfristigen Aufträgen, Ertragsrealisation bei Nutzungsüberlassungsverträgen, Analyse der Bilanzierungspraxis deutscher Unternehmen und abschließende Betrachtung. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Ertragsrealisation und baut aufeinander auf.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ertragsrealisation, IAS 11, IAS 18, IFRS, HGB, Kaufverträge, langfristige Auftragsfertigungen, Dienstleistungen, Nutzungsüberlassungsverträge, POC-Methode, CC-Methode, Bilanzierungspraxis, deutsche Unternehmen, Rechnungslegung.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2004, Ertragsrealisation nach IAS 11/IAS 18. Anforderungen und praktische Umsetzung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36730