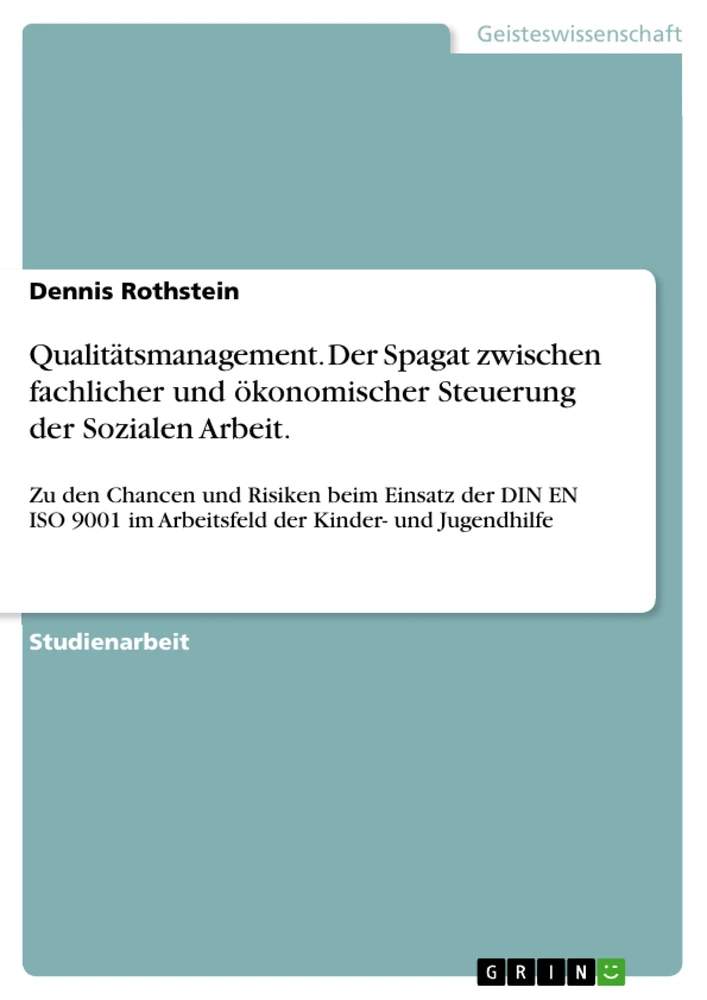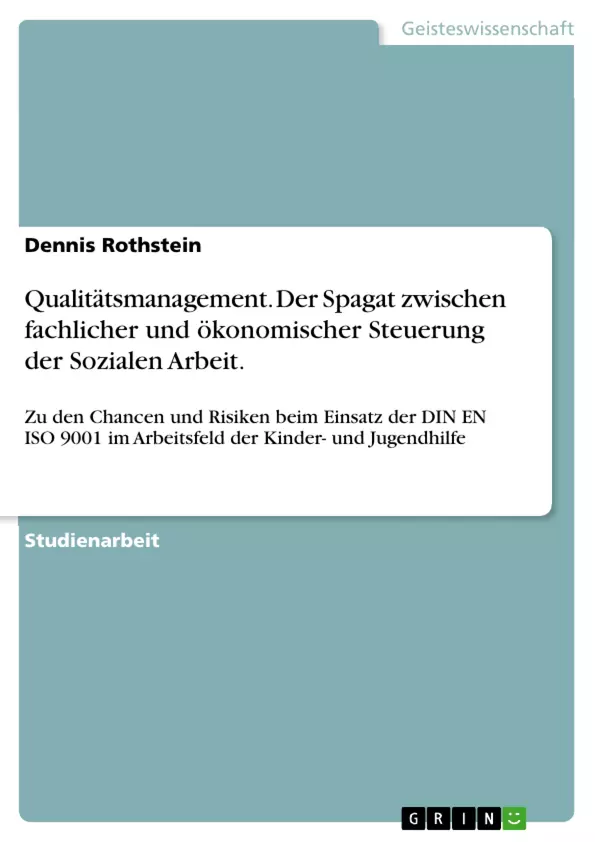Diese Ausarbeitung widmet sich dem Qualitätsmanagement (QM) in der Kinder- und Jugendhilfe. Für diesen Bereich der Sozialen Arbeit werden Chancen und Risiken bzw. Grenzen mit Blick auf das Qualitätsmanagement-Modell DIN EN ISO 9001 dargestellt und diskutiert. Dabei werden sowohl Möglichkeiten der ökonomischen, als auch der fachlichen Steuerung betrachtet.
Zunächst wird die Entwicklung der Qualitätsdebatte in den vergangenen Jahren in groben Schritten angesprochen. Die fachliche Ausrichtung erfolgt auf das Feld der Kinder- und Jugendhilfe. Hier werden bereits grundlegende Schwierigkeiten und Reibungspunkte angesprochen.
Im zweiten Schritt wird dann der Fokus auf das QM-System nach DIN EN ISO 9001 gerichtet. Dessen grundlegende Kriterien und die Steuerungslogik werden dargestellt und mit anderen Modellen verglichen. Dabei geht es jedoch nicht um eine detaillierte Vorstellung und Beschreibung des DIN EN ISO 9001 Modells.
Auf Grundlage der ersten beiden Kapitel werden dann Steuerungsmöglichkeiten aus ökonomischer und fachlicher Sicht hinterfragt, die sich aus der Anwendung des DIN EN ISO 9001 Modells ergeben können. Abschließend werden die wichtigsten Ergebnisse der Ausarbeitung in einem kurzen Fazit zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hintergründe der Qualitätsdebatte im Rechtskreis SGB VIII
- Die DIN EN ISO 9001 im Vergleich zu anderen QM-Modellen
- Fachliche und ökonomische Steuerungsmöglichkeiten auf Grundlage der DIN EN ISO 9001
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung befasst sich mit dem Qualitätsmanagement (QM) in der Kinder- und Jugendhilfe. Sie analysiert Chancen und Risiken sowie Grenzen des Qualitätsmanagement-Modells DIN EN ISO 9001 in diesem Bereich der Sozialen Arbeit. Dabei stehen sowohl die Möglichkeiten der ökonomischen als auch der fachlichen Steuerung im Fokus.
- Entwicklung der Qualitätsdebatte in der Sozialen Arbeit
- Vorstellung des QM-Systems DIN EN ISO 9001
- Vergleich von DIN EN ISO 9001 mit anderen QM-Modellen
- Steuerungsmöglichkeiten aus ökonomischer und fachlicher Sicht
- Bewertung der Ergebnisse und Zusammenfassung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt die Thematik des Qualitätsmanagements in der Kinder- und Jugendhilfe vor und verdeutlicht die Bedeutung des DIN EN ISO 9001 Modells in diesem Kontext. Sie gibt einen Überblick über die Struktur und den Aufbau der Ausarbeitung.
- Hintergründe der Qualitätsdebatte im Rechtskreis SGB VIII: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung des Qualitätsbegriffs in der Sozialen Arbeit, insbesondere im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe nach SGB VIII. Es wird die Bedeutung der Professionalität und die Herausforderungen im Kontext der Ökonomisierung und des New Public Management (NPM) diskutiert.
- Die DIN EN ISO 9001 im Vergleich zu anderen QM-Modellen: Dieses Kapitel befasst sich mit den grundlegenden Kriterien und der Steuerungslogik des QM-Systems DIN EN ISO 9001. Es erfolgt ein Vergleich mit anderen QM-Modellen, wobei die spezifischen Besonderheiten des DIN EN ISO 9001 Modells im Fokus stehen.
- Fachliche und ökonomische Steuerungsmöglichkeiten auf Grundlage der DIN EN ISO 9001: Dieses Kapitel untersucht die Steuerungsmöglichkeiten, die sich aus der Anwendung des DIN EN ISO 9001 Modells ergeben. Es werden sowohl ökonomische als auch fachliche Perspektiven betrachtet und die potenziellen Auswirkungen auf die Praxis der Kinder- und Jugendhilfe diskutiert.
Schlüsselwörter
Qualitätsmanagement, Kinder- und Jugendhilfe, DIN EN ISO 9001, SGB VIII, New Public Management (NPM), Professionalität, Ökonomisierung, Steuerungsmöglichkeiten, Fachliche und ökonomische Steuerung.
Häufig gestellte Fragen zum Qualitätsmanagement in der Sozialen Arbeit
Was ist das Ziel von Qualitätsmanagement (QM) in der Kinder- und Jugendhilfe?
QM soll die Professionalität sichern, Prozesse optimieren und sowohl eine fachliche als auch eine ökonomische Steuerung der sozialen Leistungen ermöglichen.
Wie funktioniert das Modell DIN EN ISO 9001 in der Sozialen Arbeit?
Es handelt sich um ein prozessorientiertes Modell, das Standards für Arbeitsabläufe definiert, um die Kundenzufriedenheit und die Qualität der Dienstleistung stetig zu verbessern.
Gibt es Risiken bei der Anwendung von QM-Modellen aus der Wirtschaft?
Kritiker befürchten eine zu starke Ökonomisierung ("New Public Management"), bei der fachliche Standards hinter wirtschaftlichen Kennzahlen zurückstehen könnten.
Welche Rolle spielt das SGB VIII für das Qualitätsmanagement?
Das SGB VIII verpflichtet Träger der Jugendhilfe zur Qualitätsentwicklung und -sicherung, um den Schutz und die Förderung von Kindern und Jugendlichen zu garantieren.
Wie unterscheiden sich fachliche und ökonomische Steuerung?
Fachliche Steuerung fokussiert auf die pädagogische Wirkung und Methodik, während ökonomische Steuerung auf Effizienz, Kostenkontrolle und Ressourcenmanagement abzielt.
Warum ist die Qualitätsdebatte in der Sozialen Arbeit aktuell so präsent?
Durch knapper werdende öffentliche Mittel und steigende Anforderungen an die Nachweisbarkeit von Erfolgen ist der Druck zur Einführung systematischer QM-Systeme gewachsen.
- Citar trabajo
- Dennis Rothstein (Autor), 2015, Qualitätsmanagement. Der Spagat zwischen fachlicher und ökonomischer Steuerung der Sozialen Arbeit., Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/367435