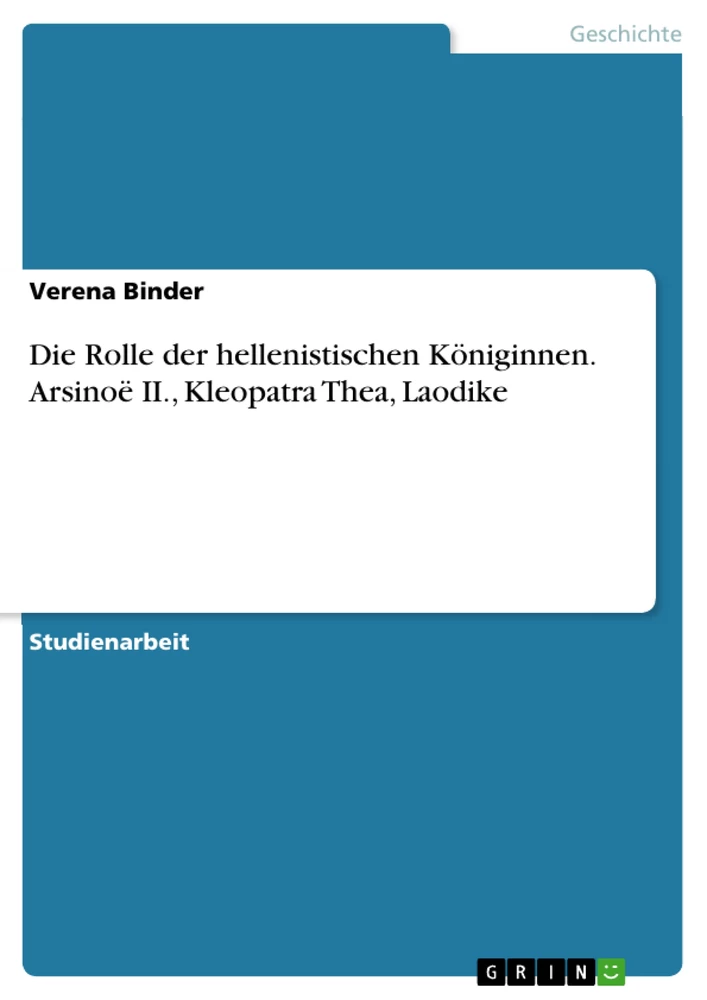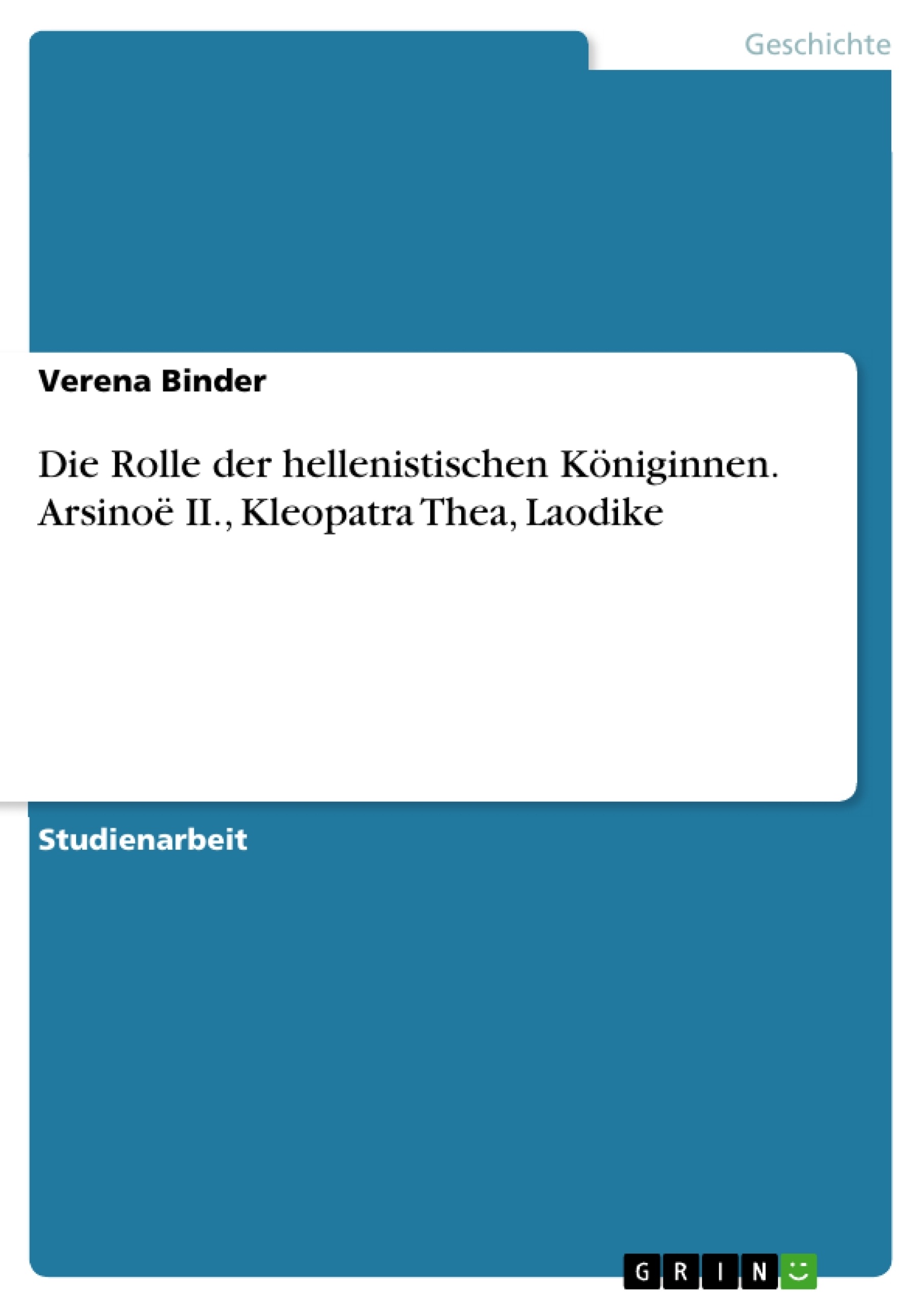In dieser Arbeit soll die tatsächlich ausgeübte Macht von Königinnen in hellenistischer Zeit anhand von konkreten Beispielen analysiert werden. Den ersten Teil der Untersuchung nimmt die Ptolemäerin Arsinoë II. ein, die neben Alexanders Mutter Olympias und Kleopatra VII. zu den bedeutendsten Herrscherinnen im Hellenismus zählt. Diese Arbeit beschränkt sich auf Arsinoës II. Handlungsspielraum während ihrer Ehe mit Ptolemaios II. Denn sie wurde in der Forschung bereits breit rezipiert und deshalb sind viele Details ihrer Lebensumstände bekannt.
Ein wichtiger Literaturtitel für das Kapitel zu Arsinoë II. ist die Publikation "Das hellenistische Königspaar in der medialen Repräsentation. Ptolemaios II. und Arsinoë II." von Sabine Müller. Neben einer Analyse der Darstellung von Arsinoë II. auf Münzen, gibt Müller die unterschiedlichen Auffassungen in der Forschung über die tatsächliche Macht der Königin wieder. Außerdem ist der Literaturtitel "Frauen in der Antike. Weibliche Lebenswelten von Sappho bis Theodora" von Elke Hartmann für diese Arbeit besonders relevant. Hartmann analysiert die Repräsentation der Arsinoë II. und geht dabei kritisch auf die Aussagekraft der literarischen Quellen ein.
Trotz der Zweifel an der Aussagekraft literarischer Quellen spielen diese, neben Münzbildern, auch für die Betrachtung der Arsinoë II. in dieser Arbeit eine wichtige Rolle. Dabei wird das Fragment Nummer 181 aus dem Werk des Hofdichters Kallimachos Verwendung finden, das die Vergöttlichung der Arsinoë II. beschreibt. Zitiert wird nach der zweisprachigen Ausgabe von Markus Asper. Außerdem stützt sich diese Arbeit auf Theokrits XVII. Idyll, das Lobgedicht auf Ptolemaios II., wobei die zweisprachige Ausgabe von Bernd Effe herangezogen wird. Zudem wird Pompeius Trogus‘ Schilderung von Arsinoës II. Hochzeit wiedergegeben, die bruchstückhaft durch den römischen Autor Marcus Iunianus Iustinus überliefert ist. Hierbei wird nach der Übersetzung von Otto Seel zitiert.
Um die beiden wichtigsten hellenistischen Reiche abzudecken, wird nach der Analyse der Machtstellung der Ptolemäerin Arsinoë II. auf die der Seleukidinnen Kleopatra Thea und Laodike eingegangen. Dabei wird vor allem die Darstellung der beiden Königinnen auf Münzen betrachtet. Der wichtigste Literaturtitel für diesen Teil der Arbeit ist der Aufsatz „Mutter, Ehefrau und Herrscherin. Darstellungen der Königin auf seleukidischen Münzen“ von Marion Meyer.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Darstellung und Handlungsspielräume hellenistischer Königinnen
- Beispiel Arsinoë II.
- Beispiel Kleopatra Thea
- Beispiel Laodike
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die tatsächliche Macht hellenistischer Königinnen anhand konkreter Beispiele. Das Hauptziel ist es, den Handlungsspielraum dieser Frauen im Kontext ihrer jeweiligen politischen und gesellschaftlichen Umgebung zu untersuchen und gängige Darstellungen kritisch zu hinterfragen.
- Analyse des Handlungsspielraums hellenistischer Königinnen
- Kritische Auseinandersetzung mit den Quellen (literarische Quellen, Münzdarstellungen)
- Vergleich der Machtpositionen verschiedener Königinnen in unterschiedlichen hellenistischen Reichen
- Untersuchung der medialen Repräsentation der Königinnen
- Wirkungsanalyse der Darstellung der Königinnen in Literatur und Bildkunst
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung dieser Arbeit skizziert die Forschungsfrage nach der tatsächlichen Macht hellenistischer Königinnen und benennt die drei ausgewählten Fallstudien: Arsinoë II., Kleopatra Thea und Laodike. Sie begründet die Fokussierung auf Arsinoë II. mit der bereits bestehenden umfangreichen Forschung zu ihrer Person, die als Ausgangspunkt für den Vergleich mit anderen Königinnen dient. Die Einleitung erwähnt zudem wichtige Forschungsliteratur, die im weiteren Verlauf der Arbeit herangezogen wird und verdeutlicht die methodische Herangehensweise der Arbeit, die sowohl literarische Quellen als auch ikonografische Darstellungen berücksichtigt.
Darstellung und Handlungsspielräume hellenistischer Königinnen: Dieses Kapitel analysiert die Machtpositionen der drei ausgewählten Königinnen. Es beginnt mit einer detaillierten Untersuchung von Arsinoë II., wobei panegyrische Verse von Theokrit, Kallimachos und Poseidippos herangezogen werden, um ihre Rolle als Gemahlin und mögliche Machtbefugnisse zu beleuchten. Die unterschiedlichen Interpretationen dieser Quellen in der Forschung werden diskutiert, wobei die Schwierigkeiten der Quelleninterpretation und die Notwendigkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit den Quellen hervorgehoben werden. Das Kapitel setzt sich fort mit der Betrachtung von Kleopatra Thea und Laodike, wobei der Fokus auf der Analyse ihrer Darstellung auf Münzen liegt. Die Interpretation dieser ikonografischen Quellen soll weitere Erkenntnisse über den tatsächlichen Handlungsspielraum der Königinnen liefern. Der Vergleich der drei Königinnen dient dazu, ein umfassenderes Bild von der Rolle und Macht von Frauen im hellenistischen Kontext zu entwickeln.
Schlüsselwörter
Hellenistische Königinnen, Arsinoë II., Kleopatra Thea, Laodike, Macht, Handlungsspielraum, Quellenkritik, literarische Quellen, Münzdarstellungen, mediale Repräsentation, politische Rolle, Frauengeschichte, Hellenismus, Ptolemäer, Seleukiden.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu "Darstellung und Handlungsspielräume hellenistischer Königinnen"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht den tatsächlichen Handlungsspielraum und die Macht hellenistischer Königinnen. Sie analysiert anhand konkreter Beispiele, wie viel Einfluss diese Frauen in der hellenistischen Welt tatsächlich ausübten und hinterfragt gängige Darstellungen kritisch.
Welche Königinnen werden im Einzelnen untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf drei Fallstudien: Arsinoë II., Kleopatra Thea und Laodike. Diese Auswahl ermöglicht einen Vergleich der Machtpositionen verschiedener Königinnen in unterschiedlichen hellenistischen Reichen.
Warum wird Arsinoë II. besonders hervorgehoben?
Die umfangreiche bereits existierende Forschung zu Arsinoë II. dient als Ausgangspunkt für die vergleichende Analyse. Ihre Rolle wird detailliert untersucht und als Basis für den Vergleich mit den anderen Königinnen verwendet.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich sowohl auf literarische Quellen (z.B. panegyrische Verse von Theokrit, Kallimachos und Poseidippos) als auch auf ikonografische Darstellungen (Münzen). Die kritische Auseinandersetzung mit den Quellen und deren unterschiedlichen Interpretationen spielt eine zentrale Rolle.
Wie wird die Macht der Königinnen analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf den Handlungsspielraum der Königinnen im Kontext ihrer politischen und gesellschaftlichen Umgebung. Dabei wird die mediale Repräsentation in Literatur und Bildkunst untersucht und deren Wirkung analysiert.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Analyse des Handlungsspielraums, Quellenkritik, Vergleich der Machtpositionen verschiedener Königinnen, Untersuchung der medialen Repräsentation und Wirkungsanalyse der Darstellung in Literatur und Bildkunst.
Was ist das Fazit der Arbeit (ohne Details)?
Das Fazit wird im Text nicht explizit vorweggenommen. Der Gesamtüberblick über die Analyse der drei Königinnen soll ein umfassenderes Bild der Rolle und Macht von Frauen im hellenistischen Kontext ermöglichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Hellenistische Königinnen, Arsinoë II., Kleopatra Thea, Laodike, Macht, Handlungsspielraum, Quellenkritik, literarische Quellen, Münzdarstellungen, mediale Repräsentation, politische Rolle, Frauengeschichte, Hellenismus, Ptolemäer, Seleukiden.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel zur Darstellung und den Handlungsspielräumen der Königinnen, und ein Fazit. Das Hauptkapitel analysiert die drei ausgewählten Königinnen jeweils einzeln und vergleichend.
- Citar trabajo
- Verena Binder (Autor), 2017, Die Rolle der hellenistischen Königinnen. Arsinoë II., Kleopatra Thea, Laodike, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/367462