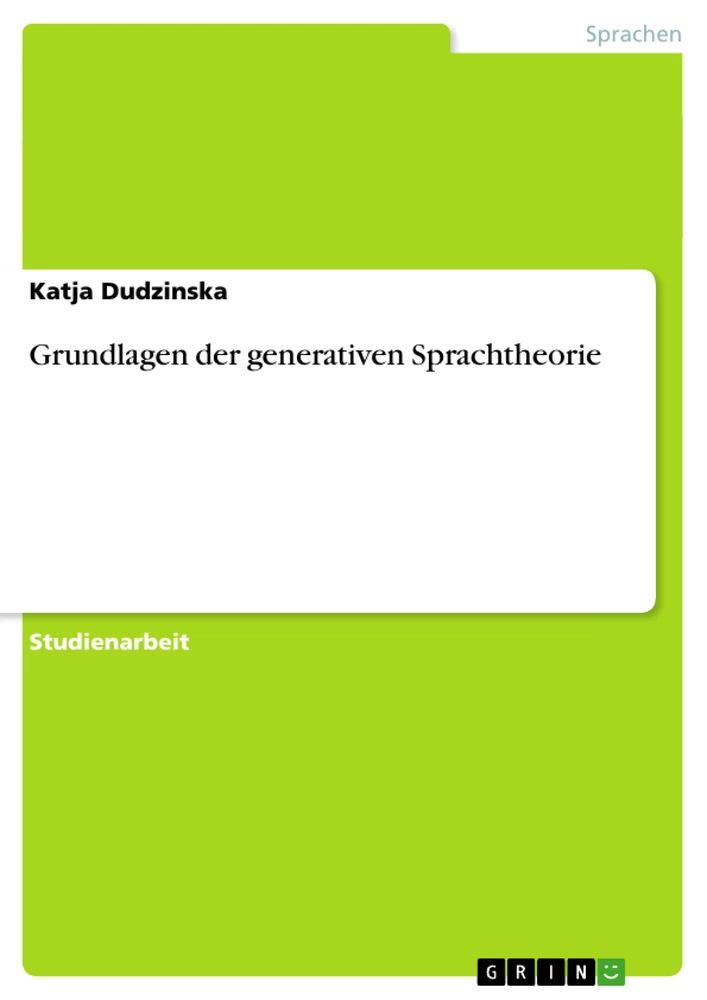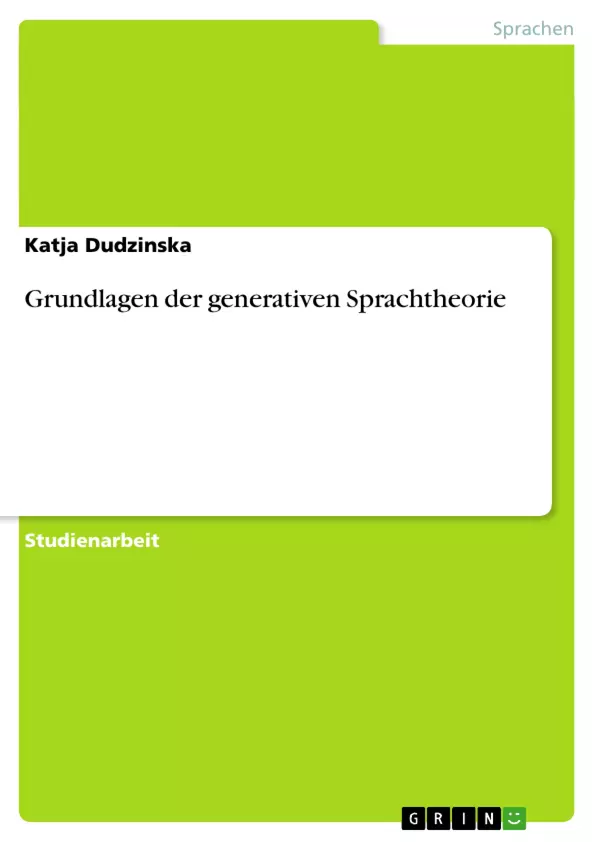Der Angelpunkt der Abgrenzung der GG von der nicht-generativen Systemlinguistik ist eine fundamental andere sprachtheoretische Grundauffassung vom Gegenstand der Sprachforschung. Die amerikanische Art des Strukturalismus, der sogenannte amerikanische Deskriptivismus, beschäftigt sich v. a. mit dem äußerlich vorfindbaren Objekt (Korpus) von Sprache, den Typen, Klassen und Regeln einer Einzelsprache. Es gilt dabei die wiederkehrenden Typen herauszufinden, denen die realen Äußerungen ganz oder in Teilen entsprechen. (z. B. bestimmte Satzmuster) und die Regeln zu formulieren, nach denen die Äußerungen gebaut sind. Die Gesamtheit der Regeln und Typen ergibt zum Beispiel die Grammatik des Deutschen (Linke 89-91). Gegenstandsbereich der GG ist die Kompetenz, d. h. das der Verwendung von Sprache zu Grunde liegende Kenntnissystem, das, was der Mensch prinzipiell kann und nicht die Erscheinungen des tatsächlichen Gebrauchs (Performanz). Das Ziel der linguistischen Analyse ist es, zu Aussagen über jenes System kognitiver Strukturen zu gelangen, das das sprachliche Wissen ausmacht. Die Grundfrage der GG lautet also: Wie ist unser sprachliches Wissen im Gehirn repräsentiert und wie kommt es da hinein, d. h. die GG ist eine Theorie über spezifische mentale Repräsentationen und deren Erwerb (Fanselow 7). Die Grammatikkompetenz ist der extrem eingeschränkte Gegenstand der GG. Die GG postuliert, dass diese Gegenstandsreduktion der Wirklichkeit entspricht, indem sie dem modularen Aufbau unserer kognitiven Fähigkeiten Rechnung trägt (Linke 100).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Grammatik als System mentaler Repräsentationen
- 1.1. Begründung mentaler Repräsentationen
- 1.1.1. Unser grammatisches Wissen
- 1.1.2. Grammatikalitätsurteile
- 1.2. Autonomiethese und Modularitätsthese
- 1.3. Die Spracherwerbsfrage
- 1.3.1. Lernbarkeitskriterium
- 1.3.2. Das logische Problem des Spracherwerbs
- 1.3.3. Die Universalgrammatik
- 2. Weitere Beweise für die Autonomie- und Modularitätsthese
- 2.1. Sprachperzeption
- 2.2. Sprachproduktion
- 2.3. Spracherwerb
- 2.4. Sprachpathologie und Neuropsychologie
- 2.5. Pidgin- und Kreolsprachen
- 2.6. Biologie der Sprache
- 3. Einwände und Gegenthesen zur Autonomie- und Modularitätsthese
- 3.1. Generative Semantik
- 3.2. Funktionale Grammatik
- 3.3. Kognitivistische Lernkonzeptionen
- 3.3.1. Logische Argumente
- 3.3.2. Sprache und Kommunikation
- 3.3.3. Evolution und Sprache
- 3.3.4. Abstraktheit sprachlicher Gesetzmäßigkeiten
- 3.4. Piagets Konstruktivismus
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit den Grundlagen der generativen Sprachtheorie. Ziel ist es, die zentralen Konzepte und Thesen der Theorie zu erläutern und ihre Bedeutung für die Linguistik aufzuzeigen.
- Grammatik als System mentaler Repräsentationen
- Autonomie und Modularität der Sprache
- Das Problem des Spracherwerbs
- Die Universalgrammatik
- Einwände und Gegenthesen zur generativen Sprachtheorie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Generative Grammatik (GG) als einen umfassenden sprach- und grammatiktheoretischen Entwurf vor und erläutert die Grundprinzipien der Theorie. Kapitel 1 diskutiert die Grammatik als System mentaler Repräsentationen, wobei die Rolle von Grammatikalitätsurteilen als methodischem Zugang zur sprachlichen Kompetenz hervorgehoben wird. Kapitel 2 befasst sich mit weiteren Beweisen für die Autonomie- und Modularitätsthese, die aus verschiedenen Bereichen der Linguistik, wie Sprachperzeption, Sprachproduktion, Spracherwerb, Sprachpathologie und Neuropsychologie, gewonnen werden. Kapitel 3 analysiert verschiedene Einwände und Gegenthesen zur generativen Sprachtheorie, darunter die generative Semantik, die funktionale Grammatik, kognitivistische Lernkonzeptionen und Piagets Konstruktivismus.
Schlüsselwörter
Generative Grammatik, mentale Repräsentationen, Grammatikalitätsurteile, Autonomiethese, Modularitätsthese, Spracherwerb, Universalgrammatik, Sprachperzeption, Sprachproduktion, Sprachpathologie, Neuropsychologie, Pidgin- und Kreolsprachen, Biologie der Sprache, Einwände, Gegenthesen, generative Semantik, funktionale Grammatik, Kognitivismus, Konstruktivismus.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Grundgedanke der generativen Sprachtheorie?
Die generative Grammatik (GG) betrachtet Sprache als ein System mentaler Repräsentationen und fokussiert auf die angeborene menschliche Sprachkompetenz statt auf den tatsächlichen Sprachgebrauch (Performanz).
Was unterscheidet Kompetenz von Performanz?
Kompetenz ist das abstrakte sprachliche Wissen eines Menschen, während Performanz die tatsächliche Anwendung der Sprache in konkreten Situationen beschreibt.
Was versteht man unter der Universalgrammatik?
Die Universalgrammatik ist die hypothetische, biologisch vorgegebene Grundstruktur aller menschlichen Sprachen, die den schnellen Spracherwerb bei Kindern erklärt.
Was besagt die Modularitätsthese?
Sie postuliert, dass das Sprachvermögen ein eigenständiges, autonomes Modul im menschlichen Gehirn ist, das unabhängig von anderen kognitiven Fähigkeiten funktioniert.
Welche Kritik gibt es an der generativen Sprachtheorie?
Kritik kommt unter anderem aus der funktionalen Grammatik, dem Kognitivismus und dem Konstruktivismus (z.B. Piaget), die Sprache eher als erlerntes soziales Werkzeug sehen.
- Quote paper
- Katja Dudzinska (Author), 2002, Grundlagen der generativen Sprachtheorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36749