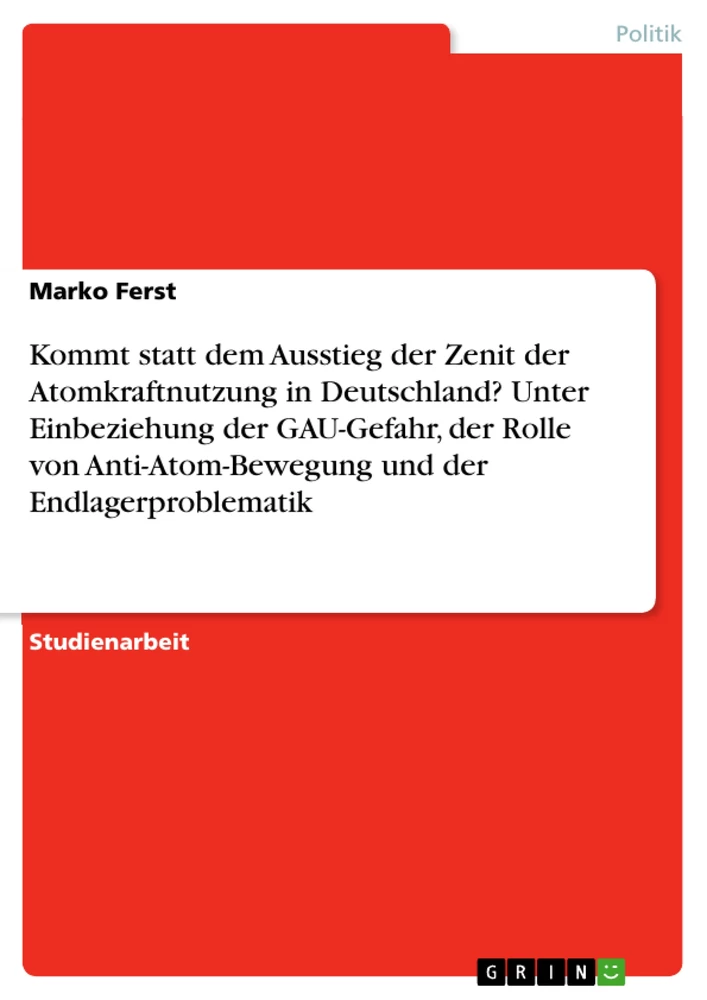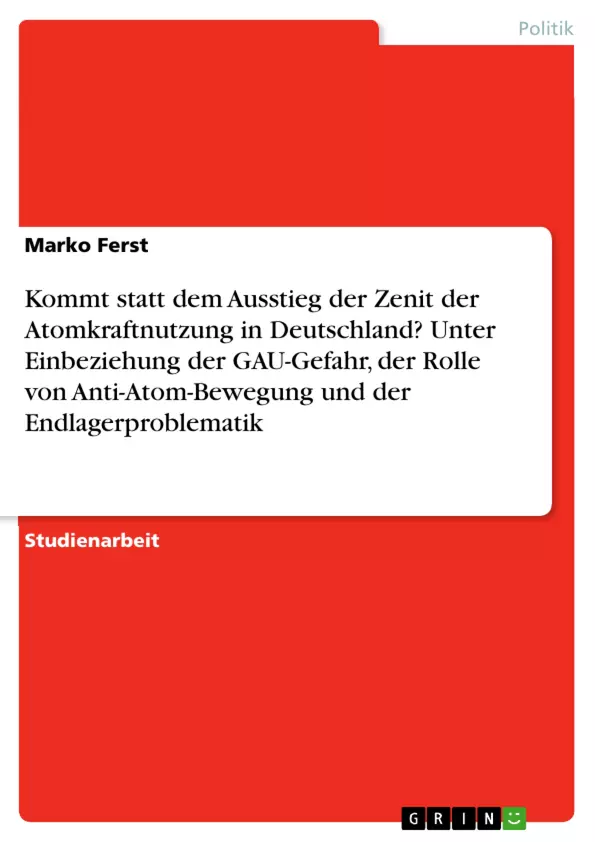In der vorliegenden Arbeit soll zur Debatte gestellt werden, inwiefern der Ausstieg aus der Atomkraft in Deutschland wirklich ein Ausstieg ist oder nur ein Manöver zur Sicherung
der Arbeit bestehender Kernkraftwerke und inwiefern eine solche Option sicherheitstechnisch verantwortbar ist. Darüber hinaus ist zu fragen, ob es sich bei dem Verhandlungsergebnis zum Atomausstieg wirklich um einen Konsens handelt bzw. ob man in diesem Fall überhaupt auf einen Konsens hätte setzen dürfen, also auf einen
zwischen Energiekonzernen und Regierung. Weiter ist zu betrachten, warum es sinnvoll schien die Anti-Atom-Bewegung aus den Verhandlungen auszuschließen und damit eine Befriedung des politischen Konfliktstoffes der Atomtransporte und analoger
Probleme unmöglich zu machen. Darüber hinaus soll einbezogen werden, inwiefern der Atomausstieg auch mit einer sicheren Endlagerung verknüpft ist oder ob er an diesem Verfahrensschritt ausgesetzt bleibt. Ist eine sichere Endlagerung überhaupt möglich?
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einstieg
- Eckpunkte beim „Atomkonsens“
- Das bleibende Atom-Gefahrenpotential
- Bevölkerung und Atomkonsens
- Der Faktor Atom-Widerstand
- Ist ein,,marktwirtschaftlicher“ Ausstieg möglich?
- Warum setzt Rot-Grün auf Nicht-Politik?
- Die Endlagerung: Der Ausstieg nach dem Ausstieg
- Kurzes Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Debatte um den Atomausstieg in Deutschland und hinterfragt dessen tatsächliche Umsetzung sowie dessen Sicherheitsverantwortlichkeit. Es wird untersucht, ob der sogenannte "Atomkonsens" tatsächlich einen Konsens darstellt, insbesondere im Hinblick auf die Einbeziehung der Anti-Atom-Bewegung. Weiterhin wird die Verknüpfung des Atomausstiegs mit einer sicheren Endlagerung und die Möglichkeit einer solchen Endlagerung beleuchtet.
- Bewertung des Atomausstiegs in Deutschland
- Analyse des "Atomkonsens" und dessen Auswirkungen
- Rolle der Anti-Atom-Bewegung im Entscheidungsprozess
- Problematik der Endlagerung von Atommüll
- Sicherheitsaspekte der Atomkraftnutzung
Zusammenfassung der Kapitel
Einstieg
Der Autor beleuchtet die Geschichte der Atomkraftnutzung in Deutschland und kritisiert die hohen Kosten und das Restrisiko, welches trotz offiziell kleinerer Risiken deutlich größer sei als bisher eingeräumt. Der Fokus liegt auf der Frage, ob der Atomausstieg tatsächlich ein Ausstieg oder nur ein Manöver zur Sicherung der Arbeit bestehender Kernkraftwerke darstellt.
Eckpunkte beim „Atomkonsens“
Die Arbeit analysiert die Eckpunkte des "Atomkonsens" und beleuchtet die vereinbarte Produktionsmenge an Atomstrom, die Laufzeiten der Kernkraftwerke sowie die fehlende Festlegung eines endgültigen Ausstiegsdatums. Die Übertragbarkeit von Stromkontingenten und die Aufhebung des Neubaus von Atomkraftwerken werden ebenfalls diskutiert.
Das bleibende Atom-Gefahrenpotential
Hier wird die anhaltende Gefahr der Atomkraft durch die Gefahren eines Gau beleuchtet, der mögliche Schäden und die unzureichende Haftpflicht-Deckungsvorsorge. Die Debatte um die Sicherheitsanforderungen und die Häufigkeit von Prüfungen der Kernkraftwerke werden beleuchtet.
Bevölkerung und Atomkonsens
Das Kapitel befasst sich mit der Rolle der Bevölkerung im Kontext des Atomkonsens. Es werden die Auswirkungen auf die Lebensqualität und die Gefahren durch die radioaktive Wolke im Falle eines Gau thematisiert.
Der Faktor Atom-Widerstand
Der Abschnitt analysiert die Anti-Atom-Bewegung und deren Einfluss auf den "Atomkonsens". Es wird untersucht, warum die Bewegung aus den Verhandlungen ausgeschlossen wurde und welche Auswirkungen dies auf die Befriedung des politischen Konfliktstoffes hat.
Ist ein,,marktwirtschaftlicher“ Ausstieg möglich?
Das Kapitel betrachtet die Möglichkeit eines marktwirtschaftlichen Ausstiegs und hinterfragt, ob dies eine realistische Option ist. Es wird die Wettbewerbsfähigkeit von Atomkraft im Vergleich zu anderen Energieträgern analysiert.
Warum setzt Rot-Grün auf Nicht-Politik?
Die Arbeit untersucht die Rolle der rot-grünen Regierung im Entscheidungsprozess zum Atomausstieg. Es wird hinterfragt, warum die Regierung auf "Nicht-Politik" setzt und die Einbeziehung der Anti-Atom-Bewegung vermeidet.
Die Endlagerung: Der Ausstieg nach dem Ausstieg
Der Abschnitt befasst sich mit der Problematik der Endlagerung von Atommüll. Es wird analysiert, ob eine sichere Endlagerung überhaupt möglich ist und welche Herausforderungen dies mit sich bringt. Die Frage, ob der Atomausstieg an diesem Verfahrensschritt scheitern könnte, wird diskutiert.
Schlüsselwörter
Atomkraft, Atomausstieg, Atomkonsens, Anti-Atom-Bewegung, Endlagerung, GAU, Sicherheitsrisiken, Rot-Grün, Politik, Marktwirtschaft, Energiepolitik, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Was beinhaltet der deutsche "Atomkonsens"?
Er regelt die Begrenzung der Laufzeiten von Kernkraftwerken durch festgelegte Reststrommengen, ohne jedoch ein festes Enddatum für jedes Kraftwerk zu nennen.
Warum wird die Endlagerung als "Ausstieg nach dem Ausstieg" bezeichnet?
Weil die endgültige Entsorgung des Atommülls eine ungelöste Herausforderung bleibt, die weit über das Abschaltdatum der Reaktoren hinausgeht.
Welche Rolle spielte der Widerstand der Anti-Atom-Bewegung?
Der Widerstand war ein entscheidender politischer Faktor, wurde jedoch bei den offiziellen Verhandlungen zum Konsens oft ausgeschlossen.
Gibt es ein Restrisiko für einen GAU in Deutschland?
Ja, Kritiker betonen, dass trotz Sicherheitsvorkehrungen ein katastrophaler Unfall (GAU) nie völlig ausgeschlossen werden kann und die Haftungsvorsorge unzureichend ist.
Ist ein rein marktwirtschaftlicher Atomausstieg möglich?
Die Arbeit untersucht, ob alternative Energien ohne Subventionen konkurrenzfähig genug sind, um die Atomkraft allein durch den Markt zu verdrängen.
- Citation du texte
- Marko Ferst (Auteur), 2001, Kommt statt dem Ausstieg der Zenit der Atomkraftnutzung in Deutschland? Unter Einbeziehung der GAU-Gefahr, der Rolle von Anti-Atom-Bewegung und der Endlagerproblematik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/3674