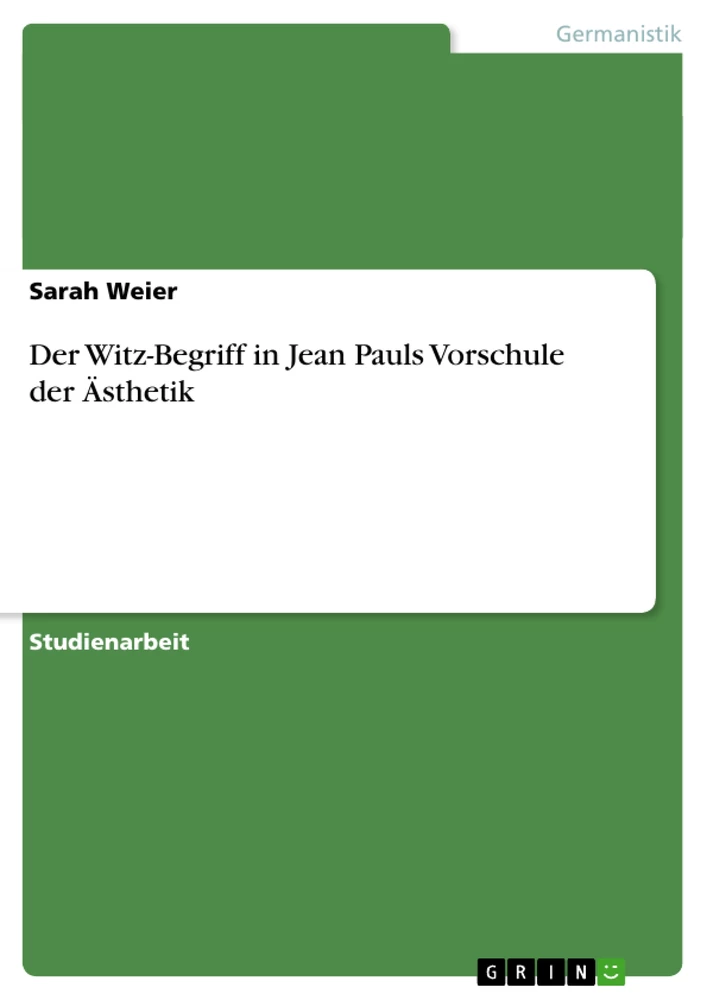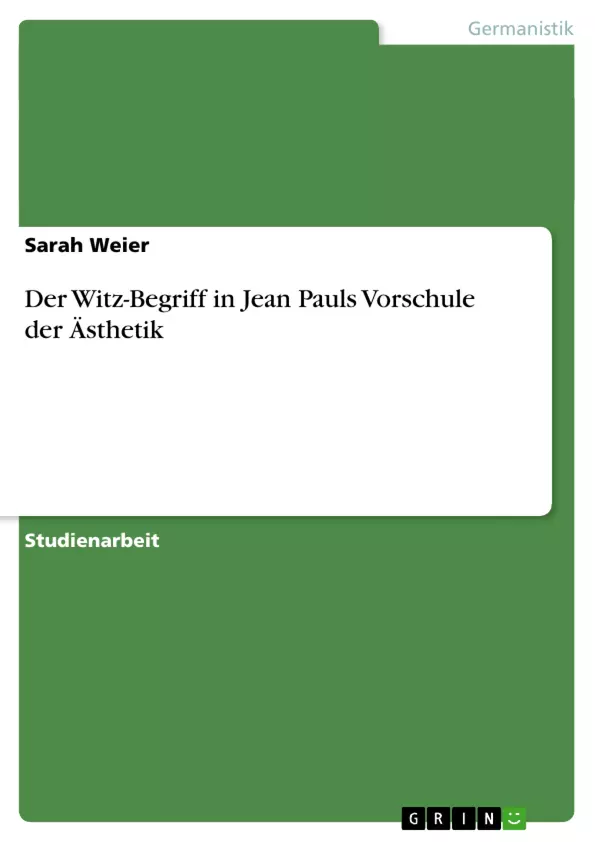[...] Diese Arbeit hat zweierlei Anliegen. Zum einen soll ein Überblick über Jean Pauls Witztheorie gegeben werden, d.h. über die von ihm unterschiedenen Witzarten und ihre Wirkungsweise. Diese Ausführungen würden in der heutigen Zeit einige Verständnisprobleme auslösen, da der Witz- Begriff eine wechselhafte etymologische Entwicklung erlebte. Daher soll zum anderen versucht werden, den in der Vorschule gebrauchten Witz- Begriff in seiner Entwicklungslinie zu verorten. Daraus ergibt sich folgende Gliederung. In dem dieser Einleitung folgenden Abschnitt, d.h. im zweiten, wird ein Überblick über die etymologische Entwicklung des Witz- Begriffes gegeben. Der dritte Abschnitt behandelt allgemein das IX. Programm der Vorschule und seine Unterteilung der Witzarten. Im vierten Abschnitt wird die Definition vom Witz im engeren Sinn und seine Abgrenzung zu Scharfsinn und Tiefsinn betrachtet. Der fünfte Abschnitt ist dem unbildlichen Witz, seiner Wirkungsweise und seinen Besonderheiten zugedacht. Im sechsten Abschnitt wird der bildliche Witz und sein „Doppelzweig“ thematisiert. Der siebente Abschnitt gibt eine Zusammenfassung der Ergebnisse. Der Schluß gewichtet diese Erkenntnisse, bewertet Einschränkungen für diese Arbeit und gibt Ausblicke auf noch zu klärende Fragen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Etymologie des Witzbegriffs im Überblick
- Witz
- Ingenium
- Bedeutungsfelder von Witz um 1800
- Das IX. Programm „Über den Witz“ in der Vorschule der Ästhetik
- Witz und Poesie
- Jean Pauls Unterteilung der Arten von Witz
- Witz, Scharfsinn, Tiefsinn
- Die Definition des Witz-Begriffes
- Witz, Scharfsinn, Tiefsinn
- Witz als schöpferische Kraft
- Zwischenergebnis
- unbildlicher Witz
- Wirkungsweise
- Sprachkürze
- Nähe zur Komik
- Zwischenergebnis
- bildlicher Witz
- Zusammenhang zwischen Innen und Außen
- Körper beseelen und Geist verkörpern
- Die Allegorie
- Zwischenergebnis
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Jean Pauls Witztheorie, wie sie in seinem Werk „Vorschule der Ästhetik“ dargestellt wird. Ziel ist es, einen Überblick über Jean Pauls unterschiedene Witzarten und deren Wirkungsweisen zu geben und den in der Vorschule verwendeten Witzbegriff in seiner etymologischen Entwicklung zu verorten. Die Arbeit berücksichtigt die Schwierigkeiten des Verständnisses aufgrund der historischen Entwicklung des Begriffs.
- Etymologische Entwicklung des Begriffs „Witz“
- Jean Pauls Definition und Unterteilung von Witzarten
- Abgrenzung von Witz zu Scharfsinn und Tiefsinn
- Untersuchung des unbildlichen und bildlichen Witzes
- Analyse der Wirkungsweise von Witz in Jean Pauls Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Zielsetzung der Arbeit: die Untersuchung von Jean Pauls Witztheorie in der „Vorschule der Ästhetik“, unter Berücksichtigung der etymologischen Entwicklung des Begriffs „Witz“ und der Herausforderungen, die sich aus der historischen Distanz ergeben. Es wird die Komplexität von Jean Pauls Werk hervorgehoben und die Struktur der Arbeit skizziert.
Etymologie des Witzbegriffs im Überblick: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Begriffs „Witz“, beginnend vom Althochdeutschen bis ins 18. Jahrhundert. Es wird die Bedeutungswandel von „Wissen“ und „Klugheit“ hin zu „geistreicher Formulierung“ und schließlich „Scherz“ nachvollzogen. Der Einfluss des lateinischen „Ingenium“ und des französischen „esprit“ auf die Entwicklung des Begriffs wird analysiert, um das Bedeutungsfeld um 1800 zu verstehen, also zur Entstehungszeit der „Vorschule der Ästhetik“.
Das IX. Programm „Über den Witz“ in der Vorschule der Ästhetik: Dieses Kapitel widmet sich Jean Pauls eigenem Programm „Über den Witz“ innerhalb seiner „Vorschule“. Es untersucht die Verbindung von Witz und Poesie und analysiert detailliert, wie Jean Paul verschiedene Arten von Witz unterscheidet und kategorisiert, um so die Vielschichtigkeit seines Verständnisses von Witz aufzuzeigen.
Witz, Scharfsinn, Tiefsinn: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Jean Pauls Definition von Witz und dessen Abgrenzung von verwandten Begriffen wie Scharfsinn und Tiefsinn. Es wird untersucht, wie Witz als schöpferische Kraft verstanden wird und in welchem Verhältnis er zu diesen anderen intellektuellen Fähigkeiten steht. Das Kapitel beleuchtet die Feinheiten dieser Unterscheidung und deren Bedeutung für Jean Pauls ästhetisches Denken.
unbildlicher Witz: Dieses Kapitel analysiert den unbildlichen Witz, seine Wirkungsweise und seine spezifischen Merkmale. Es wird die Rolle von Sprachkürze und die Nähe zur Komik untersucht, um die besondere Ausdrucksform und die Wirkung des unbildlichen Witzes zu verstehen und in den Gesamtkontext von Jean Pauls Witztheorie einzubetten.
bildlicher Witz: Hier wird der bildliche Witz und sein „Doppelzweig“ im Detail untersucht. Der Fokus liegt auf dem Verhältnis zwischen Innen und Außen, der Verkörperung des Geistes und der Beseelung des Körpers, sowie der Bedeutung der Allegorie für Jean Pauls Verständnis von bildlichem Witz. Die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Aspekten des bildlichen Witzes werden aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Jean Paul, Vorschule der Ästhetik, Witz, Etymologie, Ingenium, esprit, Poesie, Scharfsinn, Tiefsinn, unbildlicher Witz, bildlicher Witz, Allegorie, Ästhetik, Kunstphilosophie.
Jean Pauls Witztheorie: FAQs zur "Vorschule der Ästhetik"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Jean Pauls Witztheorie, wie sie in seiner "Vorschule der Ästhetik" präsentiert wird. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der verschiedenen Witzarten, ihrer Wirkungsweisen und der Einordnung des von Jean Paul verwendeten Witzbegriffs in seinen historischen Kontext.
Welche Aspekte der Witztheorie werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die etymologische Entwicklung des Begriffs "Witz", Jean Pauls Definition und Kategorisierung von Witzarten, die Abgrenzung von Witz zu Scharfsinn und Tiefsinn, sowie eine detaillierte Untersuchung des unbildlichen und bildlichen Witzes und ihrer Wirkungsweisen in Jean Pauls Werk.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel: Einleitung, Etymologie des Witzbegriffs, Jean Pauls IX. Programm "Über den Witz", Witz, Scharfsinn, Tiefsinn, unbildlicher Witz, bildlicher Witz und Zusammenfassung. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Witztheorie Jean Pauls.
Wie wird der Begriff "Witz" etymologisch untersucht?
Die etymologische Untersuchung verfolgt die Entwicklung des Begriffs "Witz" von seinen althochdeutschen Wurzeln über seine Bedeutungsänderungen im Laufe der Zeit bis hin zum 18. Jahrhundert. Der Einfluss von lateinischem "Ingenium" und französischem "esprit" auf die Entwicklung des Begriffs wird dabei berücksichtigt.
Wie unterscheidet Jean Paul verschiedene Witzarten?
Jean Paul unterscheidet verschiedene Arten von Witz, die in der Arbeit detailliert analysiert werden. Ein Schwerpunkt liegt auf der Unterscheidung zwischen unbildlichem und bildlichem Witz und deren spezifischen Merkmalen und Wirkungsweisen.
Wie grenzt Jean Paul Witz von Scharfsinn und Tiefsinn ab?
Die Arbeit untersucht, wie Jean Paul Witz von ähnlichen Begriffen wie Scharfsinn und Tiefsinn abgrenzt. Es wird analysiert, in welchem Verhältnis Witz zu diesen intellektuellen Fähigkeiten steht und wie er als schöpferische Kraft verstanden wird.
Was sind die Merkmale des unbildlichen Witzes?
Der unbildliche Witz wird anhand seiner Wirkungsweise, seiner Sprachkürze und seiner Nähe zur Komik untersucht. Die Arbeit beleuchtet die Besonderheiten dieser Witzform im Kontext von Jean Pauls Gesamtwerk.
Was kennzeichnet den bildlichen Witz bei Jean Paul?
Der bildliche Witz wird im Hinblick auf das Verhältnis von Innen und Außen, die Verkörperung des Geistes und die Beseelung des Körpers analysiert. Besondere Aufmerksamkeit wird der Rolle der Allegorie im Zusammenhang mit Jean Pauls Verständnis von bildlichem Witz gewidmet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Jean Paul, Vorschule der Ästhetik, Witz, Etymologie, Ingenium, esprit, Poesie, Scharfsinn, Tiefsinn, unbildlicher Witz, bildlicher Witz, Allegorie, Ästhetik, Kunstphilosophie.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, einen umfassenden Überblick über Jean Pauls Witztheorie zu geben, seine verschiedenen Witzarten zu untersuchen und deren Wirkungsweisen zu analysieren. Die historischen und etymologischen Hintergründe des Witzbegriffs spielen dabei eine wichtige Rolle.
- Citation du texte
- Sarah Weier (Auteur), 2004, Der Witz-Begriff in Jean Pauls Vorschule der Ästhetik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36752