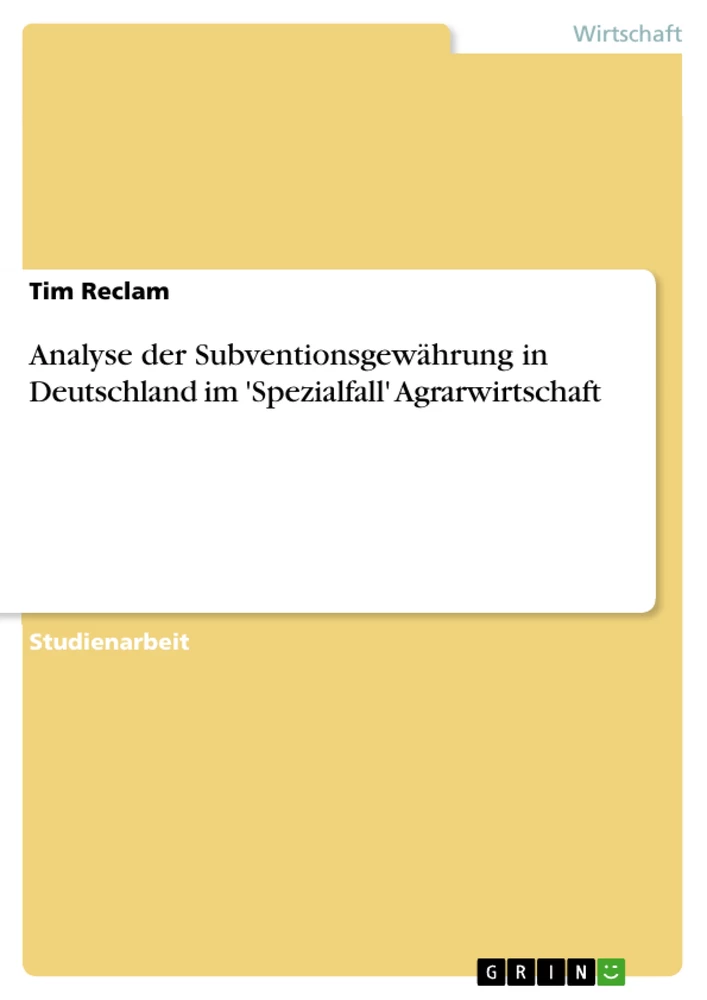In dieser Arbeit soll die Subventionsgewährung in der Agrarwirtschaft näher untersucht werden. Es soll die Frage beantwortet werden, ob die Subventionen in diesem Sektor weiter reduziert werden sollten oder die besonderen Eigenschaften des Agrarsektors die aktuelle Höhe der Subventionen rechtfertigen. Dazu wird eingangs eine Begriffserklärung vorgenommen, in der der Subventionsbegriff definiert und erläutert wird, warum es sich bei der Agrarwirtschaft um einen 'Spezialfall' handeln könnte. Anschließend wird die wohlfahrtsökonomische Wirkung von Subventionen dargestellt und es werden die Ziele der Subventionsvergabe und ihre Nebenwirkungen benannt. Im letzten Abschnitt wird ein Abriss über die Entwicklung der Agrarpolitik hinsichtlich der Subventionsgewährung gegeben und der aktuelle Stand erläutert. Abschließend folgt ein Fazit.
Die Subventionsgewährung in der Agrarwirtschaft ist ein kontrovers und viel diskutiertes Reizthema. Das Ausmaß der Mittel, die sowohl in Deutschland als auch EU-weit dafür aufgewendet werden, erscheint auf den ersten Blick sehr hoch. Im Fokus stehen oft normative Gerechtigkeitsdebatten, daneben wird auch die Effizienz der Maßnahmen in Frage gestellt. Zuletzt wurden jährlich rund 40% des gesamten EU-Haushaltes, der anteilig durch die Mitgliedsstaaten finanziert wird, für Agrarsubventionen ausgegeben. Das entspricht etwa 50 Mrd. Euro.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmungen
- Subventionsbegriff
- ,Spezialfall' Agrarwirtschaft
- Wirkkräfte von Subventionen
- Wohlfahrtsökonomische Wirkung von Subventionen
- Ziele der Subventionsvergabe
- Nebenwirkungen von Subventionen
- Allgemeine Nebenwirkungen
- Agrarwirtschaft-spezifische Nebenwirkungen
- Agrarsubventionen in Deutschland
- Überblick: Entstehung, GAP, ELER/EGFL
- Status quo
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Subventionsgewährung in der deutschen Agrarwirtschaft. Ziel ist es, die Notwendigkeit und Effizienz dieser Subventionen zu beleuchten und zu analysieren, ob eine Reduktion der Mittel gerechtfertigt ist oder ob die besonderen Eigenschaften des Agrarsektors die aktuelle Höhe der Subventionen rechtfertigen.
- Begriffliche Klärung des Subventionsbegriffs und seiner Anwendung im Kontext der Agrarwirtschaft
- Analyse der wohlfahrtsökonomischen Wirkung von Subventionen und deren Einfluss auf die Agrarwirtschaft
- Identifizierung der Ziele der Subventionsvergabe in der Agrarwirtschaft
- Bewertung der positiven und negativen Auswirkungen von Subventionen auf die Agrarwirtschaft
- Einblick in die Entwicklung der Agrarpolitik hinsichtlich der Subventionsgewährung in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Subventionsgewährung in der Agrarwirtschaft ein und beleuchtet die Relevanz dieses Themas. Kapitel 2 definiert den Subventionsbegriff und erläutert, warum die Agrarwirtschaft als ,Spezialfall' betrachtet werden kann. Kapitel 3 analysiert die wohlfahrtsökonomische Wirkung von Subventionen, benennt die Ziele der Subventionsvergabe und diskutiert die möglichen Nebenwirkungen. Kapitel 4 gibt einen Überblick über die Entwicklung der Agrarpolitik in Deutschland hinsichtlich der Subventionsgewährung und beschreibt den aktuellen Stand.
Schlüsselwörter
Agrarsubventionen, Subventionsbegriff, Wohlfahrtsökonomie, Agrarpolitik, Gemeinsame Agrarpolitik (GAP), Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER), Europäische Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL), Nebenwirkungen, Effizienz, Gerechtigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird die Agrarwirtschaft als „Spezialfall“ bei Subventionen bezeichnet?
Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften (z.B. Abhängigkeit von Witterung, Versorgungssicherheit) wird oft argumentiert, dass sie eine Sonderstellung bei staatlichen Hilfen einnimmt.
Wie viel Geld gibt die EU jährlich für Agrarsubventionen aus?
Zuletzt flossen rund 40 % des gesamten EU-Haushaltes in die Landwirtschaft, was etwa 50 Milliarden Euro pro Jahr entspricht.
Was sind die Ziele der Subventionsvergabe in der Landwirtschaft?
Ziele sind unter anderem die Einkommenssicherung der Landwirte, die Stabilisierung der Märkte und die Förderung des ländlichen Raums.
Welche Nebenwirkungen haben Agrarsubventionen?
Es werden Effizienzverluste, Marktverzerrungen sowie Fragen der normativen Gerechtigkeit kritisch diskutiert.
Was bedeuten die Abkürzungen GAP, ELER und EGFL?
GAP steht für Gemeinsame Agrarpolitik, ELER für den Fonds zur Entwicklung des ländlichen Raums und EGFL für den Garantiefonds für die Landwirtschaft.
- Quote paper
- Tim Reclam (Author), 2017, Analyse der Subventionsgewährung in Deutschland im 'Spezialfall' Agrarwirtschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/367556