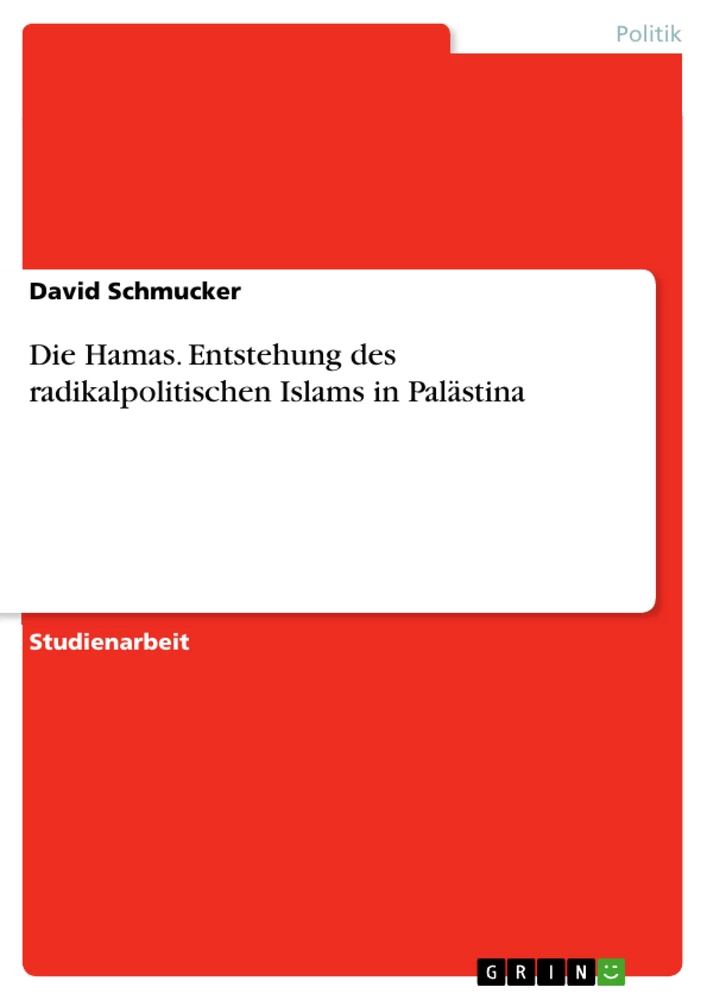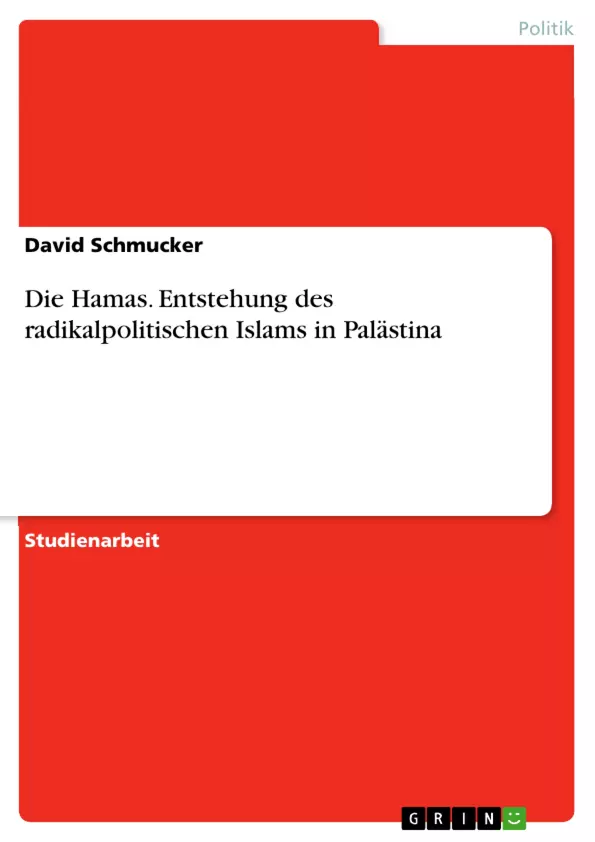In dieser Hausarbeit wird beschrieben, wie sich die Muslimbrüder im Laufe des Israel-Palästinakonfliktes zur gewaltbereiten Hamas entwickeln. Als besonderes Merkmal steht der Gegenstand der Gewalt im Vordergrund und wird auf das theoretische Gewaltkonzept von Frantz Fanon übertragen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Theorien von Gewalt
- 2.1 Franz Fanon und Gewalt
- 3. Der politische Islam in Palästina
- 3.1 Die Muslimbrüder
- 3.2 Entstehung und Entwicklung der Hamas
- 3.3 Die Hamas-Charta und ihre Ziele
- 4. Fazit - Gewalt als zentrales Merkmal der Hamas?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Radikalisierung des politischen Islams in Palästina und die Entstehung der Hamas als gewaltbereite Organisation. Sie analysiert die Einflüsse äußerer Gewalt und Unterdrückung auf die Entwicklung des politischen Islams, von einer moderaten politischen Organisation zu einer gewaltbereiten Terrororganisation.
- Die Rolle von Gewalt und Unterdrückung in der Radikalisierung des politischen Islams.
- Die Entwicklung der Muslimbrüder und ihre Beziehung zur Hamas.
- Die Entstehung und Ideologie der Hamas, wie sie in ihrer Charta zum Ausdruck kommt.
- Der Einfluss externer Faktoren auf die Hamas.
- Die Gewalttätigkeit der Hamas und ihre zentralen Merkmale.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einleitung führt in das Thema der Radikalisierung des politischen Islams in Palästina und die Entstehung der Hamas ein. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Ursachen der Gewaltbereitschaft der Hamas und skizziert den Aufbau der Arbeit. Der Ausgangspunkt ist die scheinbare Diskrepanz zwischen dem Islam als Religion des Friedens und der gewalttätigen Praxis der Hamas. Die Arbeit untersucht die These, dass die jahrzehntelange Unterdrückung des palästinensischen Volkes zur Radikalisierung des politischen Islams und zur Entstehung der Hamas als Terrororganisation führte. Die Einleitung umreißt die methodische Vorgehensweise und die zu behandelnden Kapitel.
2. Theorien von Gewalt: Dieses Kapitel definiert Gewalt soziologisch und beleuchtet verschiedene Aspekte ihrer Anwendung und ihrer Folgen. Es differenziert zwischen Gewalt als Mittel zur Schädigung, Unterwerfung und als Reaktion auf Gewalt (Gegengewalt). Der Fokus liegt auf der Theorie von Franz Fanon, der die Gegengewalt als zwingende Reaktion auf Unterdrückung beschreibt und die Entstehung von Gewalt im Kontext der algerischen Kolonialzeit analysiert. Die Ausführungen dieses Kapitels liefern ein theoretisches Fundament für das Verständnis der Radikalisierung des politischen Islams in Palästina als Reaktion auf die Erfahrungen von Gewalt und Unterdrückung.
3. Der politische Islam in Palästina: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung des politischen Islams in Palästina, beginnend mit den Muslimbrüdern und ihrer Adaption an die politischen Gegebenheiten. Es analysiert detailliert die Entstehung und Entwicklung der Hamas, inklusive ihrer Charta und ihrer Ziele. Dabei werden die Einflüsse verschiedener Faktoren wie die heterogene Gesellschaft im Gazastreifen und Westjordanland, sowie der Einfluss anderer politischer Organisationen wie der PLO auf die Hamas betrachtet. Das Kapitel vermittelt ein umfassendes Verständnis des historischen und politischen Kontextes, der zur Entstehung und Entwicklung der Hamas führte.
Schlüsselwörter
Hamas, Politischer Islam, Palästina, Gewalt, Radikalisierung, Muslimbrüder, Unterdrückung, Israel-Palästina-Konflikt, Terrorismus, Franz Fanon, Gegengewalt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Radikalisierung des politischen Islams in Palästina und die Entstehung der Hamas
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Radikalisierung des politischen Islams in Palästina und die Entstehung der Hamas als gewaltbereite Organisation. Sie analysiert, wie äußere Gewalt und Unterdrückung die Entwicklung des politischen Islams von einer moderaten politischen Organisation zu einer gewaltbereiten Terrororganisation beeinflusst haben.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Rolle von Gewalt und Unterdrückung bei der Radikalisierung des politischen Islams, die Entwicklung der Muslimbrüder und ihre Beziehung zur Hamas, die Entstehung und Ideologie der Hamas (wie in ihrer Charta dargestellt), den Einfluss externer Faktoren auf die Hamas und die Gewalttätigkeit der Hamas und ihre zentralen Merkmale.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in vier Kapitel: Eine Einführung, ein Kapitel zu Theorien von Gewalt (mit Fokus auf Franz Fanon), ein Kapitel zum politischen Islam in Palästina (einschließlich Muslimbrüdern und Hamas) und ein Fazit, das die zentrale Frage nach Gewalt als zentrales Merkmal der Hamas behandelt.
Welche Theorie der Gewalt wird in der Hausarbeit besonders berücksichtigt?
Die Hausarbeit bezieht sich insbesondere auf die Theorie von Franz Fanon, der die Gegengewalt als zwingende Reaktion auf Unterdrückung beschreibt und die Entstehung von Gewalt im Kontext der algerischen Kolonialzeit analysiert. Diese Theorie dient als theoretisches Fundament für das Verständnis der Radikalisierung des politischen Islams in Palästina als Reaktion auf Gewalt und Unterdrückung.
Wie wird die Entstehung der Hamas in der Hausarbeit dargestellt?
Die Entstehung und Entwicklung der Hamas wird detailliert analysiert, einschließlich ihrer Charta und ihrer Ziele. Dabei werden Einflüsse verschiedener Faktoren wie die heterogene Gesellschaft im Gazastreifen und Westjordanland sowie der Einfluss anderer politischer Organisationen wie der PLO berücksichtigt. Die Arbeit bietet ein umfassendes Verständnis des historischen und politischen Kontextes, der zur Entstehung und Entwicklung der Hamas führte.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Hamas, Politischer Islam, Palästina, Gewalt, Radikalisierung, Muslimbrüder, Unterdrückung, Israel-Palästina-Konflikt, Terrorismus, Franz Fanon, Gegengewalt.
Welche zentrale Forschungsfrage wird in der Arbeit gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Was sind die Ursachen der Gewaltbereitschaft der Hamas?
Welche methodische Vorgehensweise wird in der Arbeit beschrieben?
Die Einleitung umreißt die methodische Vorgehensweise, die im Detail innerhalb der Arbeit erläutert wird.
- Quote paper
- David Schmucker (Author), 2016, Die Hamas. Entstehung des radikalpolitischen Islams in Palästina, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/367634