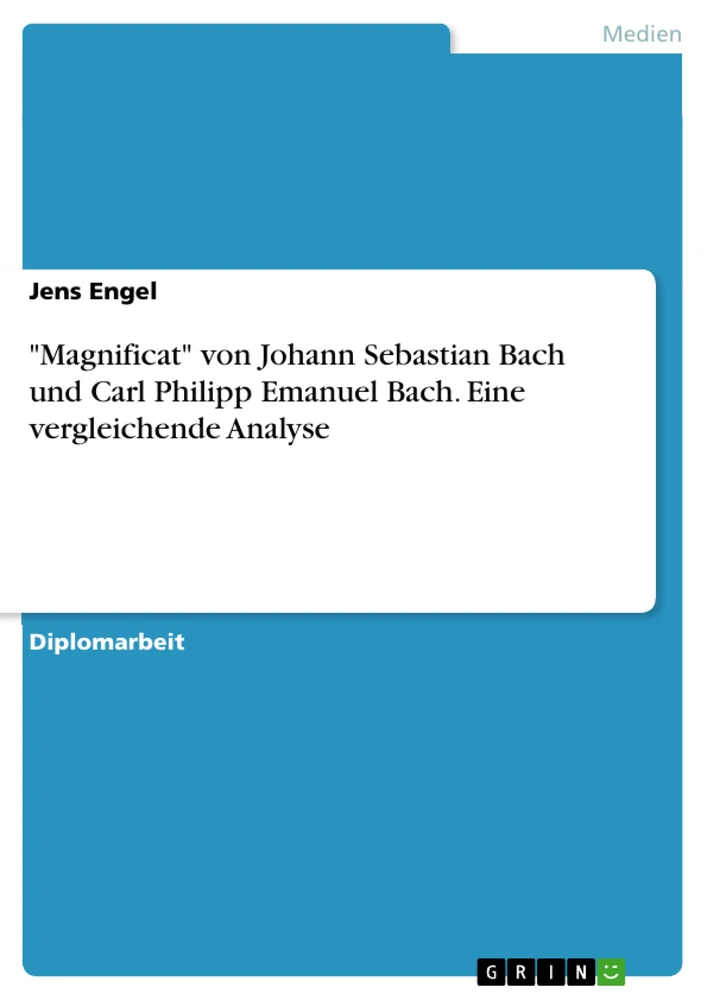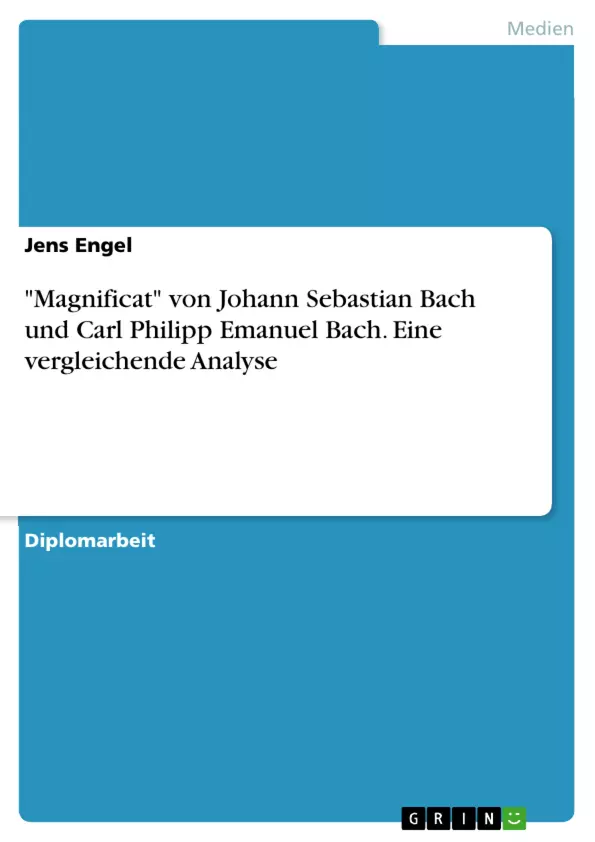Zwischen der Entstehung des Magnificat BWV 243 von Johann Sebastian Bach und dem seines zweitältesten Sohnes Carl Philipp Emanuel Bach liegen immerhin 26 Jahre und doch existieren, aufgrund der Sonderstellung beider Werke im Schaffen von Vater und Sohn, Zusammenhänge zwischen diesen Kompositionen. Als das Magnificat von Johann Sebastian Bach Weihnachten 1723 erstmals gespielt wurde, war Carl Philipp Emanuel 9 Jahre alt und hat es mit Sicherheit bewusst erlebt, hat vielleicht sogar mitgesungen. Allerdings wird für die spätere Komposition C. Ph. Emanuels des Vaters überarbeitete Fassung vom Frühjahr 1732 von größerer Bedeutung gewesen sein. Zu dieser Zeit war der Sohn 18 Jahre alt, hatte sein Opus 1 (heute Wq 111) eigenhändig in Kupfer gestochen, galt bereits als hervorragender Pianist und studierte gerade Jura an der Universität Leipzig. In der Folgezeit war er in Frankfurt an der Oder und in Berlin und Potsdam tätig, jedoch gab es für ihn an seinen Anstellungsorten nur sehr selten Anlaß zur Komposition geistlicher Musik.
Als gesichert gilt, dass das 1749 entstandene Magnificat die erste große geistliche Komposition Carl Philipp Emanuels ist. Die enge Verwandtschaft der Magnificat von Vater und Sohn zueinander und die Unterschiede, die das neue, „empfindsame“ Musikverständnis C. Ph. E. Bachs mit sich brachte, sollen in dieser Arbeit aufgezeigt werden. Daher sind die Endfassung des Magnificat J. S. Bachs (vermutlich 1732) und die Erstfassung des Magnificat von C. Ph. E. Bach (vermutlich 1749), soweit die Quellen es ermöglichen, die Grundlage der nachfolgenden Betrachtungen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Worte
- Die Magnificat-Verse zuzüglich der Doxologie mit ihrer Übersetzung nach Martin Luther
- Das Magnificat in der Heiligen Schrift
- Die musikgeschichtliche Entwicklung des Magnificat
- Johann Sebastian Bach
- Die Entstehung des Magnificat BWV 243
- Musikalische Analyse der einzelnen Magnificat-Verse von J.S. Bach
- Die Entstehung des Magnificat WQ 215
- Musikalische Analyse der einzelnen Magnificat-Verse von C. Ph. E. Bach
- Vergleich beider Werke
- Aufteilung der Magnificat-Verse bei J.S. Bach und C. Ph. E. Bach
- Die musikalische Sprache Carl Philipp Emanuel Bachs
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Zusammenhänge zwischen den Magnificat-Kompositionen von Johann Sebastian Bach (BWV 243) und seinem Sohn Carl Philipp Emanuel Bach (WQ 215). Die Zielsetzung besteht darin, die musikalischen Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Werke aufzuzeigen und den Einfluss des sich verändernden musikalischen Verständnisses im Übergang vom Barock zum Empfindsamkeitsstil zu beleuchten.
- Vergleich der musikalischen Gestaltung der einzelnen Magnificat-Verse bei J.S. Bach und C.Ph.E. Bach.
- Analyse der unterschiedlichen Kompositionsstile und der jeweiligen musikalischen Sprache beider Komponisten.
- Untersuchung des historischen Kontextes der Entstehung beider Werke und der jeweiligen Lebensumstände der Komponisten.
- Bewertung des Einflusses der jeweiligen musikalischen Tradition und des persönlichen Stils auf die Kompositionen.
- Aufzeigen der Entwicklung des Magnificat als musikalisches Genre.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitende Worte: Die Einleitung stellt die beiden Magnificat-Vertonungen von Johann Sebastian Bach und Carl Philipp Emanuel Bach vor und betont die 26 Jahre zwischen ihrer Entstehung. Sie beleuchtet den Einfluss des Vaters auf den Sohn und die Bedeutung der jeweiligen historischen und persönlichen Umstände für die Kompositionen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der Endfassung des Magnificat J.S. Bachs und der Erstfassung des Magnificat C.Ph.E. Bachs.
Die Magnificat-Verse zuzüglich der Doxologie mit ihrer Übersetzung nach Martin Luther: Dieses Kapitel präsentiert den lateinischen Text des Magnificats mit der deutschen Übersetzung nach Martin Luther. Es dient als Grundlage für die spätere musikalische Analyse und den Vergleich der beiden Kompositionen. Die Präsentation des Textes ist essentiell für das Verständnis der inhaltlichen Grundlage beider musikalischer Werke.
Das Magnificat in der Heiligen Schrift: Dieses Kapitel (sofern vorhanden im Originaltext und substanziell) würde die liturgische Bedeutung und den geschichtlichen Kontext des Magnificats innerhalb der christlichen Tradition erörtern. Es würde den biblischen Text einordnen und seine Relevanz für die musikalische Vertonung beleuchten. Die Analyse würde möglicherweise auf die theologische Bedeutung eingehen und unterschiedliche Interpretationsansätze vorstellen.
Die musikgeschichtliche Entwicklung des Magnificat: Dieses Kapitel (sofern vorhanden im Originaltext und substanziell) bietet einen Überblick über die Entwicklung des Magnificats als musikalisches Genre. Es würde verschiedene Vertonungen und Stile aus der Musikgeschichte vorstellen, um den Platz der beiden untersuchten Werke im größeren Kontext zu verdeutlichen. Es würde möglicherweise auf wichtige Komponisten und Epochen eingehen, die die Entwicklung des Magnificats beeinflusst haben.
Johann Sebastian Bach: Dieses Kapitel (sofern vorhanden im Originaltext und substanziell) würde sich mit dem Leben und Werk Johann Sebastian Bachs befassen, insbesondere im Hinblick auf seine geistlichen Kompositionen. Es würde die Entstehung des Magnificat BWV 243 im Kontext seines Schaffens und seiner Zeit betrachten. Biographische Details und musikalische Einflüsse würden hier analysiert.
Die Entstehung des Magnificat BWV 243: Dieses Kapitel (sofern vorhanden im Originaltext und substanziell) untersucht detailliert die Entstehung von Johann Sebastian Bachs Magnificat BWV 243. Es analysiert den historischen Hintergrund, die Auftragslage und die musikalische Intention des Werkes. Die Analyse könnte auf die Verwendung bestimmter musikalischer Techniken und ihrer Bedeutung für das Gesamtkunstwerk eingehen.
Musikalische Analyse der einzelnen Magnificat-Verse von J.S. Bach: Dieses Kapitel (sofern vorhanden im Originaltext und substanziell) würde eine detaillierte musikalische Analyse der einzelnen Verse des Magnificats von J.S. Bach bieten. Es würde die harmonische, melodische und rhythmische Gestaltung untersuchen und dabei auf die musikalischen Mittel eingehen, mit denen Bach die verschiedenen Textteile ausdrückt. Die Analyse würde die Struktur und Form des Werkes erörtern.
Die Entstehung des Magnificat WQ 215: Dieses Kapitel (sofern vorhanden im Originaltext und substanziell) befasst sich mit der Entstehung des Magnificats WQ 215 von C.Ph.E. Bach. Es würde seine Entstehungsgeschichte, die möglichen Beweggründe und den historischen Kontext beleuchten, möglicherweise auch im Hinblick auf den beruflichen Werdegang des Komponisten und sein Verhältnis zum König Friedrich dem Großen.
Musikalische Analyse der einzelnen Magnificat-Verse von C. Ph. E. Bach: Dieses Kapitel (sofern vorhanden im Originaltext und substanziell) bietet eine detaillierte Analyse der einzelnen Verse des Magnificats von C.Ph.E. Bach. Es würde den Vergleich zu J.S. Bachs Werk ermöglichen und den Unterschied der musikalischen Sprache aufzeigen. Der Fokus liegt auf den stilistischen Merkmalen des Empfindsamkeitsstils.
Vergleich beider Werke: Dieses Kapitel (sofern vorhanden im Originaltext und substanziell) stellt einen umfassenden Vergleich der beiden Magnificat-Vertonungen dar. Es werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Bezug auf musikalische Gestaltung, Stil und Ausdruck analysiert, sowie die Entwicklung des Magnificat-Genres von J.S. Bach zu C.Ph.E. Bach beschrieben.
Aufteilung der Magnificat-Verse bei J.S. Bach und C. Ph. E. Bach: Dieses Kapitel (sofern vorhanden im Originaltext und substanziell) vergleicht die strukturelle Anordnung und die Aufteilung der Magnificat-Verse in beiden Werken. Es untersucht die unterschiedlichen musikalischen Schwerpunkte und die jeweiligen Dramaturgien. Die Analyse könnte auch auf die Form und die Gestaltung der einzelnen Sätze eingehen.
Die musikalische Sprache Carl Philipp Emanuel Bachs: Dieses Kapitel (sofern vorhanden im Originaltext und substanziell) untersucht die musikalische Sprache Carl Philipp Emanuel Bachs und seine stilistischen Merkmale im Vergleich zu seinem Vater. Es befasst sich mit dem Übergang vom Barock zur Empfindsamkeit und dem daraus resultierenden veränderten musikalischen Ausdruck.
Schlüsselwörter
Magnificat, Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, Vergleichende Musikwissenschaft, Barockmusik, Empfindsamkeit, Geistliche Musik, Musikalische Analyse, Kompositionsstil, Theologische Interpretation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Vergleich der Magnificat-Vertonungen von J.S. Bach und C.Ph.E. Bach
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht die Magnificat-Vertonungen von Johann Sebastian Bach (BWV 243) und seinem Sohn Carl Philipp Emanuel Bach (WQ 215). Der Fokus liegt auf der Analyse der musikalischen Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Werke und der Beleuchtung des Einflusses des sich verändernden musikalischen Verständnisses im Übergang vom Barock zur Empfindsamkeit.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu einleitenden Worten, dem Magnificat-Text (lateinisch und Luther-Übersetzung), dem Magnificat in der Heiligen Schrift, der musikgeschichtlichen Entwicklung des Magnificats, Johann Sebastian Bach, der Entstehung des Magnificat BWV 243, der musikalischen Analyse der einzelnen Verse von J.S. Bach, der Entstehung des Magnificat WQ 215, der musikalischen Analyse der einzelnen Verse von C.Ph.E. Bach, einem Vergleich beider Werke, der Aufteilung der Verse bei beiden Komponisten, der musikalischen Sprache C.Ph.E. Bachs und einem Schlusswort. Nicht alle Kapitel sind im vorliegenden Auszug vollständig detailliert.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die musikalischen Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Magnificat-Vertonungen aufzuzeigen und den Einfluss des Wandels im musikalischen Verständnis vom Barock zur Empfindsamkeit zu beleuchten. Es werden der Kompositionsstil, die musikalische Sprache beider Komponisten und der historische Kontext analysiert.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Vergleich der musikalischen Gestaltung der einzelnen Verse, die Analyse der Kompositionsstile und der musikalischen Sprache, den historischen Kontext der Entstehung beider Werke, den Einfluss der musikalischen Tradition und des persönlichen Stils und die Entwicklung des Magnificats als musikalisches Genre.
Welche Versionen der Magnificat-Vertonungen werden untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Endfassung des Magnificat von J.S. Bach (BWV 243) und die Erstfassung des Magnificats von C.Ph.E. Bach (WQ 215).
Wie wird der Magnificat-Text berücksichtigt?
Der lateinische Text des Magnificats mit der deutschen Übersetzung nach Martin Luther wird präsentiert und dient als Grundlage für die musikalische Analyse und den Vergleich der Kompositionen. Die theologische Bedeutung des Textes wird, sofern im Originaltext vorhanden, ebenfalls erörtert.
Wie werden die musikalischen Analysen durchgeführt?
Die musikalischen Analysen untersuchen die harmonische, melodische und rhythmische Gestaltung der einzelnen Verse beider Magnificat-Vertonungen. Es wird auf die musikalischen Mittel eingegangen, mit denen die Komponisten die verschiedenen Textteile ausdrücken und die Struktur und Form der Werke erörtert.
Wie wird der Vergleich der beiden Werke durchgeführt?
Der Vergleich umfasst die musikalische Gestaltung, den Stil, den Ausdruck und die Entwicklung des Magnificat-Genres von J.S. Bach zu C.Ph.E. Bach. Die strukturelle Anordnung und Aufteilung der Verse werden ebenfalls verglichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind Magnificat, Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, Vergleichende Musikwissenschaft, Barockmusik, Empfindsamkeit, Geistliche Musik, Musikalische Analyse, Kompositionsstil, Theologische Interpretation.
- Arbeit zitieren
- Jens Engel (Autor:in), 2009, "Magnificat" von Johann Sebastian Bach und Carl Philipp Emanuel Bach. Eine vergleichende Analyse, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/367737