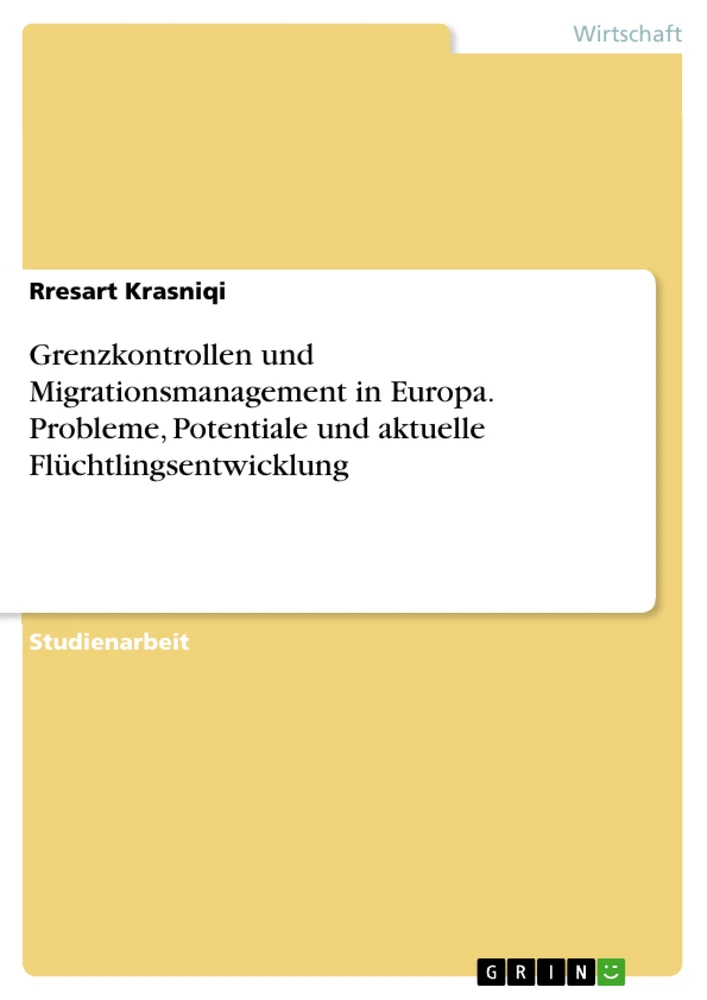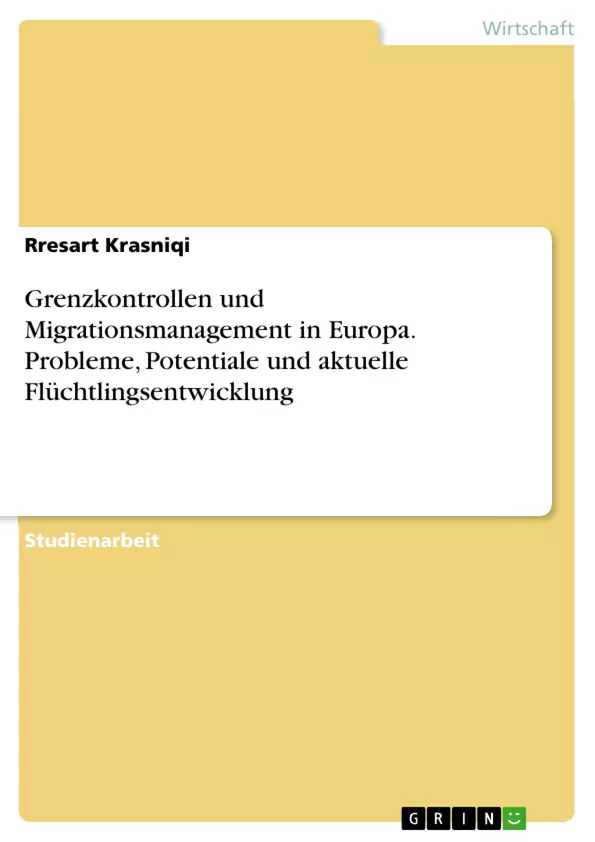Die europäische Migrationspolitik kann grob in drei verschiedene Phasen unterteilt werden. Die erste Phase betrifft die Jahre von 1957 bis 1990 und war durch die koordinierte Politik der Mitgliedsstaaten gekennzeichnet. Von 1990 bis 1999 erfolgte eine zwischenstaatliche Zusammenarbeit. Seit 1999 wird die Migrationspolitik in einer noch engeren Gemeinschaftsarbeit durchgeführt. Allerdings ist diese Zusammenarbeit immer noch durch die gegensätzlichen Zielsetzungen der einzelnen Länder gekennzeichnet. Jedes Land versucht, die für sie beste Situation zu erreichen, was zu Auseinandersetzungen und Problemen führt. Gleichzeitig steht die EU aber vor einer immer größer werdenden Problematik, da sich die Anzahl der Migranten erhöht.
Vor diesem Hintergrund wurde immer wieder thematisiert, dass Migranten für die EU per se nicht negativ zu sehen sind, denn die vom demographischen Wandel betroffenen EU-Staaten könnten mit Hilfe von Einwanderern z.B. die frei werdenden Arbeitsstellen neu besetzen. Gleichzeitig konnte immer wieder festgestellt werden, dass die EU für Migranten ein attraktives Zielgebiet darstellt. Ein derartiges Vorgehen ist nicht ohne ein Migrationsmanagement möglich, bei dem es darum geht, die Einwanderer zielgerichtet nach den jeweiligen Erfordernissen der EU-Staaten zu verteilen. Im Zusammenhang mit den vielen Flüchtlingen jedoch ist das Migrationsmanagement der EU kritisch zu sehen, Anspruch und Realität klaffen weit auseinander. Vielmehr scheint die Migrationspolitik von EU-Staaten restriktiver zu werden und es werden wieder die Schließung von Grenzen diskutiert oder Soldaten an bestimmte Stellen zu schicken, um Flüchtlinge davon abzuhalten, ins Land zu kommen.
Um diese Inhalte der Migrationspolitik der EU geht es in dieser Arbeit. Thematisiert wird dabei das von der EU verfolgte Migrationsmanagement, das in seinem theoretischen Gehalt und seiner praktischen Umsetzung kritisch diskutiert wird. Zentral geht es dabei auch darum, die Thematik der Grenzschließung und des Umgangs der EU mit den Außengrenzen der EU zu berücksichtigen. Aufgezeigt werden soll dabei, ob die Migrationspolitik eher konstruktiv oder restriktiv ausgerichtet ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen der strategischen Neuausrichtung der Migrationspolitik der EU
- 2.1 Potenziale eines gezielten Migrationsmanagements und einer kohärenten Migrationspolitik
- 2.2 Umgang mit irregulärer Migration und Asylanten
- 3. Grenzen und Situation an den Grenzen im Rahmen des Migrationsmanagements
- 3.1 Die Problematik offener Grenzen in der EU
- 3.2 Erhöhung der Grenzkontrollen
- 3.3 Kritische Diskussion: Grenzen des Migrationsmanagements
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert kritisch die Migrationspolitik der EU vor dem Hintergrund der aktuellen Flüchtlingsentwicklung. Sie untersucht das von der EU verfolgte Migrationsmanagement, sowohl in seiner theoretischen Grundlage als auch in seiner praktischen Umsetzung. Die Arbeit fokussiert auf die Thematik der Grenzschließung und des Umgangs der EU mit den Außengrenzen der EU. Ziel ist es, die Frage zu beantworten, ob die Migrationspolitik der EU eher konstruktiv oder restriktiv ausgerichtet ist.
- Entwicklung der europäischen Migrationspolitik
- Potenziale und Grenzen des Migrationsmanagements
- Problematik offener Grenzen in der EU
- Erhöhung der Grenzkontrollen und deren Auswirkungen
- Kritik an der Restriktivität der EU-Migrationspolitik
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Arbeit gliedert die europäische Migrationspolitik in drei Phasen: die koordinierte Politik der Mitgliedsstaaten (1957-1990), die zwischenstaatliche Zusammenarbeit (1990-1999) und die enge Gemeinschaftsarbeit seit 1999. Trotz dieser Zusammenarbeit sind die Ziele der einzelnen Länder weiterhin gegensätzlich, was zu Konflikten führt. Die steigende Zahl von Migranten stellt die EU vor große Herausforderungen. Die Arbeit untersucht das Migrationsmanagement der EU und diskutiert kritisch dessen Anspruch und Realität.
2. Grundlagen der strategischen Neuausrichtung der Migrationspolitik der EU
Die heutige Migrationspolitik der EU ist das Ergebnis eines langen Entwicklungsprozesses, der durch die unterschiedlichen Interessen der Mitgliedsstaaten geprägt war. In den 1970er Jahren änderte sich die Sichtweise auf Migration von einer Bereicherung durch Arbeitskräfte zu einem Problem, das im Rahmen der Gemeinschaft diskutiert werden musste. Die Politik musste sich mit der Integration von Migranten auseinandersetzen und Regelungen für Asylbewerber schaffen. Das Dublin-Verfahren sollte die Zuständigkeit für die Aufnahme von Flüchtlingen regeln.
2.1 Potenziale eines gezielten Migrationsmanagements und einer kohärenten Migrationspolitik
Die Arbeit argumentiert, dass eine kohärente Migrationspolitik zahlreiche Möglichkeiten bietet. Die legale Migration sollte gefördert werden, um die illegale Migration zu reduzieren. Die Zusammenarbeit mit Drittländern ist hierfür unerlässlich. Die Verbesserung der Kooperation auf nationaler und internationaler Ebene ist notwendig, um die Ineffizienz der bisherigen Migrationspolitik zu überwinden.
3. Grenzen und Situation an den Grenzen im Rahmen des Migrationsmanagements
Dieses Kapitel untersucht die Problematik offener Grenzen in der EU und die Diskussion um erhöhte Grenzkontrollen. Es werden die Folgen von erhöhten Grenzkontrollen diskutiert und die Grenzen des Migrationsmanagements kritisch beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Begriffen wie Migrationsmanagement, Migrationspolitik, Grenzkontrollen, Flüchtlingsentwicklung, Dublin-Verfahren, illegale Migration, legale Migration, Integration, Asyl und Kohärenz. Sie analysiert die Problematik der Restriktivität der EU-Migrationspolitik und die Auswirkungen auf die Menschenrechte.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich die EU-Migrationspolitik seit 1957 entwickelt?
Sie durchlief drei Phasen: koordinierte Politik (bis 1990), zwischenstaatliche Zusammenarbeit (bis 1999) und die heutige enge Gemeinschaftsarbeit.
Was ist das Ziel eines gezielten Migrationsmanagements?
Es soll Einwanderer nach den Erfordernissen der EU-Staaten (z.B. Arbeitsmarktbedarf aufgrund des demographischen Wandels) verteilen und steuern.
Warum ist die Zusammenarbeit der EU-Länder oft schwierig?
Die Mitgliedsstaaten verfolgen oft gegensätzliche nationale Ziele, was zu Konflikten bei der Verteilung von Flüchtlingen und der Grenzsicherung führt.
Was regelt das Dublin-Verfahren?
Das Dublin-Verfahren bestimmt, welcher EU-Staat für die Prüfung eines Asylantrags zuständig ist, meist das Land der ersten Einreise.
Ist die aktuelle EU-Politik eher konstruktiv oder restriktiv?
Die Arbeit diskutiert kritisch, dass Anspruch und Realität weit auseinanderklaffen und die Politik zunehmend restriktiver wird, was sich in Grenzschließungen und verstärkten Kontrollen äußert.
- Citation du texte
- Rresart Krasniqi (Auteur), 2015, Grenzkontrollen und Migrationsmanagement in Europa. Probleme, Potentiale und aktuelle Flüchtlingsentwicklung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/367771