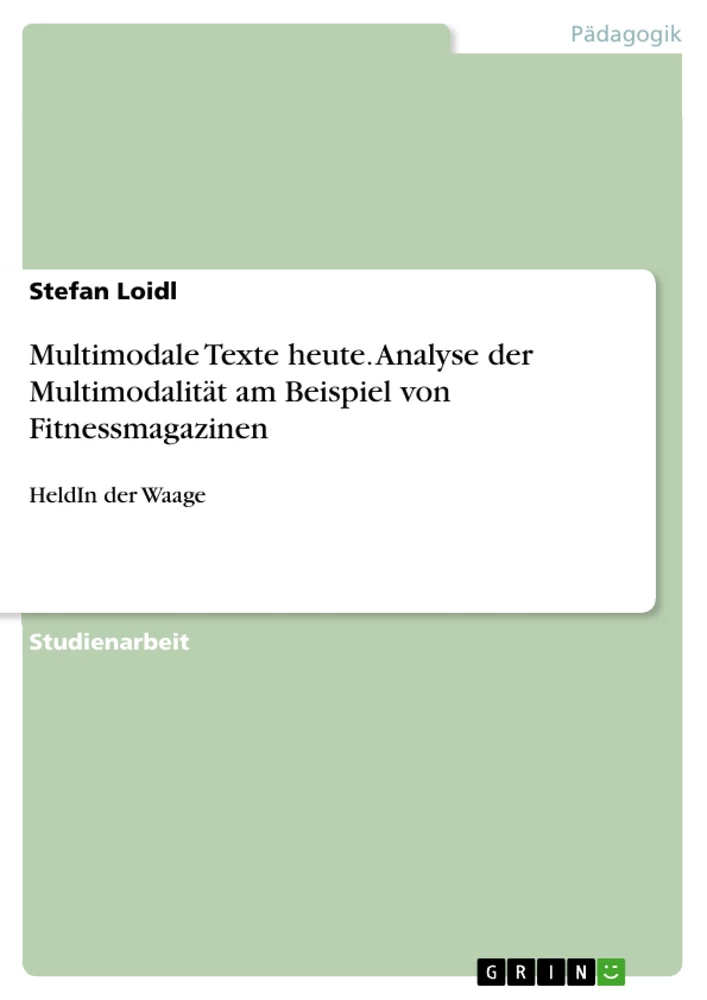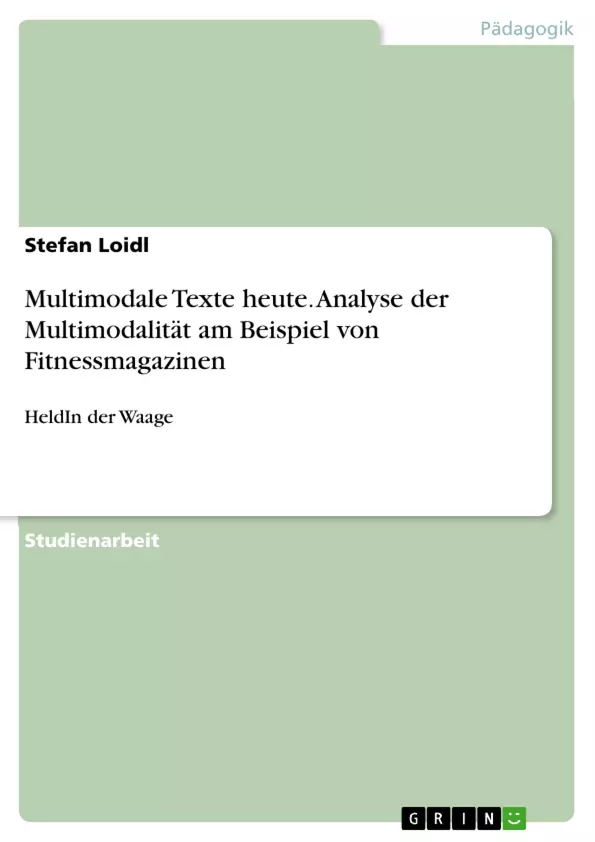Die Arbeit selbst setzt sich aus zwei Teilen zusammen. So erfolgt im ersten theoretischen Teil ein Einblick in die Bereiche „Text und Textlinguistik“ von multimodalen Werken. Es soll einerseits der Gegenstand an sich, andererseits aber auch die Schwierigkeit einer Definitionsfindung näher beleuchtet werden, ehe in einem nächsten Schritt die Themen „multimodale Texte“ beziehungsweise „Text-Bild-Konglomerate“ einer näheren Erläuterung unterzogen werden. Im zweiten praktischen Teil der Arbeit steht die Korpusanalyse zweier Artikel der Gesundheits- und Fitnessmagazine „Men’s Health“ und „Womens Health“ im Vordergrund. Anhand dieser beiden Korpora wird aufgezeigt, ob und inwiefern diese Text-Bild- Konglomerate den traditionellen Textualitätsmerkmalen und –kriterien gerecht werden, sprich, sie noch als „Texte“ bezeichnet werden können. Ebenso wird der Textaufbau, die Textsorte und die Textfunktion der beiden Korpora erläutert. Eine abschließende Schlussbetrachtung fasst die wesentlichen Erkenntnisse der Korpusanalyse zusammen und klärt die Frage, ob sich LeserInnen des 21. Jahrhunderts von ihren altbewährten Auffassungen, wie ein Text auszusehen habe, verabschieden müssen.
Bei dem Gegenstand der Textlinguistik handelt es sich um ein relativ neues Gebiet der linguistischen Forschung, welches sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts behaupten konnte. Sie befasst sich einerseits mit der Abgrenzung und Klassifizierung von Texten und untersucht andererseits den Bau sowie die Struktur dieser. Historisch betrachtet lassen sich innerhalb der Textlinguistik zwei Hauptrichtungen verorten, die unterschiedliche Zielsetzungen entwickelt haben und demzufolge auch den Untersuchungsgegenstand dieser Disziplin, nämlich Texte, gegensätzlich definieren. Den Anfang im Bereich der Textlinguistik machte in den 1960er Jahren die sprachsystematisch ausgerichtete Disziplin, welche den Aspekt der langue vertritt und gegenüber der generativen Transformationsgrammatik behauptet, dass nicht der Satz als oberste linguistische Bezugseinheit diene, sondern der Text und es demzufolge wichtig wäre, dass sich die linguistische Analyse stärker auf ihn richte. In den 1970er Jahren entstand eine zweite Richtung der Textlinguistik, ein „kommunikationsorientierter“ Ansatz. Dieser warf der ersten Richtung vor, Texte zu sehr als isolierte statische Objekte zu handhaben und nicht ausreichend zu berücksichtigen, dass Texte immer in Kommunikationssituationen eingebunden seien.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Text und Textlinguistik
- Multimodalität im 21. Jahrhundert
- Korpusanalyse
- Beispiel 1 - „Held der Waage“
- Beispiel 2 - „Heldin der Waage“
- Schlussbetrachtung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Proseminararbeit untersucht das Phänomen „multimodale Texte“ im 21. Jahrhundert, insbesondere im Kontext von Gesundheits- und Fitnessmagazinen. Sie beleuchtet die Veränderungen im Verständnis von Textlichkeit angesichts der zunehmenden multimodalen Kommunikation und analysiert, inwiefern Text-Bild-Konglomerate noch als „Texte“ bezeichnet werden können. Die Arbeit setzt sich zusammen aus einem theoretischen Teil über Text und Textlinguistik sowie einer praktischen Analyse von zwei Beispielkorpora.
- Definition und Entwicklung des Textbegriffs in der Textlinguistik
- Charakteristika von multimodalen Texten und ihre Bedeutung im 21. Jahrhundert
- Analyse der Textualitätsmerkmale und -kriterien in Text-Bild-Konglomeraten
- Untersuchung von Textaufbau, Textsorte und Textfunktion in den Beispielkorpora
- Schlussfolgerungen über das Verständnis von Textlichkeit in einer zunehmend multimodalen Medienlandschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit und ihre Relevanz in der heutigen Zeit vor. Sie erläutert den Aufbau und die Schwerpunkte der Arbeit.
Das Kapitel „Text und Textlinguistik“ gibt einen Überblick über die Entwicklung und Definition des Textbegriffs in der linguistischen Forschung. Es werden verschiedene Ansätze zur Textdefinition vorgestellt und die Bedeutung von Textualitätsmerkmalen für die Identifizierung von Texten beleuchtet.
Das Kapitel „Multimodalität im 21. Jahrhundert“ behandelt das Phänomen der multimodalen Kommunikation und analysiert, inwiefern diese neuen Formen der Kommunikation traditionelle Textkonzepte in Frage stellen.
Das Kapitel „Korpusanalyse“ präsentiert die Untersuchungsergebnisse zweier Beispielkorpora aus den Magazinen „Men's Health“ und „Womens Health“. Die Analyse untersucht die Textualitätsmerkmale der Korpora und beleuchtet die Rolle von Text und Bild in der Vermittlung von Inhalten.
Schlüsselwörter
Textlinguistik, Textbegriff, Multimodalität, Text-Bild-Konglomerate, Textualitätsmerkmale, Korpusanalyse, Gesundheits- und Fitnessmagazine, „Men's Health“, „Womens Health“, Kommunikationslandschaft
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus dieser Arbeit zum Thema Multimodalität?
Die Arbeit untersucht, wie Text-Bild-Kombinationen in modernen Fitnessmagazinen (wie Men's Health und Women's Health) das traditionelle Verständnis von „Text“ verändern.
Was versteht man unter einem multimodalen Text?
Ein multimodaler Text ist ein „Text-Bild-Konglomerat“, bei dem Informationen nicht nur über Schrift, sondern auch über visuelle Elemente vermittelt werden.
Welche Rolle spielt die Textlinguistik in dieser Untersuchung?
Die Textlinguistik liefert die Kriterien (Textualitätsmerkmale), um zu prüfen, ob moderne Medienformate überhaupt noch als Texte im wissenschaftlichen Sinne gelten können.
Was ist das Ergebnis der Korpusanalyse?
Die Analyse zeigt, inwiefern Textaufbau, Sorte und Funktion in Magazinartikeln den traditionellen Kriterien gerecht werden oder diese erweitern.
Müssen Leser ihr Verständnis von Texten im 21. Jahrhundert ändern?
Ja, die Arbeit legt nahe, dass sich durch die zunehmende Multimodalität die Erwartungen an das Aussehen und die Struktur von Texten grundlegend gewandelt haben.
- Quote paper
- Mag. Stefan Loidl (Author), 2017, Multimodale Texte heute. Analyse der Multimodalität am Beispiel von Fitnessmagazinen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/367882