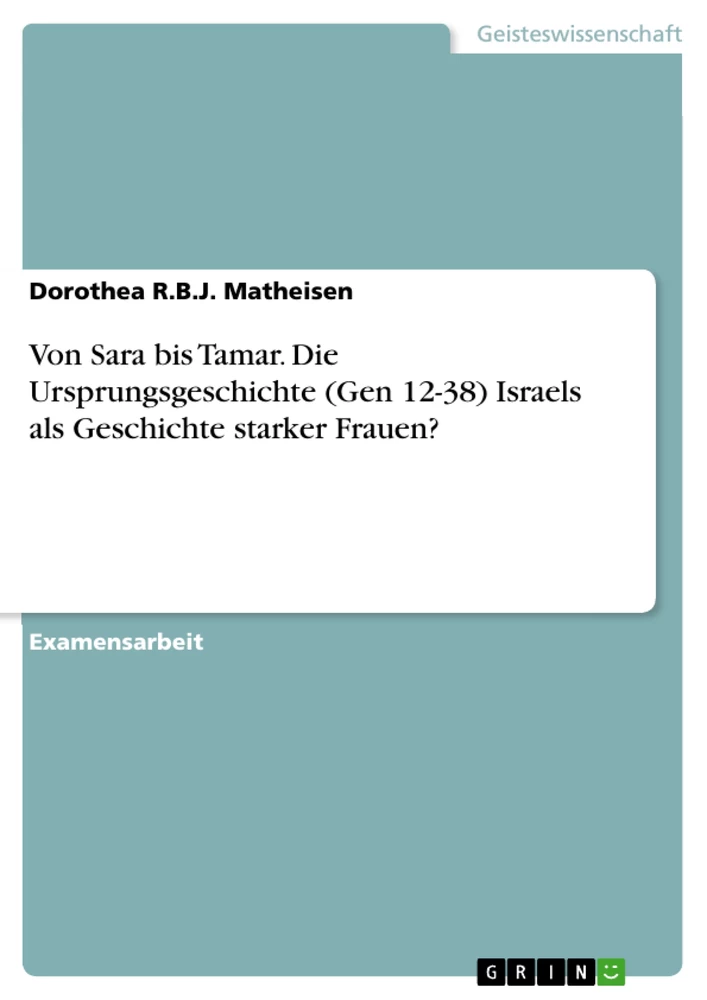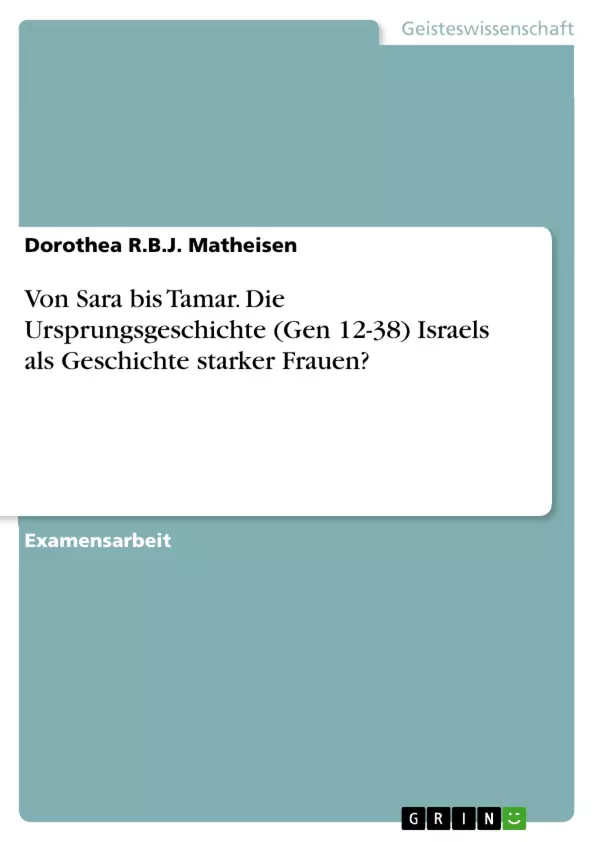Die Ursprungsgeschichte Israels, die im Buch Genesis, dem ersten der fünf Bücher Mose, tradiert wird, ist weithin als Geschichte von Männern über Männer bekannt. Im Großteil der alttestamentlichen Forschung wird der Erzählkomplex Gen 12ff. daher auch als „Väter-“, „Erzväter“ oder „Patriarchen-Erzählung“ bezeichnet. Die Verwendung solcher Termini, besonders in älteren exegetischen Kommentaren zu Gen 12 und den folgenden Abschnitten, suggeriert, dass die Anfangsgeschichte Israels ausschließlich von Männern getragen und geschrieben wurde. Die feministische Theologin Irmtraud Fischer spricht in diesem Zusammenhang provokativ von der Geschichte Israels als His-Story.
Dieser androzentrischen Auslegungstradition, die ausschließlich den Mann in den Blick nimmt, wird aus feministischer Perspektive vorgeworfen, die in der Ursprungsgeschichte auftretenden Frauengestalten zu marginalisieren und ihre Bedeutung auf ihre Beziehung zu den Männern – als Ehefrauen oder Töchter – zu begrenzen. Diese Formen der Ausgrenzung von Frauen aus der Geschichte Israels hat bewirkt, dass die in den Texten vorkommenden Frauenfiguren als handelnde Objekte in der Regel kaum beachtet und ihre Leistungen in Bezug auf den Fortgang der Geschichte zugunsten der männlichen Figuren abqualifiziert worden sind.
Angesichts der ambivalenten und zum Teil höchst heterogenen Einschätzung innerhalb der exegetischen Forschung in Bezug auf die in Gen 12ff. auftretenden Frauengestalten hat die vorliegende Arbeit die Aufgabe, die überlieferten weiblichen Erzählfiguren vorzustellen und deren Bedeutung für die Geschichte Israels anhand der biblischen Texte, insbesondere der tradierten Frauengeschichten, zu erschließen und so ihre Rolle in der Volkswerdung Israels zu rekonstruieren. Im Rahmen der exegetischen Betrachtungen soll dabei vor allem die Frage nach den gezeichneten Geschlechterbildern prioritär behandelt werden. Inwieweit die Ursprungsgeschichte Israels schließlich als Geschichte starker Frauen gelesen werden kann, soll abschließend bewertet werden. Bevor jedoch im Rahmen der vorliegenden Arbeit die exegetische Analyse der alttestamentlichen Frauengeschichten unter besonderer Berücksichtigung der genannten Aspekte und im Besonderen auch des zeitgeschichtlichen Hintergrundes durchgeführt wird, sollen zunächst grundsätzliche, für die Themenstellung relevante Voraussetzungen sowie methodische Vorüberlegungen dargestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsgeschichtliche Verortung und methodische Vorüberlegungen
- Frauengestalten in der Ursprungsgeschichte Israels - ein kurzer Überblick
- Frauen als tragende Figuren der Handlung
- Sara - zwischen Verheißung und Warten auf Erfüllung (Gen 12-23)
- Rebekka - eine Frau, die weiß, was sie will (Gen 24-28)
- Rahel und Lea – Rivalität zwischen ungleichen Schwestern (Gen 29-35)
- Frauen als Opfer struktureller, physischer und sexueller Gewalt
- Hagar - eine Frau am Rande der Verheißung (Gen 16,1-16; 21,9-21)
- Die Töchter Lots - Frauen, die sich zu helfen wissen (Gen 19)
- Silpa und Bilha – die Leihmütter und Nebenfrauen Jakobs (Gen 30-33.35)
- Dina – stummes Opfer männlicher Verfügungsgewalt (Gen 34)
- Tamar - eine Frau kämpft hartnäckig für ihr Recht (Gen 38)
- Zusammenfassung und Bewertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle von Frauen in der Ursprungsgeschichte Israels (Genesis 12-38), um deren Bedeutung für die Geschichte Israels zu erforschen und gängige androzentrische Interpretationen zu hinterfragen. Sie rekonstruiert die Rolle der Frauen in der Volkswerdung Israels und analysiert die dargestellten Geschlechterbilder.
- Die Darstellung von Frauen als starke und handelnde Figuren in der Ursprungsgeschichte.
- Die Analyse von Frauenfiguren als Opfer von Gewalt und Unterdrückung.
- Die kritische Auseinandersetzung mit traditionellen exegetischen Interpretationen.
- Die Rekonstruktion der Rolle von Frauen in der Entstehung des Volkes Israel.
- Die Untersuchung der in den Texten präsenten Geschlechterbilder.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der Bedeutung von Frauen in der Ursprungsgeschichte Israels. Sie kritisiert die bisherige androzentrische Ausrichtung der Forschung und legt den Fokus auf die oft vernachlässigten weiblichen Erzählfiguren. Die Autorin argumentiert, dass diese Frauen nicht nur passive Objekte, sondern aktive Gestalten mit eigenständigem Einfluss auf den Geschichtsverlauf sind. Der Ansatz der Arbeit liegt in der feministischen Exegese, die darauf abzielt, die oft marginalisierten Frauenperspektiven zu beleuchten und ihre Rolle in der Geschichte Israels neu zu bewerten.
Forschungsgeschichtliche Verortung und methodische Vorüberlegungen: Dieses Kapitel verortet die vorliegende Arbeit in der feministischen Exegese und diskutiert die unterschiedlichen Interpretationen der weiblichen Figuren in Genesis 12-38. Es wird die methodische Vorgehensweise erläutert, die darauf abzielt, die Bedeutung der weiblichen Erzählfiguren für die Geschichte Israels zu erschließen und die in den Texten dargestellten Geschlechterbilder zu analysieren. Die Autorin betont die Notwendigkeit, den zeitgeschichtlichen Kontext zu berücksichtigen, um die komplexen Rollen der Frauen in der Ursprungsgeschichte besser zu verstehen.
Frauen als tragende Figuren der Handlung: Dieses Kapitel analysiert ausgewählte Frauenfiguren – Sara, Rebekka, Rahel und Lea – als aktive und entscheidende Akteure in der Ursprungsgeschichte. Es werden ihre Handlungen, Entscheidungen und Beziehungen zu den männlichen Figuren im Detail untersucht, um ihre Bedeutung für den Erzählfluss und die Entwicklung der Geschichte Israels zu beleuchten. Der Fokus liegt auf der Herausarbeitung ihrer Handlungsfähigkeit und ihres Einflusses auf die Erzählung, um die traditionellen Interpretationen, welche sie als passive Begleiterinnen der männlichen Protagonisten darstellen, zu widerlegen.
Frauen als Opfer struktureller, physischer und sexueller Gewalt: Dieses Kapitel befasst sich mit Frauenfiguren, die Opfer von Gewalt und Unterdrückung werden. Die Analyse konzentriert sich auf Hagar, die Töchter Lots, Silpa und Bilha sowie Dina und Tamar. Der Fokus liegt auf den unterschiedlichen Formen der Gewalt, die diese Frauen erfahren, sowie auf ihren Reaktionen und Strategien, mit diesen Situationen umzugehen. Es wird beleuchtet, wie die Erzählungen diese Gewaltverhältnisse darstellen und welche Bedeutung sie für das Verständnis der Geschlechterverhältnisse in der Ursprungsgeschichte haben. Die Autorin untersucht dabei auch die Frage, wie diese Leidensgeschichten in den Gesamtkontext der Ursprungsgeschichte einzuordnen sind.
Schlüsselwörter
Ursprungsgeschichte Israels, Genesis 12-38, Frauengestalten, feministische Exegese, Geschlechterrollen, Gewalt, Unterdrückung, Sara, Rebekka, Rahel, Lea, Hagar, Töchter Lots, Silpa, Bilha, Dina, Tamar, Her-Story, His-Story, Patriarchenerzählung, Volkswerdung Israels.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Frauen in der Ursprungsgeschichte Israels
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die Rolle von Frauen in der Ursprungsgeschichte Israels (Genesis 12-38). Sie hinterfragt gängige, androzentrische Interpretationen und beleuchtet die Bedeutung der Frauen für die Geschichte Israels. Der Fokus liegt auf der Rekonstruktion der Rolle der Frauen in der Volkswerdung Israels und der Analyse der dargestellten Geschlechterbilder.
Welche Frauenfiguren werden im Einzelnen betrachtet?
Die Arbeit analysiert verschiedene Frauenfiguren aus der Genesis, darunter Sara, Rebekka, Rahel, Lea, Hagar, die Töchter Lots, Silpa, Bilha, Dina und Tamar. Sie werden sowohl als starke, handelnde Figuren als auch als Opfer von Gewalt und Unterdrückung betrachtet.
Welche Methoden werden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet eine feministische Exegese, um die oft marginalisierten Frauenperspektiven zu beleuchten und ihre Rolle in der Geschichte Israels neu zu bewerten. Sie berücksichtigt den zeitgeschichtlichen Kontext und analysiert die Handlungen, Entscheidungen und Beziehungen der Frauenfiguren im Detail.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung, Forschungsgeschichtliche Verortung und methodische Vorüberlegungen, Frauen als tragende Figuren der Handlung, Frauen als Opfer struktureller, physischer und sexueller Gewalt und Zusammenfassung und Bewertung. Ein Inhaltsverzeichnis gibt einen detaillierten Überblick über die einzelnen Kapitel und Unterkapitel.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Darstellung von Frauen als starke und handelnde Figuren in der Ursprungsgeschichte zu untersuchen, Frauenfiguren als Opfer von Gewalt und Unterdrückung zu analysieren, traditionelle exegetische Interpretationen kritisch zu hinterfragen, die Rolle von Frauen in der Entstehung des Volkes Israel zu rekonstruieren und die in den Texten präsenten Geschlechterbilder zu untersuchen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ursprungsgeschichte Israels, Genesis 12-38, Frauengestalten, feministische Exegese, Geschlechterrollen, Gewalt, Unterdrückung, Sara, Rebekka, Rahel, Lea, Hagar, Töchter Lots, Silpa, Bilha, Dina, Tamar, Her-Story, His-Story, Patriarchenerzählung, Volkswerdung Israels.
Welche Kernaussagen werden in den einzelnen Kapiteln gemacht?
Die Einleitung legt die Forschungsfrage und den feministischen Ansatz fest. Das Kapitel zur Forschungsgeschichte verortet die Arbeit methodisch. Die Kapitel zu den Frauenfiguren analysieren diese sowohl als handelnde Personen als auch als Opfer. Das abschließende Kapitel fasst die Ergebnisse zusammen und bewertet sie.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für alle interessant, die sich mit der Ursprungsgeschichte Israels, feministischer Exegese und Geschlechterrollen in biblischen Texten auseinandersetzen. Sie richtet sich insbesondere an Wissenschaftler*innen, Studierende der Theologie und alle, die sich für eine kritische Auseinandersetzung mit biblischen Erzählungen interessieren.
- Quote paper
- Dorothea R.B.J. Matheisen (Author), 2016, Von Sara bis Tamar. Die Ursprungsgeschichte (Gen 12-38) Israels als Geschichte starker Frauen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/367926