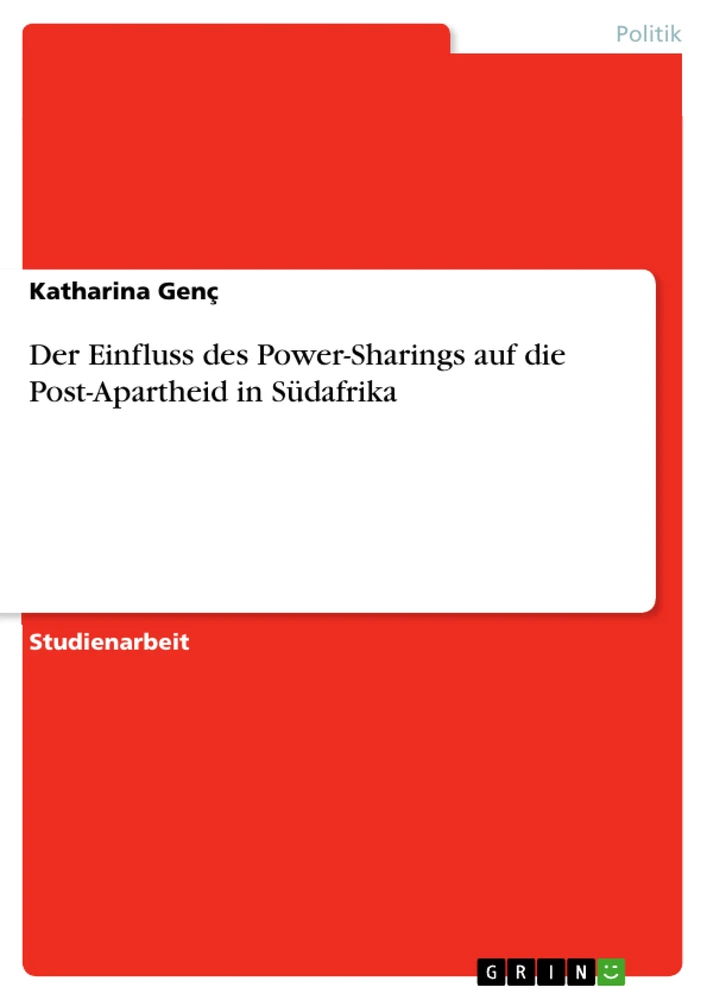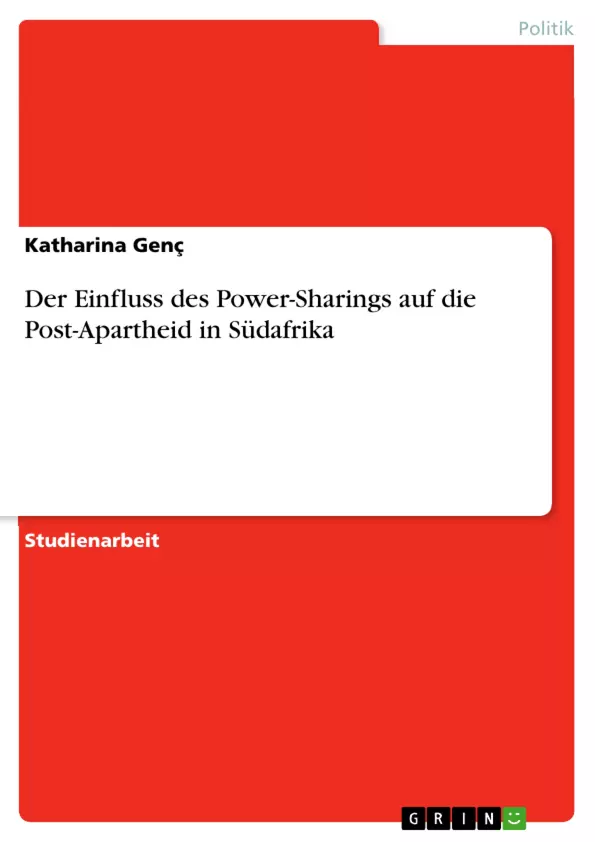Südafrika gilt als eines der aufstrebenden Länder Afrikas. In den letzten zwanzig Jahren hat ein deutlicher Wandel auf ökonomischer, politischer, ökologischer und sozialer Ebene stattgefunden. Demokratie, Gleichberechtigung, Meinungsfreiheit sowie viele weitere Merkmale moderner Gesellschaften sind in der Republik Südafrika nach jahrzehntelanger Apartheid eingerichtet worden. Doch wie ist die Post-Apartheid zu bewerten? Ist eine stabile Demokratie innerhalb des kulturell und ethnisch gespaltenen Landes errichtet worden? In dieser Arbeit soll schrittweise geklärt werden, inwiefern das Konzept des Power-Sharings zur Post-Apartheid in Südafrika beigetragen hat.
Dazu wird zunächst das theoretische Grundgerüst, das Power-Sharing, erläutert. Hierbei findet eine grundsätzliche Konzentration auf die Grundelemente des Power-Sharings nach Arend Lijphardt statt, welcher als Begründer des Modells gilt. Anschließend wird die Etablierung der Apartheid in Südafrika schrittweise erläutert. Dies ist zum einen ein relevantes Hintergrundwissen, da die Apartheid der Grund für die ethnische Spaltung der Gesellschaft in Südafrika ist und damit auch der Grund für die Entscheidung, das Power-Sharing in Südafrika anzuwenden. Desweiteren ist die geschichtliche Betrachtung ebenso relevant um die politische Entwicklung der Post-Apartheid angemessener nachvollziehen zu können.
Im Anschluss erfolgt die Anwendung des Modells des Power-Sharings auf die Praxis. Die praktische Umsetzung der vier Grundelemente, „segmented authority”, „grand coalition“, „mutual veto rights“ sowie „proportional election” in der Republik Südafrika wird erläutert. Im vorletzten Kapitel erfolgt dann die Analyse, inwiefern das Power-Sharing zur Post-Apartheid in Südafrika beigetragen hat. Hierzu werden verschiedene Fachzeitschriftenartikel von Autoren mit gleicher, sowie gegensätzlicher Meinung hinzugezogen, um ein umfassendes Ergebnis zu erhalten. Im Fazit werden die Hauptargumente der Analyse resümiert und gegeneinander abgewägt . Desweiteren wird ein Ausblick auf die mögliche Weiterentwicklung auf politischer Ebene gegeben, anhand der letzten nationalen Wahlen im Jahre 2009.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Modell des Power Sharings
- Entstehung der Apartheid in Südafrika
- Konzeptionelle Umsetzung des Power Sharings in Südafrika
- Auswirkungen des Power Sharings für die Post-Apartheid
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht, inwiefern das Konzept des Power Sharings zur Etablierung einer stabilen Demokratie in der Post-Apartheid-Ära Südafrikas beigetragen hat. Sie beleuchtet die theoretischen Grundlagen des Power Sharings, analysiert die Entstehung der Apartheid als historischen Kontext und untersucht die praktische Umsetzung des Power Sharings in Südafrika.
- Theoretische Grundlagen des Power Sharings
- Entstehung und Auswirkungen der Apartheid in Südafrika
- Praktische Umsetzung des Power Sharings in Südafrika
- Analyse der Auswirkungen des Power Sharings auf die Post-Apartheid
- Bewertung der Stabilität und Nachhaltigkeit der Post-Apartheid-Demokratie
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel stellt den Forschungsgegenstand und die Zielsetzung der Arbeit vor. Es diskutiert die Bedeutung der Post-Apartheid-Entwicklung in Südafrika und die Notwendigkeit, die Rolle des Power Sharings in diesem Kontext zu untersuchen.
- Modell des Power Sharings: Dieses Kapitel erläutert die theoretischen Grundlagen des Power Sharings als Modell zur Stabilisierung von Demokratien in Gesellschaften mit tiefen sozialen und politischen Spaltungen. Es fokussiert auf die zentralen Elemente des Power Sharings nach Arend Lijphart, wie „grand coalition”, „mutual veto rights”, „segmented authority” und „proportional election”.
- Entstehung der Apartheid in Südafrika: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung und die Auswirkungen der Apartheid auf die südafrikanische Gesellschaft. Es zeigt auf, wie die Apartheid zur ethnischen Spaltung der Gesellschaft führte und den Grund für die Anwendung des Power Sharings in Südafrika legte.
- Konzeptionelle Umsetzung des Power Sharings in Südafrika: Dieses Kapitel untersucht die praktische Umsetzung der vier Grundelemente des Power Sharings in der südafrikanischen Politik. Es analysiert, wie die Elemente in der Verfassung und den politischen Institutionen des Landes verankert wurden und in der Praxis funktionieren.
Schlüsselwörter
Power Sharing, Konsociational Democracy, Apartheid, Post-Apartheid, Südafrika, Demokratie, ethnische Spaltung, politische Stabilität, politische Partizipation, Minderheitenrechte, „grand coalition”, „mutual veto rights”, „segmented authority”, „proportional election”.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Konzept des Power-Sharings in Südafrika?
Power-Sharing ist ein Modell zur Stabilisierung von Demokratien in gespaltenen Gesellschaften, das auf Machtteilung zwischen verschiedenen ethnischen oder kulturellen Gruppen basiert.
Welche Rolle spielen die Theorien von Arend Lijphart?
Lijphart gilt als Begründer des Modells. Die Arbeit konzentriert sich auf seine Elemente wie die Große Koalition, gegenseitige Vetorechte und Proportionalität.
Warum wurde Power-Sharing für die Post-Apartheid gewählt?
Durch die jahrzehntelange Apartheid war die südafrikanische Gesellschaft tief ethnisch gespalten. Power-Sharing sollte eine stabile Demokratie trotz dieser Spannungen ermöglichen.
Wie wurde das Modell praktisch in Südafrika umgesetzt?
Die Umsetzung erfolgte durch verfassungsrechtliche Instrumente wie proportionale Wahlen, segmentierte Autorität und die Einbindung verschiedener Gruppen in die Regierung.
Wie stabil ist die südafrikanische Demokratie heute?
Die Arbeit analysiert kritisch die Erfolge und Herausforderungen der Post-Apartheid und gibt einen Ausblick auf die politische Weiterentwicklung seit den Wahlen 2009.
- Quote paper
- Katharina Genç (Author), 2011, Der Einfluss des Power-Sharings auf die Post-Apartheid in Südafrika, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/367939