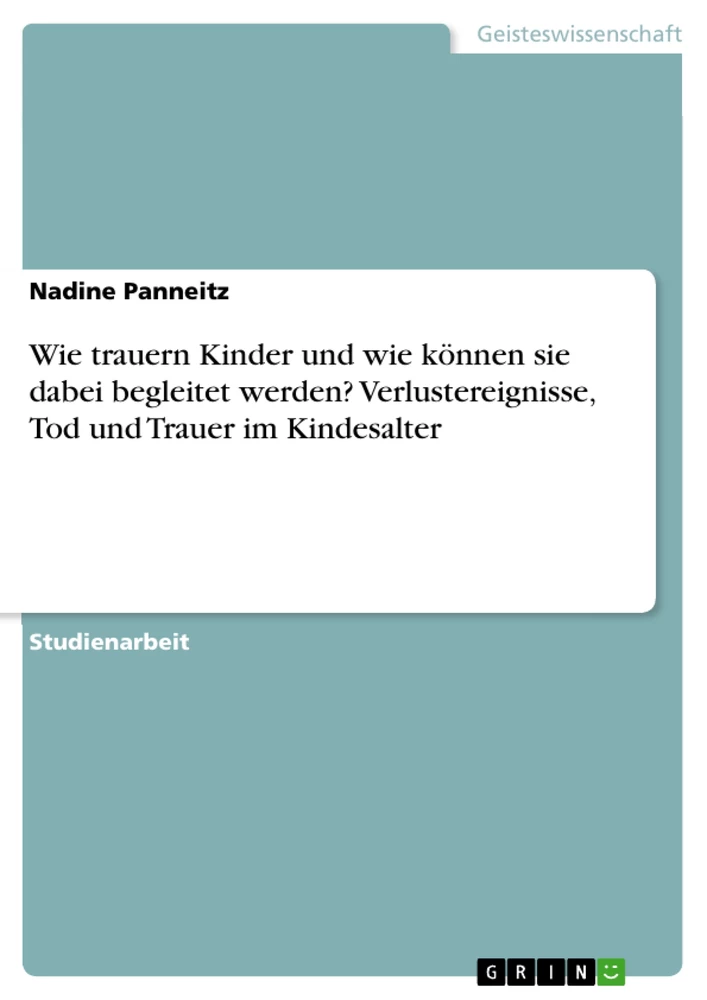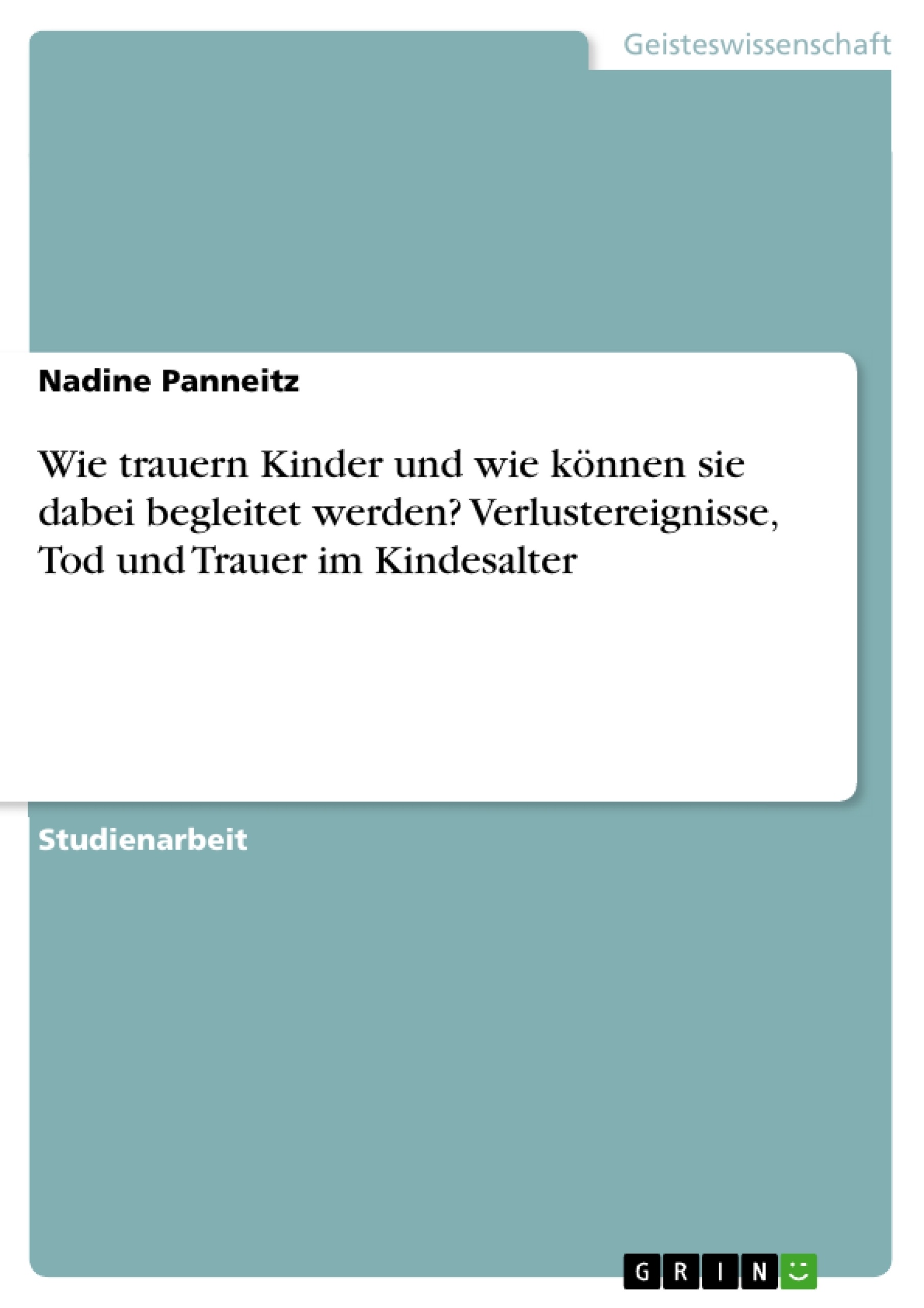Kindern zu vermitteln, dass jemand gestorben ist, löst oft bei Erwachsenen Hilflosigkeit aus. Dennoch ist es wichtig, Kinder über Todesvorgänge zu informieren und ihnen Möglichkeiten aufzuzeigen, mit den Themen Sterben, Tod und Trauer umzugehen. Ein Kind in dieser Angelegenheit so zu behandeln als sei es zu klein, resultiert in Verunsicherung und Angst vor dieser Thematik. Diese Arbeit bietet einen Wegweiser zu möglichen Reaktionen trauernder Kinder und Möglichkeiten ihrer Begleitung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kinder und die Notwendigkeit zu trauern
- Tabuisierung des Todes gegenüber Kindern
- Belastung durch kindliche Verlustereignisse
- Folgen nicht bewältigter Trauer bei Kindern
- Wie Kinder trauern
- Begegnungen mit dem Tod
- Altersentsprechende Entwicklung des kindlichen Todeskonzepts
- Der Trauerprozess von Kindern
- Typische Trauerreaktionen von Kindern
- Anwendbarkeit gängiger Trauermodelle
- Begleitung trauernder Kinder
- Unterstützung im Familien- und privaten Kontext
- Pädagogische Methoden und Materialien
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Umgang von Kindern mit Trauer und Verlust. Sie beleuchtet die Notwendigkeit der Trauerarbeit für Kinder und untersucht die Auswirkungen der Tabuisierung des Todes auf ihre psychische und soziale Entwicklung. Zudem werden verschiedene Aspekte des kindlichen Trauerprozesses, altersabhängige Entwicklungen des Todeskonzepts und die Anwendbarkeit gängiger Trauermodelle auf Kinder thematisiert. Schließlich werden verschiedene Ansätze zur Begleitung trauernder Kinder im familiären, pädagogischen und therapeutischen Kontext vorgestellt.
- Tabuisierung des Todes gegenüber Kindern
- Belastung durch kindliche Verlustereignisse
- Folgen nicht bewältigter Trauer bei Kindern
- Altersentsprechende Entwicklung des kindlichen Todeskonzepts
- Anwendbarkeit gängiger Trauermodelle auf trauernde Kinder
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung thematisiert die Wichtigkeit, Kindern über den Tod aufzuklären und sie in den Trauerprozess zu begleiten, anstatt das Thema zu tabuisieren. Es wird darauf hingewiesen, dass die Tabuisierung des Todes zu Verunsicherung und Angst bei Kindern führen kann.
Das zweite Kapitel beleuchtet die Folgen der Tabuisierung des Todes für Kinder. Es werden die Auswirkungen kindlicher Verlustereignisse auf die Psyche und den Körper des Kindes diskutiert und die Bedeutung des Auslebens von Trauer hervorgehoben.
Das dritte Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Aspekten des kindlichen Trauerprozesses. Hier werden die altersabhängige Entwicklung des Todeskonzepts, typische Trauerreaktionen von Kindern und die Anwendbarkeit gängiger Trauermodelle auf Kinder untersucht.
Das vierte Kapitel widmet sich der Begleitung trauernder Kinder. Es werden verschiedene Ansätze und Methoden zur Unterstützung von Kindern im Umgang mit Trauer und Verlust vorgestellt, sowohl im familiären als auch im pädagogischen Kontext.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Kinder, Trauer, Tod, Tabuisierung, Verlust, Entwicklung des Todeskonzepts, Trauerprozess, Trauerreaktionen, Begleitung trauernder Kinder, Pädagogische Methoden, Trauerarbeit.
- Quote paper
- Nadine Panneitz (Author), 2014, Wie trauern Kinder und wie können sie dabei begleitet werden? Verlustereignisse, Tod und Trauer im Kindesalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/367946