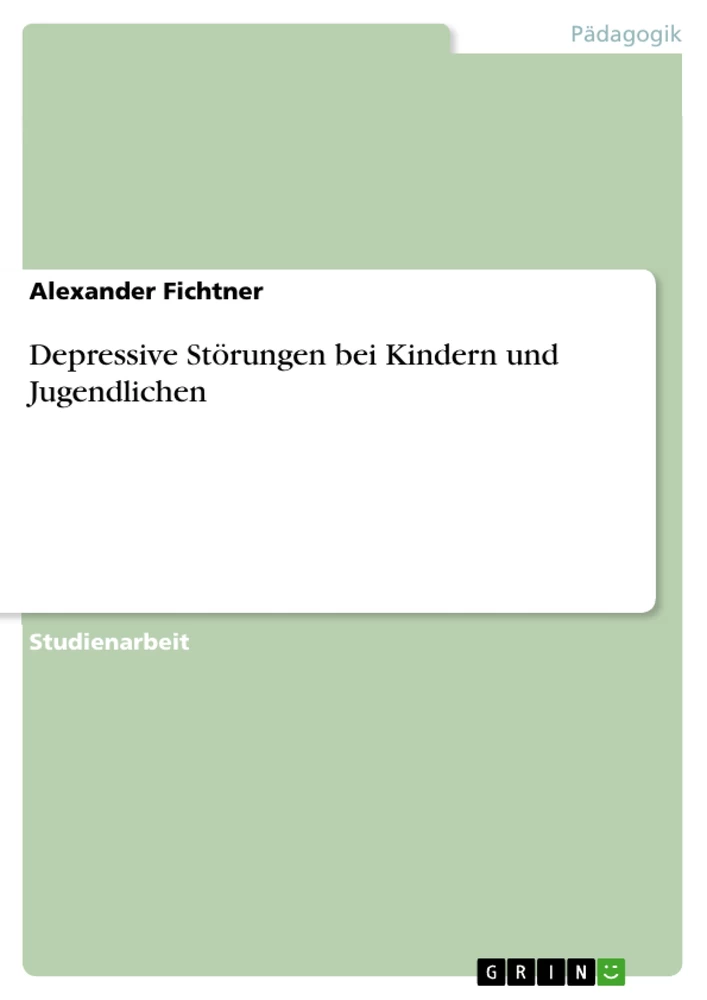Lange Zeit wurde die Depression bei Kindern und Jugendlichen nicht beschrieben. Erst in den 1970er Jahren wurden erste Studien depressiver Störungen bei Kindern und Jugendlichen veröffentlicht. Davor wollte man bei Kindern bestenfalls „depressive Ausdrucksformen“ erkennen - wie beispielsweise aggressives Verhalten, Hyperaktivität, Delinquenz – die sich aber deutlich von depressiven Symptomen Erwachsener unterschieden. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Beschreibung der Störungen und (Kern-)Symptome
- Diagnostik / Klassifikation
- Klassifikation nach ICD-10-V
- Klassifikation nach DSM-5
- Differentialdiagnostik
- Probleme der Diagnostik
- Epidemiologie und Verlauf bei depressiven Störungen
- Komorbiditäten
- Ätiologie - Erklärungskonzepte
- Intervention: Therapieformen bei depressiven Störungen / Prävention
- Psychopharmakotherapie
- Kognitive Verhaltenstherapie
- Interpersonale Therapie & Familientherapeutischer Ansatz
- Therapiesetting
- Prävention
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit depressiven Störungen bei Kindern und Jugendlichen. Sie beleuchtet die umfassende Thematik dieser psychischen Erkrankung, die eine hohe gesellschaftliche und wissenschaftliche Relevanz besitzt, da depressive Symptome sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern und Jugendlichen eine weit verbreitete Erkrankung darstellen und einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Menschen in der Gesellschaft haben.
- Beschreibung der Störungen und (Kern-)Symptome
- Diagnostik und Klassifikation nach ICD-10-V und DSM-5
- Epidemiologie und Verlauf
- Komorbiditäten und Ätiologie
- Intervention und Prävention
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 beschreibt depressive Störungen allgemein und verweist auf die Kernsymptome. Kapitel 3 befasst sich mit der Diagnose und Klassifikation der depressiven Störungen nach ICD-10-V und DSM-5. Kapitel 4 beschäftigt sich mit der Epidemiologie und dem Verlauf der depressiven Störungen. Kapitel 5 stellt mögliche Begleiterkrankungen (Komorbiditäten) dar. Kapitel 6 präsentiert verschiedene Erklärungskonzepte (Ätiologie). In Kapitel 7 werden schließlich unterschiedliche Interventionsmöglichkeiten vorgestellt, darunter Psychopharmakotherapie, kognitive Verhaltenstherapie, Interpersonale und Familientherapeutische Therapie sowie Therapiesetting. Darüber hinaus wird auf die Möglichkeiten der Prävention von depressiven Störungen hingewiesen.
Schlüsselwörter
Depressive Störungen, Kinder, Jugendliche, Symptome, Diagnose, Klassifikation, ICD-10-V, DSM-5, Differentialdiagnostik, Epidemiologie, Verlauf, Komorbiditäten, Ätiologie, Intervention, Therapieformen, Psychopharmakotherapie, kognitive Verhaltenstherapie, Interpersonale Therapie, Familientherapeutischer Ansatz, Therapiesetting, Prävention.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Kernsymptome einer Depression bei Kindern?
Neben gedrückter Stimmung können sich Depressionen bei Kindern auch durch aggressives Verhalten, Hyperaktivität oder schulischen Rückzug äußern.
Wie werden depressive Störungen klassifiziert?
Die Diagnose erfolgt meist nach den internationalen Klassifikationssystemen ICD-10 (bzw. ICD-11) oder dem US-amerikanischen DSM-5.
Welche Therapieformen werden empfohlen?
Empfohlen werden kognitive Verhaltenstherapie, interpersonale Therapie, familientherapeutische Ansätze und in schweren Fällen Psychopharmakotherapie.
Was bedeutet „Komorbidität“ bei Depressionen?
Es bezeichnet das gleichzeitige Auftreten weiterer psychischer Störungen, wie Angststörungen oder ADHS, neben der primären Depression.
Warum wurde Depression bei Kindern früher oft nicht erkannt?
Man glaubte lange, Kinder könnten keine Depressionen im Erwachsenensinne entwickeln, und deutete Symptome lediglich als „depressive Ausdrucksformen“.
- Arbeit zitieren
- Alexander Fichtner (Autor:in), 2017, Depressive Störungen bei Kindern und Jugendlichen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/367948