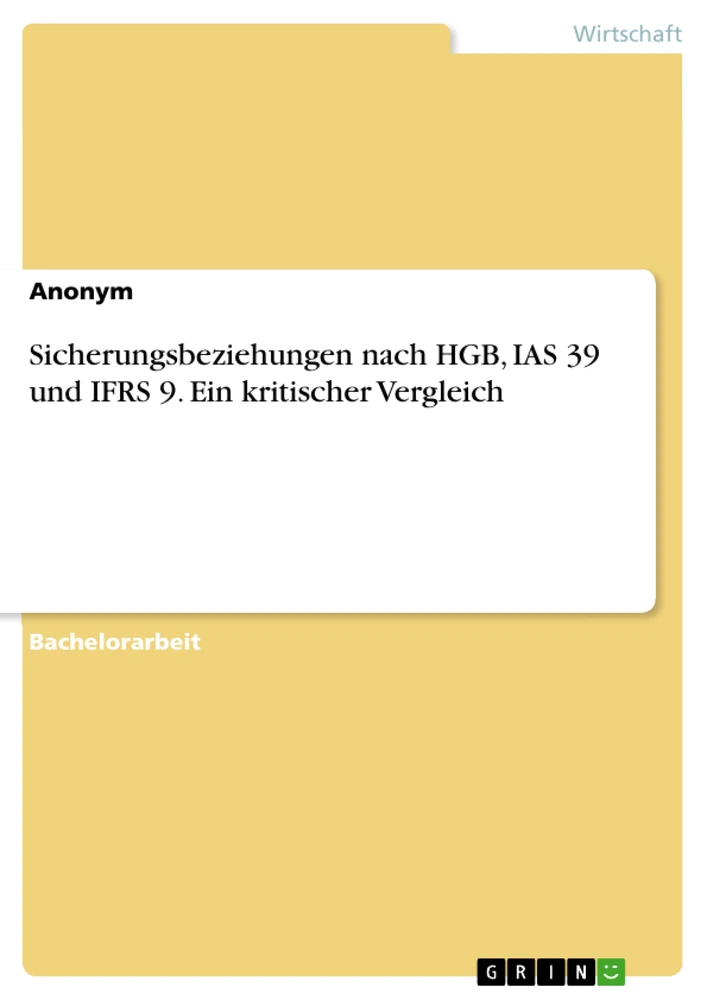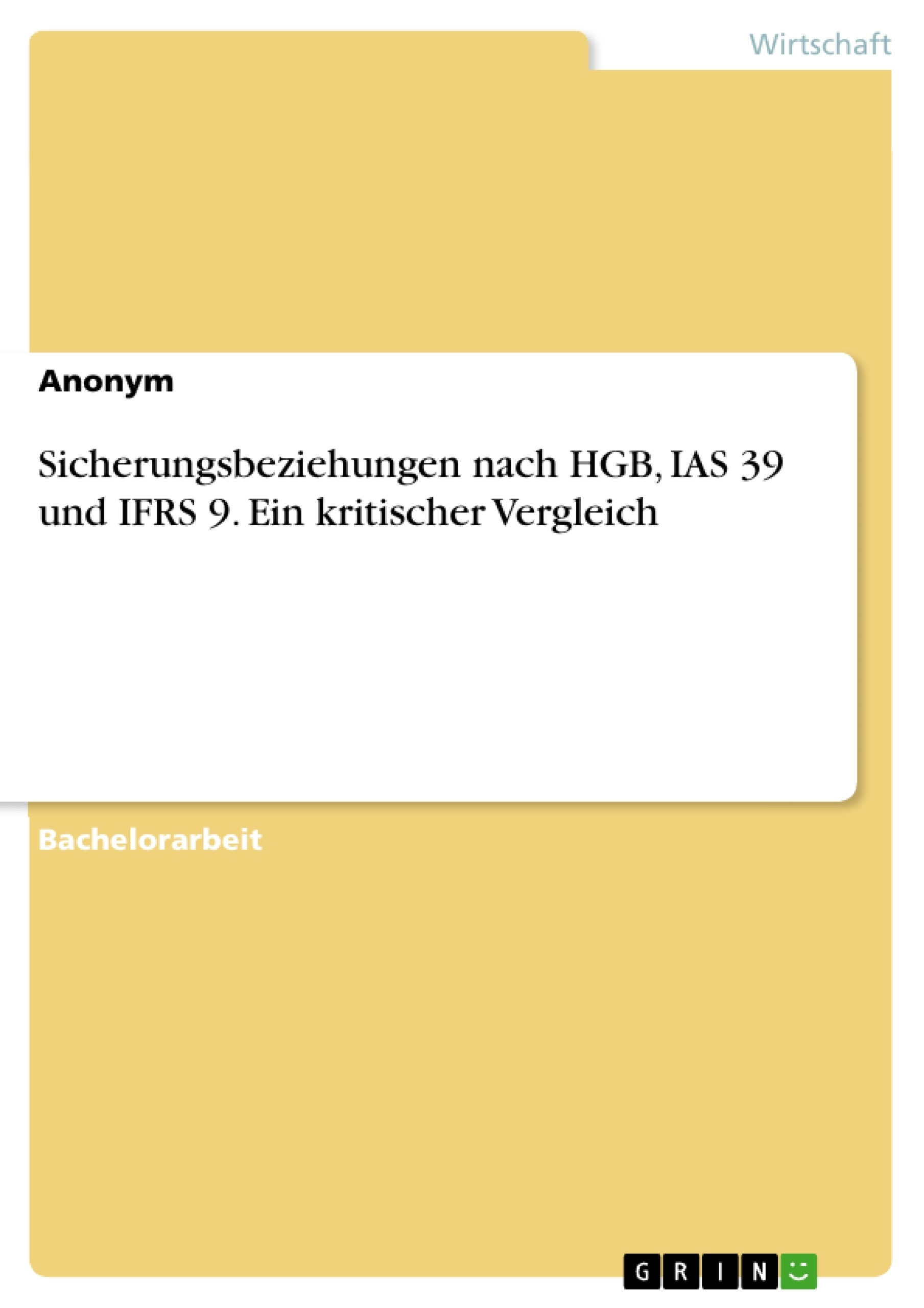Das Umfeld von Unternehmen ist durch immer höhere Komplexität bestimmt. So steigen mit zunehmender Globalisierung und Unternehmensgrößen die Kapitalverflechtungen und somit die Risiken von Unternehmen, womit das Risikomanagement zunehmen im Mittelpunkt unternehmerischen Handelns rückt. Unternehmen sind indes stets bemüht, Risiken zu vermindern. Dabei können risikobehaftete Posten mithilfe gegenläufiger Positionen (sog. Sicherungskontrakte oder auch Sicherungsgeschäfte) abgesichert werden.
Aufgrund dieser hohen Bedeutung und des Inkrafttretens des IFRS 9-Standards zum 01.01.2018, der unter anderem die Bilanzierung von sog. Sicherungsbeziehungen abdeckt, empfiehlt sich ein Vergleich, inwieweit solche Sicherungsbeziehungen in der nationalen (HGB) und internationalen (IAS 39 und IFRS 9) Rechnungslegung Anwendung finden.
Dabei geraten mit der Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen verschiedene Problemstellungen in den Fokus. Dem Bilanzierenden stellt sich insb. die Frage, welcher Umfang von risikobehafteten Positionen bzw. welche Sicherungsgeschäfte für eine solche bilanzielle Abbildung zulässig sind. Weiterhin hat der Bilanzierende die Effektivität zwischen den gegenläufigen Positionen nachzuweisen, womit weitere Problemstellungen behaftet sind.
Zur Ausarbeitung der Problemstellungen wird in dieser Arbeit anhand der in der Literatur diskutierten Lösungsansätze und den Gesetzesnormen ein kritischer Vergleich gezogen. Dabei wird in Kapitel zwei ein Überblick über grundlegende Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit der Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen gegeben. Anschließend werden in Kapitel drei bis vier die bilanzielle Abbildung und deren Voraussetzungen (einschließlich der Dokumentation) vorgestellt. In Kapitel fünf erfolgt der kritische Vergleich. In Kapitel sechs wird zum Abschluss der Arbeit ein Fazit gezogen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Grundlagen
- 2.1 Risiko und Risikomanagementsysteme
- 2.2 Sicherungsbeziehungen
- 2.3 Notwendigkeit der gesonderten Regelungen für Sicherungsbeziehungen
- 2.4 Bestands- und antizipative Sicherungsbeziehungen
- 2.5 Auslegung des Finanzinstrumentebegriffs
- 2.6 Effektivitätsanforderungen von Sicherungsbeziehungen
- 3 Sicherungsbeziehungen nach HGB
- 3.1 Anwendungsvoraussetzungen nach HGB
- 3.1.1 zulässige Grundgeschäfte nach HGB
- 3.1.2 zulässige Sicherungsgeschäfte nach HGB
- 3.1.3 Effektivitätsanforderungen nach HGB
- 3.1.4 Sicherungs- und Durchhalteabsicht nach HGB
- 3.2 Dokumentationsanforderungen nach HGB
- 3.3 Bilanzielle Abbildung nach HGB
- 3.1 Anwendungsvoraussetzungen nach HGB
- 4 Sicherungsbeziehungen nach IAS 39 und IFRS 9
- 4.1 Anwendungsvoraussetzungen
- 4.1.1 zulässige Grundgeschäfte
- 4.1.1.1 zulässige Grundgeschäfte nach IAS 39
- 4.1.1.2 zulässige Grundgeschäfte nach IFRS 9
- 4.1.2 zulässige Sicherungsgeschäfte
- 4.1.2.1 zulässige Sicherungsgeschäfte nach IAS 39
- 4.1.2.2 zulässige Sicherungsgeschäfte nach IFRS 9
- 4.1.3 Effektivitätsanforderungen
- 4.1.3.1 Effektivitätsanforderungen nach IAS 39
- 4.1.3.2 Effektivitätsanforderungen nach IFRS 9
- 4.1.4 Dokumentationsanforderungen
- 4.1.4.1 Dokumentationsanforderungen nach IAS 39
- 4.1.4.2 Dokumentationsanforderungen nach IFRS 9
- 4.1.1 zulässige Grundgeschäfte
- 4.2 Beendigung der Sicherungsbeziehung
- 4.2.1 Beendigung der Sicherungsbeziehung nach IAS 39
- 4.2.2 Beendigung der Sicherungsbeziehung nach IFRS 9
- 4.3 Bilanzielle Abbildung nach IAS 39 und IFRS 9
- 4.1 Anwendungsvoraussetzungen
- 5 Kritischer Vergleich
- 5.1 der zulässigen Grundgeschäfte
- 5.2 der zulässigen Sicherungsgeschäfte
- 5.3 der Effektivitätsanforderungen
- 5.4 der Dokumentationsanforderungen
- 5.5 der Beendigung der Sicherungsbeziehung
- 5.6 der bilanziellen Abbildung
- 5.6.1 Vorbemerkung
- 5.6.2 Kritischer Vergleich der bilanziellen Abbildung
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit einem kritischen Vergleich der Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen nach HGB, IAS 39 und IFRS 9. Ziel ist es, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der jeweiligen Regelungen aufzuzeigen und deren Auswirkungen auf die Bilanzierung zu analysieren.
- Anwendungsvoraussetzungen für Sicherungsbeziehungen nach HGB, IAS 39 und IFRS 9
- Bilanzielle Abbildung von Sicherungsbeziehungen unter den drei Regelwerken
- Effektivitätsanforderungen und deren Auswirkungen
- Dokumentationsanforderungen im Vergleich
- Kritischer Vergleich der Regelungen und deren Vor- und Nachteile
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen ein und begründet die Relevanz des Vergleichs zwischen HGB, IAS 39 und IFRS 9. Es umreißt den Aufbau der Arbeit und die Forschungsfrage.
2 Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für das Verständnis von Sicherungsbeziehungen. Es definiert zentrale Begriffe wie Risiko, Risikomanagement und Sicherungsbeziehungen selbst, erläutert die Notwendigkeit gesonderter Regelungen und differenziert zwischen Bestands- und antizipativen Sicherungsbeziehungen. Besondere Aufmerksamkeit wird der Auslegung des Finanzinstrumentebegriffs und den Effektivitätsanforderungen gewidmet, welche die Grundlage für die spätere Anwendung der Bilanzierungsvorschriften bilden. Diese Kapitel dient als Fundament für die Analyse der spezifischen Regelungen in den folgenden Kapiteln.
3 Sicherungsbeziehungen nach HGB: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) zur Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen. Es analysiert die Anwendungsvoraussetzungen, einschließlich der zulässigen Grund- und Sicherungsgeschäfte, die Effektivitätsanforderungen, die Dokumentationsanforderungen und die resultierende bilanzielle Abbildung. Es werden die spezifischen Herausforderungen und Interpretationsspielräume der HGB-Regelungen beleuchtet. Der Fokus liegt dabei auf der praktischen Anwendung der Vorschriften und den damit verbundenen Konsequenzen für die Darstellung in der Bilanz.
4 Sicherungsbeziehungen nach IAS 39 und IFRS 9: Dieses Kapitel befasst sich mit den internationalen Rechnungslegungsstandards IAS 39 und IFRS 9. Ähnlich wie im vorherigen Kapitel werden die Anwendungsvoraussetzungen, die Effektivitätsanforderungen, die Dokumentationsanforderungen sowie die bilanzielle Abbildung detailliert analysiert. Die Unterschiede zwischen IAS 39 und IFRS 9 werden herausgestellt, insbesondere hinsichtlich der Anwendungsbereiche und der Behandlung von Effektivitätsanforderungen. Der Vergleich der beiden Standards ermöglicht es, die Entwicklung der internationalen Rechnungslegung in diesem Bereich zu verstehen.
5 Kritischer Vergleich: Dieses Kapitel stellt einen umfassenden Vergleich der Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen nach HGB, IAS 39 und IFRS 9 dar. Es vergleicht die einzelnen Aspekte der Regelungen – zulässige Grundgeschäfte, Sicherungsgeschäfte, Effektivitätsanforderungen, Dokumentationsanforderungen und die Beendigung der Sicherungsbeziehung – und analysiert die jeweiligen Vor- und Nachteile. Besonders detailliert wird der kritische Vergleich der bilanziellen Abbildung unter den drei Regelwerken vorgenommen, um die Unterschiede in der Darstellung und deren Auswirkungen auf die Bilanzanalyse zu verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Sicherungsbeziehungen, HGB, IAS 39, IFRS 9, Bilanzierung, Risikomanagement, Effektivitätsanforderungen, Dokumentationsanforderungen, Bilanzielle Abbildung, kritischer Vergleich, Finanzinstrumente.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Kritischer Vergleich der Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen nach HGB, IAS 39 und IFRS 9
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Diese Bachelorarbeit führt einen kritischen Vergleich der Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen nach dem Handelsgesetzbuch (HGB), IAS 39 und IFRS 9 durch. Ziel ist die Darstellung von Unterschieden und Gemeinsamkeiten der jeweiligen Regelungen und deren Auswirkungen auf die Bilanzierung.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Anwendungsvoraussetzungen für Sicherungsbeziehungen nach HGB, IAS 39 und IFRS 9, die bilanzielle Abbildung von Sicherungsbeziehungen unter diesen drei Regelwerken, die Effektivitätsanforderungen und deren Auswirkungen, die Dokumentationsanforderungen im Vergleich sowie einen kritischen Vergleich der Regelungen inklusive deren Vor- und Nachteile.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Grundlagen (Risiko, Risikomanagement, Sicherungsbeziehungen), Sicherungsbeziehungen nach HGB, Sicherungsbeziehungen nach IAS 39 und IFRS 9, ein kritischer Vergleich der drei Regelwerke und ein Fazit. Jedes Kapitel wird in Unterkapitel unterteilt, die spezifische Aspekte der Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen behandeln.
Welche Grundlagen werden im zweiten Kapitel behandelt?
Kapitel 2 legt die theoretischen Grundlagen für das Verständnis von Sicherungsbeziehungen dar. Es definiert zentrale Begriffe wie Risiko, Risikomanagement und Sicherungsbeziehungen, erläutert die Notwendigkeit gesonderter Regelungen und unterscheidet zwischen Bestands- und antizipativen Sicherungsbeziehungen. Besonderes Augenmerk liegt auf der Auslegung des Finanzinstrumentebegriffs und den Effektivitätsanforderungen.
Wie werden die Vorschriften des HGB behandelt?
Kapitel 3 analysiert detailliert die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) zur Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen. Es untersucht die Anwendungsvoraussetzungen (zulässige Grund- und Sicherungsgeschäfte), Effektivitätsanforderungen, Dokumentationsanforderungen und die bilanzielle Abbildung. Herausforderungen und Interpretationsspielräume der HGB-Regelungen werden beleuchtet.
Wie werden IAS 39 und IFRS 9 behandelt?
Kapitel 4 befasst sich mit den internationalen Rechnungslegungsstandards IAS 39 und IFRS 9. Ähnlich wie bei HGB werden Anwendungsvoraussetzungen, Effektivitätsanforderungen, Dokumentationsanforderungen und die bilanzielle Abbildung detailliert analysiert. Die Unterschiede zwischen IAS 39 und IFRS 9, insbesondere bezüglich Anwendungsbereiche und Effektivitätsanforderungen, werden hervorgehoben.
Was beinhaltet der kritische Vergleich in Kapitel 5?
Kapitel 5 bietet einen umfassenden Vergleich der Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen nach HGB, IAS 39 und IFRS 9. Es vergleicht zulässige Grundgeschäfte, Sicherungsgeschäfte, Effektivitätsanforderungen, Dokumentationsanforderungen, die Beendigung von Sicherungsbeziehungen und die bilanzielle Abbildung. Die Vor- und Nachteile der jeweiligen Regelungen werden analysiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sicherungsbeziehungen, HGB, IAS 39, IFRS 9, Bilanzierung, Risikomanagement, Effektivitätsanforderungen, Dokumentationsanforderungen, Bilanzielle Abbildung, kritischer Vergleich, Finanzinstrumente.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2017, Sicherungsbeziehungen nach HGB, IAS 39 und IFRS 9. Ein kritischer Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/367951