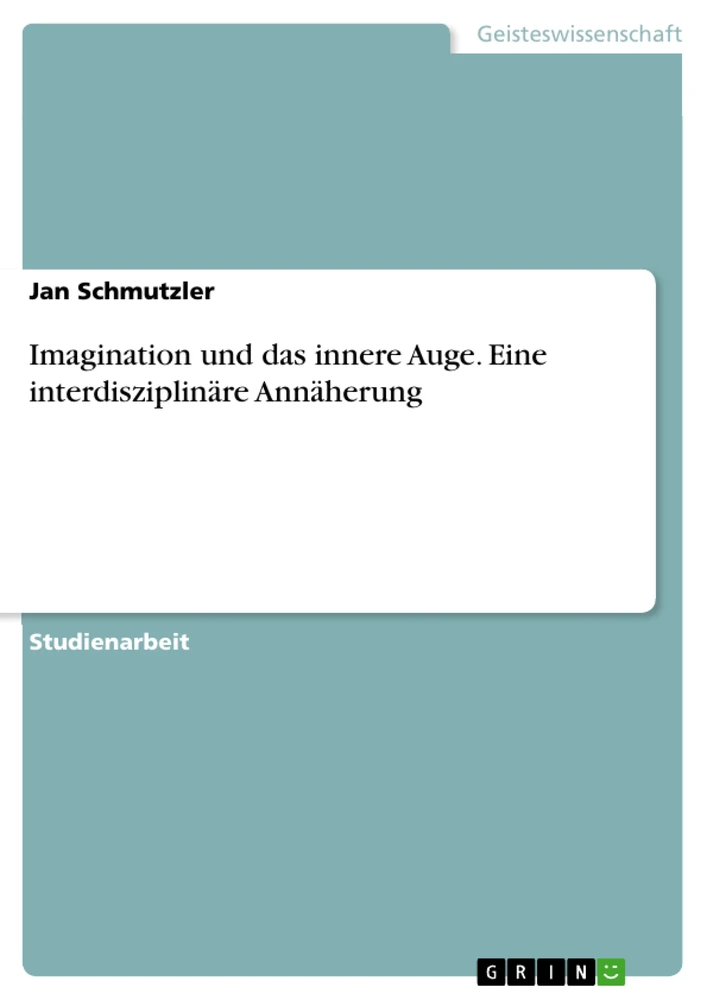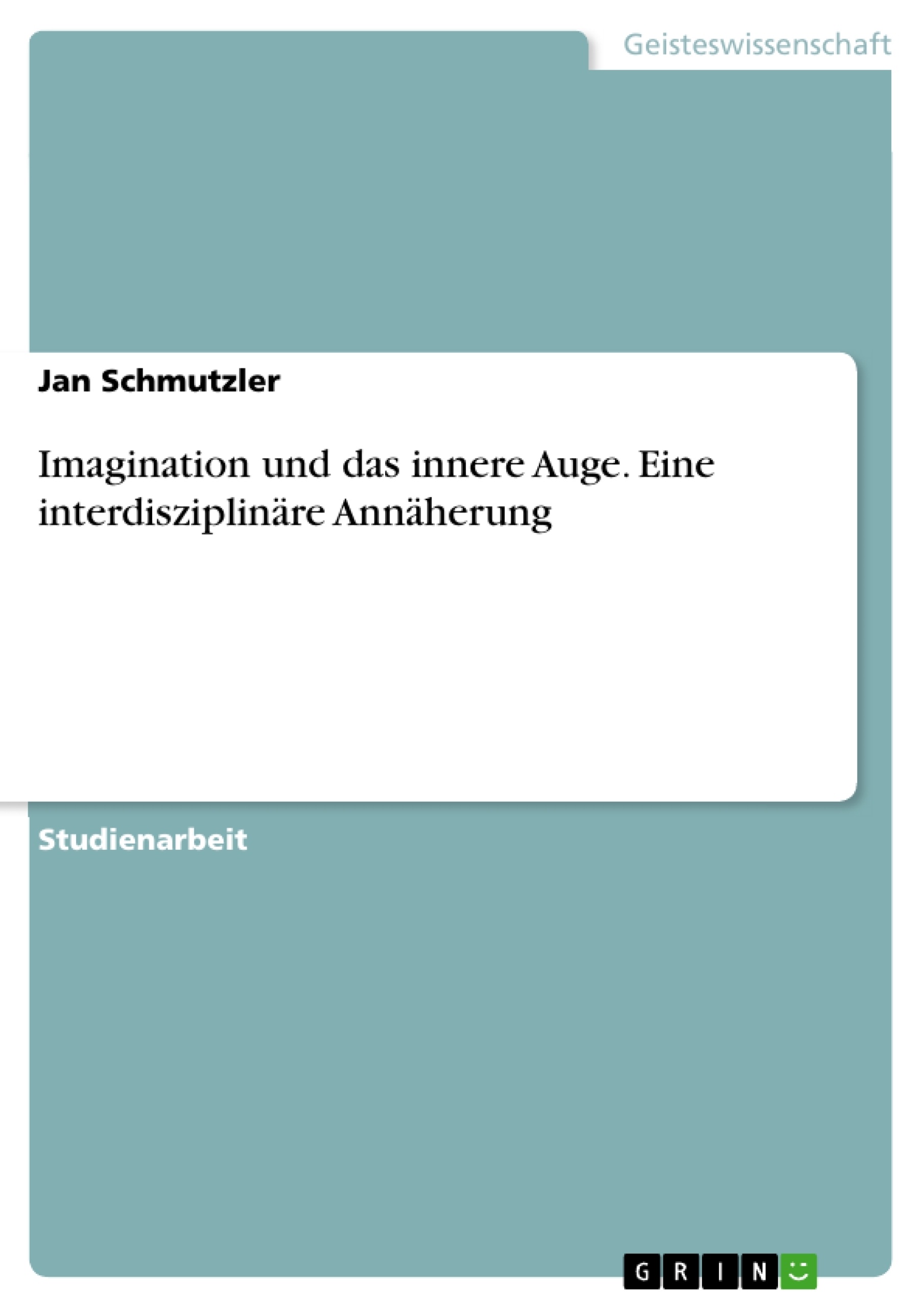Diese Arbeit soll aktuelle Forschung zur bildlichen Vorstellungskraft einordnen und diese mit philosophischen und soziologischen Perspektiven verknüpfen. Was wird unter bildlicher Vorstellung verstanden und in welchem Verhältnis steht diese zum Begriff der Imagination? Welche Unterschiede sind intersubjektiv festzustellen und welche Erklärungsmodelle stehen hierfür zur Verfügung? Wie kann und wie sollte die Gesellschaft mit diesen Erkenntnissen umgehen?
Um diesen Fragen näherzukommen werden zunächst einige Begriffe eingeführt und diskutiert. Anschließend wird näher auf die kognitionswissenschaftlichen Grundlagen eingegangen, die mit bildlicher Vorstellung in Verbindung gebracht werden. Sobald diese Grundlagen über Ausprägungen und Funktionen des inneren Auges skizziert wurden, wird im letzten Abschnitt darauf eingegangen, welche lebensweltlichen Auswirkungen diese Form der menschlichen Varianz hat und haben kann. Schlussendlich soll diese Arbeit als Plädoyer für eine gesellschaftliche Debatte über kognitive Vielfalt verstanden werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorstellungskraft
- Imagery debate
- A case of blind imagination
- Relative Existenzen
- Kognitive Vielfalt artikulieren
- Rückblick und Ausblick
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die bildliche Vorstellungskraft, ihren Stellenwert in der kognitiven Wissenschaft und ihre gesellschaftlichen Auswirkungen. Sie verbindet aktuelle Forschungsergebnisse mit philosophischen und soziologischen Perspektiven, um ein umfassenderes Verständnis zu entwickeln.
- Begriffsbestimmung und Abgrenzung von Vorstellungskraft, Imagination und Phantasie
- Kognitive Grundlagen und Funktionen der bildlichen Vorstellungskraft
- Intersubjektive Unterschiede in der bildlichen Vorstellungskraft
- Erklärungsmodelle für individuelle Unterschiede in der bildlichen Vorstellungskraft
- Gesellschaftliche Relevanz und Umgang mit kognitiver Vielfalt
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der bildlichen Vorstellungskraft ein, indem sie das Beispiel des "Schäfchenzählens" verwendet, um die scheinbar selbstverständliche Annahme gleicher Funktionsweise bei allen Menschen zu hinterfragen. Sie stellt die Forschungsgeschichte vor, erwähnt die Entwicklung des VVIQ und skizziert die Zielsetzung der Arbeit: Einordnung aktueller Forschung, Verknüpfung mit philosophischen und soziologischen Perspektiven und die Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Implikationen unterschiedlicher Ausprägungen der bildlichen Vorstellungskraft. Der Text legt den Fokus auf die Notwendigkeit einer gesellschaftlichen Debatte über kognitive Vielfalt.
Vorstellungskraft: Dieses Kapitel analysiert die Begriffslandschaft rund um Vorstellungskraft, Einbildung, Imagination und Phantasie. Es beleuchtet die Unterschiede in der Verwendung dieser Begriffe in der deutschen Sprache, insbesondere die Dimensionen des Bewusstseinsgrades (Vorstellung vs. Einbildung) und der Quelle des Bildmaterials (produktive vs. reproduktive Imagination). Der Text diskutiert die Arbeiten von Mattl & Schulte, Colello, Liang et al., Kant und Scott, um die Grenzen und Unschärfen der Unterscheidung zwischen produktiver und reproduktiver Imagination herauszuarbeiten. Es wird argumentiert, dass der Unterschied eher quantitativ ist und eine scharfe Trennung schwierig zu operationalisieren ist. Schließlich wird die Rolle der Imagination im Kontext von Kreativität und der Verbindung von Wahrnehmung und Sinn diskutiert, unter Bezugnahme auf McGinn.
Schlüsselwörter
Bildliche Vorstellungskraft, Imagination, Phantasie, Kognitive Vielfalt, VVIQ, Produktive Imagination, Reproduktive Imagination, Intersubjektivität, Gesellschaftliche Implikationen, Kreativität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Bildliche Vorstellungskraft: Kognitive Vielfalt und Gesellschaftliche Implikationen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die bildliche Vorstellungskraft, ihren Stellenwert in der kognitiven Wissenschaft und ihre gesellschaftlichen Auswirkungen. Sie verbindet aktuelle Forschungsergebnisse mit philosophischen und soziologischen Perspektiven, um ein umfassenderes Verständnis zu entwickeln. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der kognitiven Vielfalt und den damit verbundenen gesellschaftlichen Implikationen.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit umfasst die Begriffsbestimmung und Abgrenzung von Vorstellungskraft, Imagination und Phantasie; die kognitiven Grundlagen und Funktionen der bildlichen Vorstellungskraft; intersubjektive Unterschiede in der bildlichen Vorstellungskraft; Erklärungsmodelle für diese Unterschiede; und die gesellschaftliche Relevanz und den Umgang mit kognitiver Vielfalt. Die Arbeit bezieht sich auf relevante Forschungsarbeiten von Autoren wie Mattl & Schulte, Colello, Liang et al., Kant, Scott und McGinn.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es darin?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt, darunter eine Einleitung, die das Thema einführt und die Forschungsfrage formuliert; ein Kapitel zu Vorstellungskraft, das die Begriffslandschaft analysiert und Unterschiede zwischen Vorstellungskraft, Imagination und Phantasie beleuchtet; ein Kapitel zum Imagery Debate; ein Kapitel zu einem Fall blinder Imagination; ein Kapitel zu relativen Existenzen; ein Kapitel zur Artikulation kognitiver Vielfalt; einen Rückblick und Ausblick; und ein Literaturverzeichnis.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis der bildlichen Vorstellungskraft zu entwickeln, indem sie aktuelle Forschungsergebnisse in den Kontext philosophischer und soziologischer Perspektiven einordnet. Ein weiteres Ziel ist die Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Implikationen unterschiedlicher Ausprägungen der bildlichen Vorstellungskraft und die Notwendigkeit einer gesellschaftlichen Debatte über kognitive Vielfalt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bildliche Vorstellungskraft, Imagination, Phantasie, Kognitive Vielfalt, VVIQ, Produktive Imagination, Reproduktive Imagination, Intersubjektivität, Gesellschaftliche Implikationen, Kreativität.
Wie wird der VVIQ in der Arbeit behandelt?
Der VVIQ (Visual Imagery Vividness Questionnaire) wird in der Einleitung erwähnt und dient als Referenzpunkt zur Einordnung der Forschungslandschaft. Die Arbeit befasst sich jedoch nicht im Detail mit der Methodik oder den Ergebnissen des VVIQ, sondern konzentriert sich auf ein breiteres Verständnis der bildlichen Vorstellungskraft und ihrer Implikationen.
Welche Rolle spielt der Imagery Debate in der Arbeit?
Der Imagery Debate wird als ein zentrales Thema angesprochen, welches die unterschiedlichen Auffassungen über die Natur und Funktion von bildlicher Vorstellungskraft beleuchtet. Die Arbeit analysiert die verschiedenen Positionen in diesem Diskurs und trägt zur Diskussion bei.
Wie wird der Begriff der "kognitiven Vielfalt" definiert und behandelt?
Die Arbeit betont die Bedeutung der "kognitiven Vielfalt", d.h. die Unterschiede in der bildlichen Vorstellungskraft zwischen Individuen. Es werden Erklärungsmodelle für diese Unterschiede diskutiert und die gesellschaftliche Relevanz dieser Vielfalt im Umgang mit unterschiedlichen kognitiven Fähigkeiten herausgestellt.
- Quote paper
- Jan Schmutzler (Author), 2017, Imagination und das innere Auge. Eine interdisziplinäre Annäherung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/367961