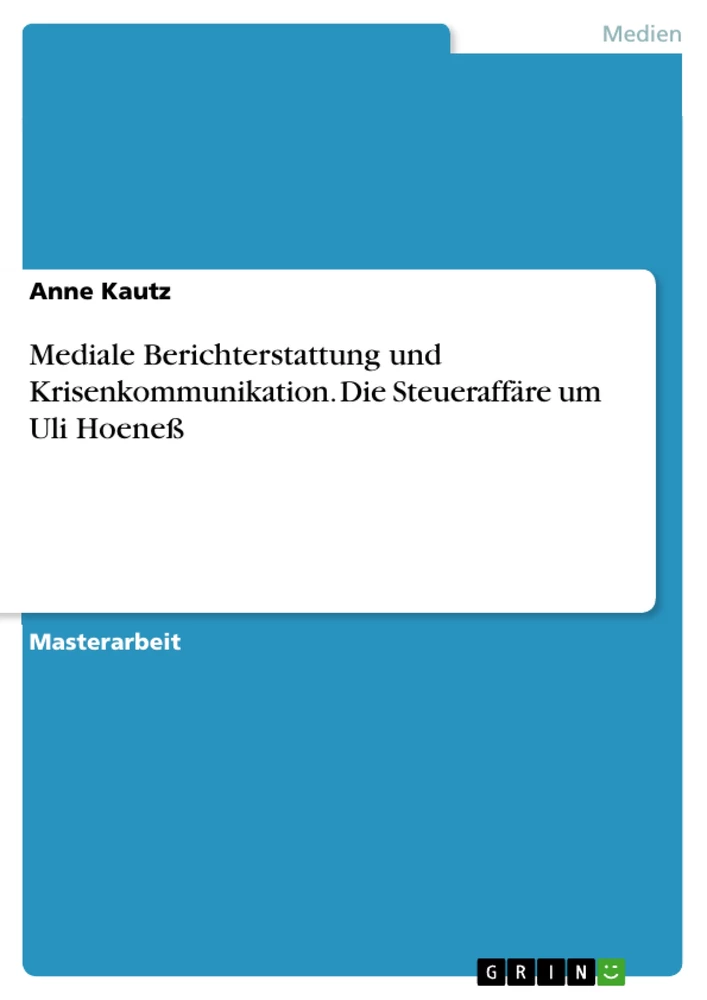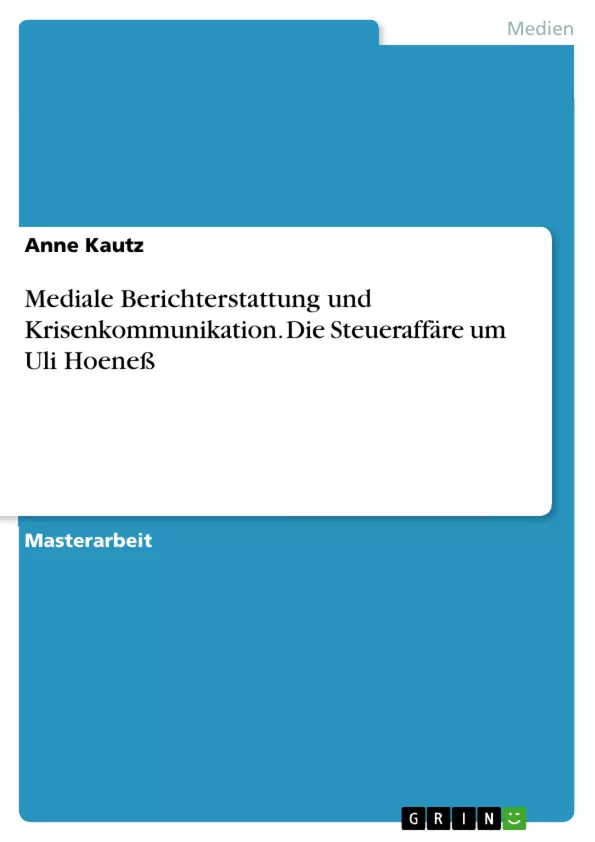Ist die Gesellschaft zunehmend kritisch geworden und fordert folglich einen transparenteren Diskurs? Beim Blick auf einschlägige Medienskandalliteratur, die Antwort auf diese Fragen sucht, stellt sich heraus, dass der Fokus primär auf einschlägigen Fallbeispielen liegt. Ein solches soll auch in dieser Arbeit dazu beitragen, ein Verständnis für die aktuelle Skandalkultur zu entwickeln.
Der hier gewählte Fall bildet dabei nicht nur aufgrund seiner materiell vorher nie dagewesenen Größendimension optimale Voraussetzungen für einen Medienskandal, auch die Person Hoeneß, bis dato als Sinnbild moralischer Integrität galt, mutet im skandalösen Kontext besonders interessant an. Um den Fall entsprechend einzubetten, untergliedert sich die vorliegende Arbeit in einen theoretischen und einen empirischen Teil. Der theoretische Teil erarbeitet die Grundlagen für die sich daran anschließende Empirie. Im Rahmen der empirischen Untersuchung werden folgende forschungsleitenden Fragen untersucht:
Fallfrage 1: Gab es über die Zeit Veränderungen hinsichtlich der Berichterstattung? (Vermutung: Erst als bekannt wurde, welche Summe er tatsächlich am Fiskus vorbeisteuerte, schlug die Stimmung um.
Fallfrage 2: Warum, so die Vermutung, skandalisieren die Medien im vorliegenden Fall nicht nach den gängigen theoretischen Mustern?
Fallfrage 3: Hoeneß wird aufgrund seiner jahrelangen medialen Erfahrung eine professionelle Krisenkommunikation prophezeit. Trifft dies wirklich ein? Wenn ja, wie hat er dies geschafft? Welche Rolle spielte hierbei der Aufsichtsrat?
Im nachfolgenden zweiten Kapitel folgt eine Einführung in die theoretischen Grundlagen. Dazu werden zunächst wichtige Begriffe definiert und diesen zugrundeliegende Faktoren diskutiert, die die Skandalberichterstattung und insbesondere medial begleitete Skandale, sogenannte Medienskandale, ausmachen.
Der zweite elementare Theoriebaustein der vorliegenden Masterarbeit befasst sich mit der Krisenkommunikation. Auch hier bildet die Begriffsbetrachtung die Basis, auf welcher die Herleitung praktikabler Maßnahmen einer gelungenen Krisenkommunikation erfolgt.
Das dritte Kapitel setzt sich mit der Causa Hoeneß auseinander, geht dabei auf die unterschiedlichen, für den Fall relevanten, Akteure ein und dokumentiert den chronologischen Ablauf des Fallbeispiels.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretische Grundlagen: Skandalberichterstattung und Krisenkommunikation
- 2.1 Medienskandal
- 2.2 Krisenkommunikation
- 3 Die Causa Hoeneß
- 3.1 Chronologie der Ereignisse
- 3.2 Akteure
- 4 Methodisches Vorgehen
- 4.1 Quantitative Analyse
- 4.2 Auswahl der Medien
- 4.3 Gibt es im Fall Hoeneß Skandalpotential?
- 4.4 Inwieweit greifen die Mechanismen eines gelungenen Skandals? / Wie sieht die entsprechende Krisenkommunikation aus?
- 4.5 Gesamtfazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die mediale Berichterstattung und die Krisenkommunikation im Fall der Steueraffäre um Uli Hoeneß. Ziel ist es, die Mechanismen eines Medienskandals anhand dieses Fallbeispiels zu untersuchen und die Strategien der Krisenkommunikation zu evaluieren. Die Analyse konzentriert sich auf die Interaktion zwischen den Akteuren (Hoeneß, Medien, FC Bayern München etc.) und die Entwicklung des Skandals über die Zeit.
- Medienskandal als soziologisches Phänomen
- Analyse der Krisenkommunikationsstrategien von Uli Hoeneß
- Rolle der Medien in der Eskalation des Skandals
- Einfluss des FC Bayern München auf die öffentliche Wahrnehmung
- Untersuchung der verschiedenen Akteure und ihrer Interaktionen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der medialen Berichterstattung und Krisenkommunikation ein und stellt die Relevanz des Fallbeispiels Uli Hoeneß heraus. Sie skizziert den Forschungsansatz und die methodischen Vorgehensweisen der Arbeit.
2 Theoretische Grundlagen: Skandalberichterstattung und Krisenkommunikation: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Analyse des Falls Hoeneß. Es definiert den Begriff des Medienskandals, beschreibt dessen Entstehung und Verlauf, identifiziert die beteiligten Akteure und untersucht die Mechanismen, die zu seiner Eskalation beitragen. Weiterhin werden die Grundlagen der Krisenkommunikation erläutert, einschließlich der Definition von Krise, der Ziele der Krisenkommunikation, der relevanten Phasen und Maßnahmen sowie der Bedeutung von Reputation und Vertrauen. Die Kapitel untergliedern die Theorie in die Bereiche Medienskandal und Krisenkommunikation mit detaillierten Unterkapiteln, die jeweils einzelne Aspekte dieser Bereiche beleuchten. Die dargestellten Konzepte bilden die theoretische Basis für die anschließende Fallstudie.
3 Die Causa Hoeneß: Dieses Kapitel präsentiert eine detaillierte Chronologie der Ereignisse im Fall Hoeneß, beginnend vor dem Bekanntwerden des Skandals bis hin zum Prozess. Es beschreibt die einzelnen Phasen der Affäre und analysiert das Verhalten der beteiligten Akteure, insbesondere Uli Hoeneß, den FC Bayern München und die Medien. Die Chronologie strukturiert die Ereignisse nach klaren Zeitabschnitten und liefert einen umfassenden Überblick über den Verlauf des Skandals. Die Analyse der Akteure beleuchtet deren Rollen und Strategien im Umgang mit der Krise.
4 Methodisches Vorgehen: Dieses Kapitel beschreibt die methodischen Vorgehensweisen der Arbeit, insbesondere die quantitative Analyse der medialen Berichterstattung. Es erläutert die Auswahl der Medien, die Kriterien der Datenauswahl und die angewandten Analysemethoden. Es wird detailliert auf die quantitative Analyse der Berichterstattung eingegangen, wobei die ausgewählten Zeitabschnitte und die Analyse der jeweiligen Medien (DIE ZEIT, stern, Focus, DER SPIEGEL) im Fokus stehen. Die Kapitel beschreibt die angewandten Methoden zur Erhebung und Analyse der Daten und die Kriterien für die Auswahl der Medien. Die dargestellte Methodik liefert die Grundlage für die objektive und nachvollziehbare Analyse des Falles Hoeneß.
Schlüsselwörter
Uli Hoeneß, Steueraffäre, Medienskandal, Krisenkommunikation, Reputationsmanagement, Medienberichterstattung, Skandalisierung, Akteure, FC Bayern München, Quantitative Analyse.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: "Die Causa Hoeneß: Medienskandal und Krisenkommunikation"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die mediale Berichterstattung und die Krisenkommunikation im Fall der Steueraffäre um Uli Hoeneß. Sie untersucht die Mechanismen eines Medienskandals anhand dieses Fallbeispiels und evaluiert die Strategien der Krisenkommunikation.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Themen wie Medienskandale als soziologisches Phänomen, die Krisenkommunikationsstrategien von Uli Hoeneß, die Rolle der Medien in der Eskalation des Skandals, den Einfluss des FC Bayern München auf die öffentliche Wahrnehmung und die Interaktionen der verschiedenen Akteure.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zu den theoretischen Grundlagen (Skandalberichterstattung und Krisenkommunikation), ein Kapitel zur Causa Hoeneß (Chronologie und Akteure) und ein Kapitel zum methodischen Vorgehen (quantitative Analyse und Auswahl der Medien).
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine quantitative Analyse der medialen Berichterstattung. Es werden die Auswahl der Medien (DIE ZEIT, stern, Focus, DER SPIEGEL), die Kriterien der Datenauswahl und die angewandten Analysemethoden detailliert beschrieben.
Welche Akteure werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Interaktion zwischen Uli Hoeneß, den Medien und dem FC Bayern München im Kontext des Skandals.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf Theorien zur Skandalberichterstattung und Krisenkommunikation. Der Begriff des Medienskandals wird definiert, seine Entstehung und sein Verlauf beschrieben, und die Mechanismen seiner Eskalation werden untersucht. Ebenso werden die Grundlagen der Krisenkommunikation erläutert, einschließlich der Definition von Krise, der Ziele der Krisenkommunikation, der relevanten Phasen und Maßnahmen sowie der Bedeutung von Reputation und Vertrauen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Thematik einführt und den Forschungsansatz skizziert. Es folgt ein Kapitel mit den theoretischen Grundlagen, dann ein Kapitel zur Causa Hoeneß mit einer detaillierten Chronologie der Ereignisse und einer Analyse des Verhaltens der Akteure. Das letzte Kapitel beschreibt die methodischen Vorgehensweisen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Uli Hoeneß, Steueraffäre, Medienskandal, Krisenkommunikation, Reputationsmanagement, Medienberichterstattung, Skandalisierung, Akteure, FC Bayern München, Quantitative Analyse.
Wozu dient die Zusammenfassung der Kapitel?
Die Zusammenfassung der Kapitel bietet einen kurzen Überblick über den Inhalt jedes Kapitels und erleichtert den Lesern den Zugang zur Arbeit.
Welches ist das zentrale Ziel der Arbeit?
Das zentrale Ziel ist die Analyse der medialen Berichterstattung und der Krisenkommunikation im Fall Uli Hoeneß, um die Mechanismen eines Medienskandals und die Strategien der Krisenkommunikation zu untersuchen.
- Citation du texte
- Anne Kautz (Auteur), 2015, Mediale Berichterstattung und Krisenkommunikation. Die Steueraffäre um Uli Hoeneß, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/367974