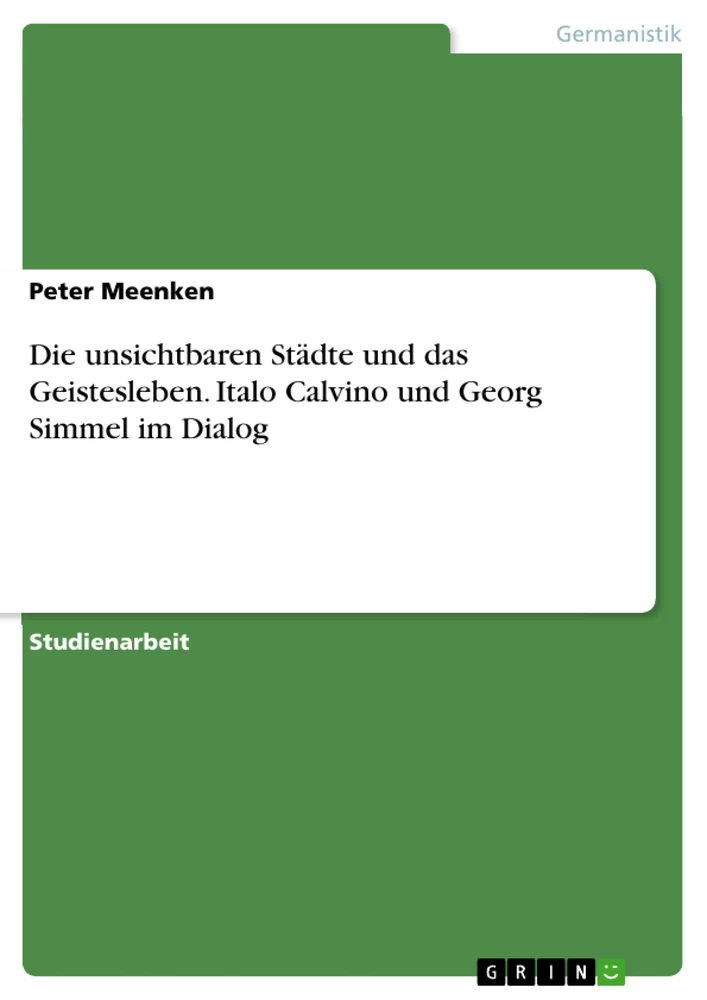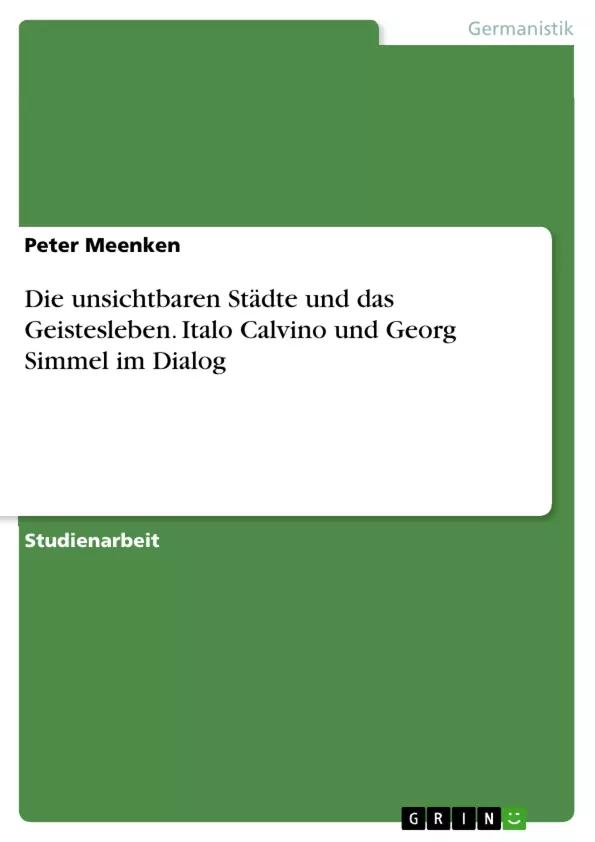Das Thema der vorliegenden Ausarbeitung ist Italo Calvinos 1972 veröffentlichtes Werk „Le città invisibili“, dessen deutsche Übersetzung „Die unsichtbaren Städte“ aus dem Jahre 1985 von Heinz Riedt als Textgrundlage herangezogen wird. Im Fokus dieser Arbeit soll zunächst das Erschließen der zentralen Topoi und poetologischen Kunstgriffe Calvinos stehen. Nachdem die zentralen formalen Elemente, dieses komplexen und ästhetisch stark durchdrungenen postmodernen Werkes in gebotener Kürze aufgeschlüsselt worden sind, wird im nächsten Teil dieser Arbeit versucht auf Basis der in LCI enthaltenen Polysemie exemplarisch einen Transfer zum Thema des rahmengebenden Seminars „Das Motiv der Großstadt am Beispiel Berlin in Literatur, Film und Musik“ zu entwickeln. In Hinblick auf die konkrete Methodik bietet es sich der Übersichtlichkeit halber an, die poetologische Analyse von LCI zunächst losgelöst vom Transfer, in einem eigenen Kapitel abzuwickeln, da sie sich sachlogisch über die zwei voneinander getrennten Ebenen des Werks erstrecken wird. Dementsprechend erfolgt zunächst die Erläuterung des Discours, der achtzehn Zwischentexte, welche im Zuge dieser Arbeit leider nur rudimentär Aufmerksamkeit gewidmet werden kann, denn der Fokus soll auf dem Récit liegen. Der Récit beinhaltet die 55 Beschreibungen der fiktiven Städte Calvinos, welche zunächst im Hinblick auf ihre formale Gestaltung einer poetologischen Analyse unterzogen werden, um im anschließenden Hauptteil dieser Arbeit einer hermeneutisch diskutiert zu werden.
Die italienische Erstausgabe von „Le città invisibili“ wurde im Jahre 1972 in Torino veröffentlicht und kann, nach gängiger Fachmeinung, der kombinatorisch-experimentellen oder auch antiliterarischen Schaffensperiode des Autoren Italo Calvino zugeordnet werden. Eben aufgrund dieser Charakteristika ist LCI als Paradebeispiel postmoderner Literatur zu betrachten, welche sich durch Fragmentierung, Ironisierung und dem Spiel mit Konventionen auszeichnet. Das Spiel ist bereits im Hinblick auf die Inspirationsquelle von LCI zu erkennen. Diese findet sich in „Il Milione“ (dt. „Die Wunder der Welt“). Bei diesem Text handelt es sich um die Reiseberichte Marco Polos aus dem 13. Jh., welche trotz gelegentlicher phantastischer Ergänzungen und Ausschmückungen im Groß als historisch fundiert zu betrachten sind.
Inhaltsverzeichnis
- Zueignung
- ,,Le città invisibili“, Referenz und postmodernes Spiel
- Der formale Aufbau und die poetologische Funktion
- Der Discours, die Zwischentexte
- Der Récit, die Stadtbeschreibungen
- Der Transfer: Die Städte und der Austausch im Dialog mit Simmels Soziologie
- Eufemia und die Blasiertheit des Großstädters
- Cloe und der städtische Antagonismus
- Eutropia und die urbane Intellektualität
- Ersilia und die urbanen Netzwerke
- Smeraldina und die Freiheit des Individuums
- Resümee und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit widmet sich Italo Calvinos Werk „Die unsichtbaren Städte“ und analysiert die zentralen Topoi und poetologischen Kunstgriffe des Buches. Darüber hinaus untersucht sie die psychologischen und soziologischen Implikationen der Städte in einem realen urbanen Kontext und bezieht sich dabei auf Georg Simmels Soziologie.
- Analyse der poetologischen Kunstgriffe in „Die unsichtbaren Städte“
- Transfer der städtischen Topoi in einen realen urbanen Kontext
- Dialog mit Georg Simmels Soziologie, insbesondere mit seinem Werk „Die Großstädte und das Geistesleben“
- Untersuchung der psychologischen und soziologischen Implikationen der unsichtbaren Städte
- Betrachtung der Stadt als Phänomen der Lebenswelt Großstadt im Allgemeinen
Zusammenfassung der Kapitel
- Zueignung: Diese Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und erläutert die textuelle Grundlage, die von Calvinos „Le città invisibili“ in der deutschen Übersetzung von Heinz Riedt gebildet wird. Die Arbeit gliedert sich in eine Analyse der zentralen Topoi und poetologischen Kunstgriffe sowie einen Transfer zu den Themen des Seminars.
- ,,Le città invisibili“, Referenz und postmodernes Spiel: Dieses Kapitel verortet Calvinos Werk in der kombinatorisch-experimentellen Schaffensperiode der postmodernen Literatur. Es zeigt die Inspiration aus Marco Polos „Il Milione“ und beschreibt den komplexen Aufbau von „Die unsichtbaren Städte“ mit seiner Zweiteilung in Récit und Discours.
- Der formale Aufbau und die poetologische Funktion: Dieses Kapitel analysiert die beiden zentralen Ebenen des Werks: Der Discours, der 18 Zwischentexte umfasst, und der Récit, welcher 55 Stadtbeschreibungen beinhaltet. Der Fokus liegt auf der Funktion des Discours als metasprachliche Reflexionsebene und seiner Rolle bei der Kommunikation zwischen Marco Polo und Kublai Khan.
- Der Transfer: Die Städte und der Austausch im Dialog mit Simmels Soziologie: Dieses Kapitel untersucht die psychologischen und soziologischen Implikationen der unsichtbaren Städte im Vergleich zu realen urbanen Kontexten. Es werden exemplarisch verschiedene Topoi aus „Die unsichtbaren Städte“ betrachtet und im Dialog mit Georg Simmels Soziologie analysiert. Das Kapitel beleuchtet Themen wie die Blasiertheit des Großstädters, den städtischen Antagonismus, die urbane Intellektualität, die urbanen Netzwerke und die Freiheit des Individuums.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind: Italo Calvino, „Die unsichtbaren Städte“, Postmoderne, Poetologie, Discours, Récit, Stadt, Großstadt, Soziologie, Georg Simmel, Lebenswelt, Blasiertheit, Antagonismus, Intellektualität, Netzwerke, Freiheit.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Italo Calvinos "Die unsichtbaren Städte"?
Das Werk beschreibt fiktive Städte in einem Dialog zwischen Marco Polo und Kublai Khan und gilt als Paradebeispiel postmoderner Literatur.
Was bedeuten "Récit" und "Discours" in diesem Werk?
Der Récit umfasst die 55 Stadtbeschreibungen, während der Discours die 18 Zwischentexte bildet, die den Dialog und die metasprachliche Reflexion enthalten.
Welche Verbindung besteht zu Georg Simmel?
Die Arbeit zieht Parallelen zwischen Calvinos fiktiven Städten und Simmels soziologischen Analysen zur Blasiertheit und zum Geistesleben des modernen Großstädters.
Was symbolisiert die Stadt "Ersilia"?
Ersilia steht für urbane Netzwerke und die Beziehungen zwischen den Bewohnern, die oft wichtiger sind als die physischen Gebäude der Stadt.
Warum gilt das Werk als "postmodernes Spiel"?
Es nutzt Fragmentierung, Ironisierung und spielt mit historischen Vorlagen wie Marco Polos Reiseberichten, um die Wahrnehmung von Realität zu hinterfragen.
- Quote paper
- Peter Meenken (Author), 2017, Die unsichtbaren Städte und das Geistesleben. Italo Calvino und Georg Simmel im Dialog, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/368080