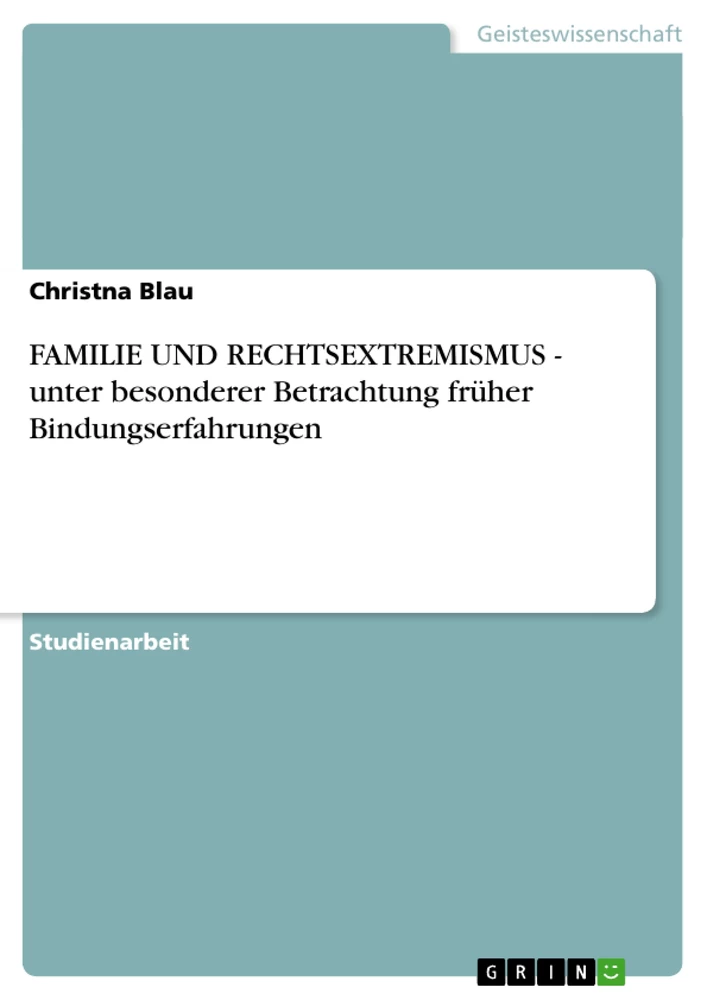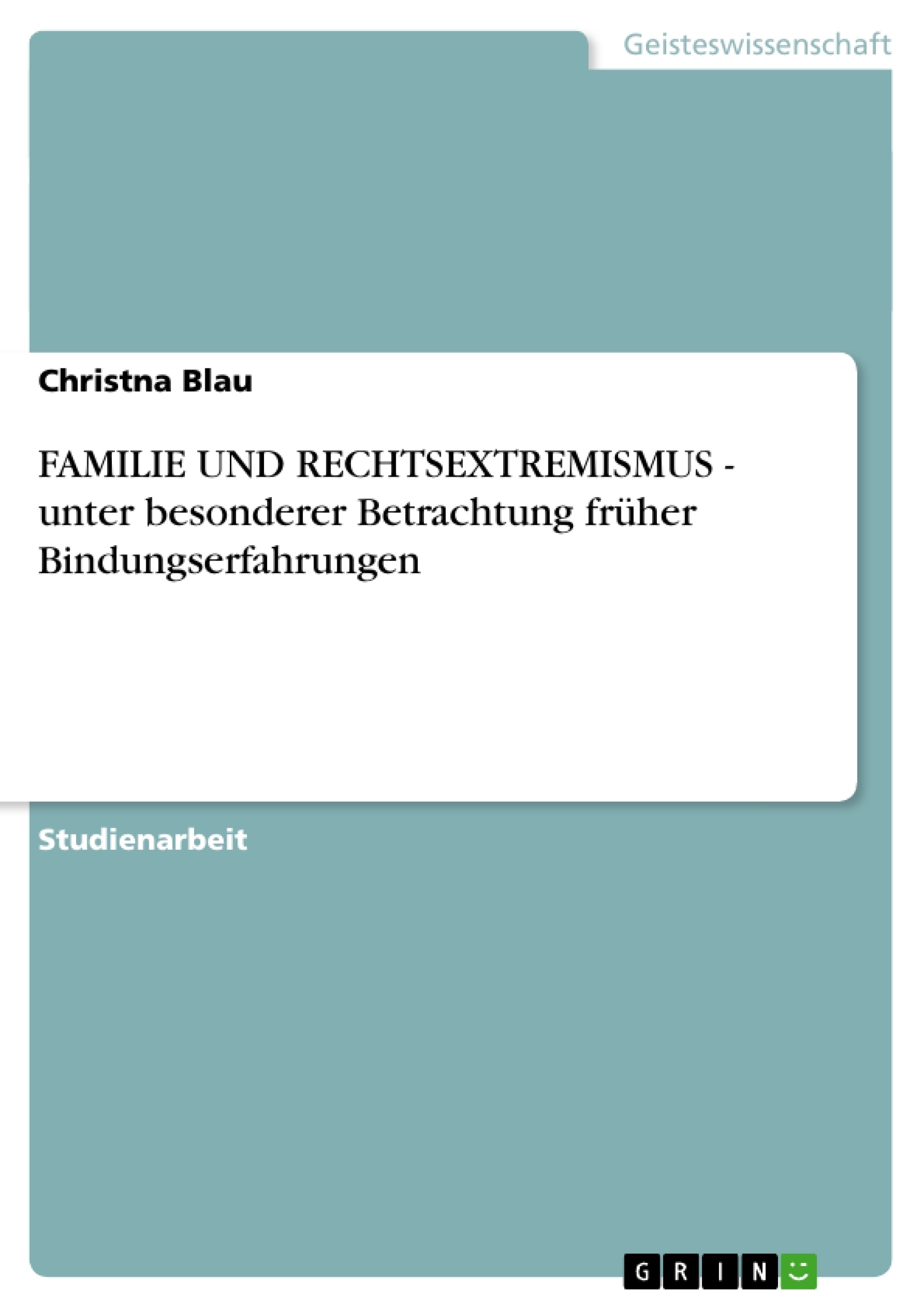Das Ende des Zweiten Weltkriegs jährt sich in diesem Jahr zum 60. Mal. Die Einweihung des Denkmals für die ermordeten Juden Europas in Berlin am 10. Mai dieses Jahres stellt ein deutliches Zeichen gegen das Vergessen dar. Neonazistische Gruppen und Parteien haben angekündigt, an diesem Gedenktag zu „marschieren“ und ihn zur Verbreitung ihrer Geschichtslügen zu benutzen. In diesem Beispiel spiegelt sich die Aktualität des Themas Rechtsextremismus. Umso genauer sollte man sich für die Gründe und Ursachen rechtsextremer Orientierungen interessieren und sich die Frage stellen, warum einige Menschen eine solche Haltung entwickeln, die für andere undenkbar erscheint. Dieser Frage wurde im Rahmen einer Studie 1992 nachgegangen. Die spezifischen Fragestellungen und die Vorgehensweise und Methoden der Studie werden im zweiten Kapitel dieser Arbeit dargestellt. Darauf folgend werden die Begriffe „Rechtsextremismus“ und „Autoritarismus“ wegen ihrer häufigen Verwendung kurz definiert. Im vierten Kapitel wird das Verhältnis von Sozialisation, Autorita rismus und Rechtsextremismus näher beleuchtet, während im fünften Kapitel als eigentlichem Schwerpunkt der Arbeit, die Relevanz von familialen Beziehungserfahrungen für die Entwicklung rechtsextremer Orientierungen dargestellt wird. Hierbei sind der Attachment-Ansatz, der in Deutschland noch wenig Beachtung fand, und die Bindungstheorie nach Bowlby von 1969 grundlegend. Eine Zusammenfassung und abschließende Überlegungen finden sich im Schluss der Arbeit. Da sich diese Arbeit und ihre Ergebnisse so gut wie ausschließlich auf das von C. Hopf, P. Rieker, M. Sanden-Marcus und C. Schmidt herausgebrachte Buch „Familie und Rechtsextremismus“ 1 bezieht, werde ich auf diese Quelle innerhalb der Arbeit nicht mehr gesondert hinweisen. Andere Quellen werden natürlich extra erwähnt. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Anliegen, Methoden, Durchführung und Ziel der Studie zum Thema ,,Familie und Rechtsextremismus”
- Definitionen wichtiger Begriffe
- Rechtsextremismus
- Autoritarismus
- Moralentwicklung und autoritäre Dispositionen
- Familiale Beziehungserfahrungen und rechtsextreme Orientierung
- Die Attachment-Theorie
- Bindungsrepräsentationen nach Bowlby
- Bindungsrepräsentationen und rechtsextreme Orientierungen
- Schluss
- Inhaltsverzeichnis
- Literatur
- Internetadressen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Ursachen jugendlichen Rechtsextremismus und analysiert eine Studie aus dem Jahr 1992. Das zentrale Anliegen der Studie ist die Untersuchung der Frage, warum einige Menschen eine rechtsextreme Haltung entwickeln, während andere dies nicht tun. Es werden verschiedene Faktoren beleuchtet, die zu rechtsextremen Orientierungen führen können, darunter wirtschaftliche und politische Bedingungen, die Rolle der Medien und vor allem die familiale Sozialisation.
- Die Rolle der Familie in der Entwicklung rechtsextremer Orientierungen
- Die Bedeutung der Attachment-Theorie und der Bindungstheorie nach Bowlby
- Der Zusammenhang zwischen autoritären Dispositionen und rechtsextremer Orientierung
- Die Untersuchung von sozialisationstheoretischen Aspekten in Bezug auf Rechtsextremismus
- Qualitative Forschungsmethoden und die Bedeutung der subjektiven Erfahrungen von jungen Männern
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Diese Einleitung stellt das Thema Rechtsextremismus vor und unterstreicht dessen Aktualität. Die Studie, auf die sich die Arbeit bezieht, wurde 1992 durchgeführt und befasst sich mit den Ursachen rechtsextremer Orientierungen. Die Arbeit erläutert den Aufbau und die Schwerpunkte der folgenden Kapitel.
Anliegen, Methoden, Durchführung und Ziel der Studie zum Thema ,,Familie und Rechtsextremismus”: Dieses Kapitel beschreibt die Studie aus dem Jahr 1992, die den Ursachen jugendlichen Rechtsextremismus nachgeht. Die Studie erforscht die Rolle der Familie in der Entwicklung rechtsextremer Orientierungen und verwendet qualitative Methoden, um individuelle Erfahrungen und Einstellungen der befragten jungen Männer zu erfassen. Das Ziel der Studie ist es, Hypothesen aus der Autoritarismusforschung zu überprüfen und theoretische Überlegungen weiterzuentwickeln.
Definitionen wichtiger Begriffe: Dieses Kapitel definiert die Begriffe Rechtsextremismus und Autoritarismus. Es werden verschiedene Definitionsmodelle vorgestellt, wobei die Studie ein orientierungsbezogenes Definitionsmodell für Rechtsextremismus verwendet. Die Definition von Autoritarismus basiert auf den Studien Theodor Adornos zum autoritären Charakter.
Moralentwicklung und autoritäre Dispositionen: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Zusammenhang zwischen Moralentwicklung, autoritären Dispositionen und Rechtsextremismus. Es werden die Studien von Theodor Adorno zum autoritären Charakter und deren Bedeutung für das Verständnis von rechtsextremen Einstellungen beleuchtet.
Familiale Beziehungserfahrungen und rechtsextreme Orientierung: Dieses Kapitel stellt den Schwerpunkt der Arbeit dar und untersucht die Relevanz von familialen Beziehungserfahrungen für die Entwicklung rechtsextremer Orientierungen. Dabei werden die Attachment-Theorie und die Bindungstheorie nach Bowlby als wichtige theoretische Bezugspunkte vorgestellt. Die Analyse konzentriert sich auf die Rolle von Bindungserfahrungen und deren Einfluss auf rechtsextreme Orientierungen.
Schlüsselwörter
Rechtsextremismus, Autoritarismus, Familiale Sozialisation, Attachment-Theorie, Bindungstheorie, Bindungsrepräsentationen, Moralentwicklung, Qualitative Forschung, Studie, Junge Männer, Rechtsextreme Orientierungen, Sozialisationstheoretische Aspekte, Sozialpsychologische Aspekte.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen Erziehung und Rechtsextremismus zusammen?
Die Arbeit untersucht, wie familiale Sozialisation und frühe Bindungserfahrungen die Entwicklung von autoritären Dispositionen und rechtsextremen Orientierungen beeinflussen.
Was besagt die Bindungstheorie nach Bowlby in diesem Kontext?
Die Theorie (Attachment-Ansatz) legt nahe, dass unsichere Bindungsrepräsentationen in der Kindheit die Anfälligkeit für rechtsextreme Ideologien im Jugendalter erhöhen können.
Was versteht die Forschung unter einem „autoritären Charakter“?
Basierend auf Adorno beschreibt dies ein Persönlichkeitsprofil, das zu Unterwürfigkeit gegenüber Autoritäten und Aggression gegen Minderheiten neigt.
Welche Rolle spielt die Moralentwicklung bei rechtsextremen Jugendlichen?
Es wird analysiert, wie eine gestörte oder einseitige Moralentwicklung den Zugang zu rechtsextremen Weltbildern und Geschichtslügen erleichtert.
Wie wurde die Studie von 1992 durchgeführt?
Die Studie nutzte qualitative Methoden und Experteninterviews mit jungen Männern, um deren subjektive Erfahrungen und familiale Hintergründe zu rekonstruieren.
- Arbeit zitieren
- Christna Blau (Autor:in), 2005, FAMILIE UND RECHTSEXTREMISMUS - unter besonderer Betrachtung früher Bindungserfahrungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36827