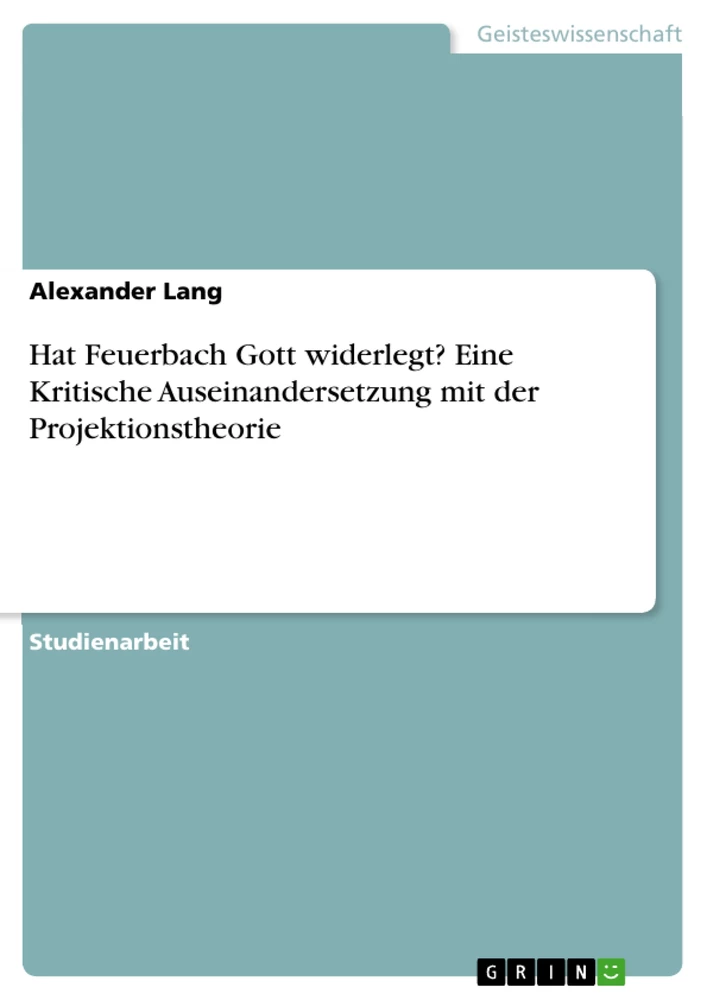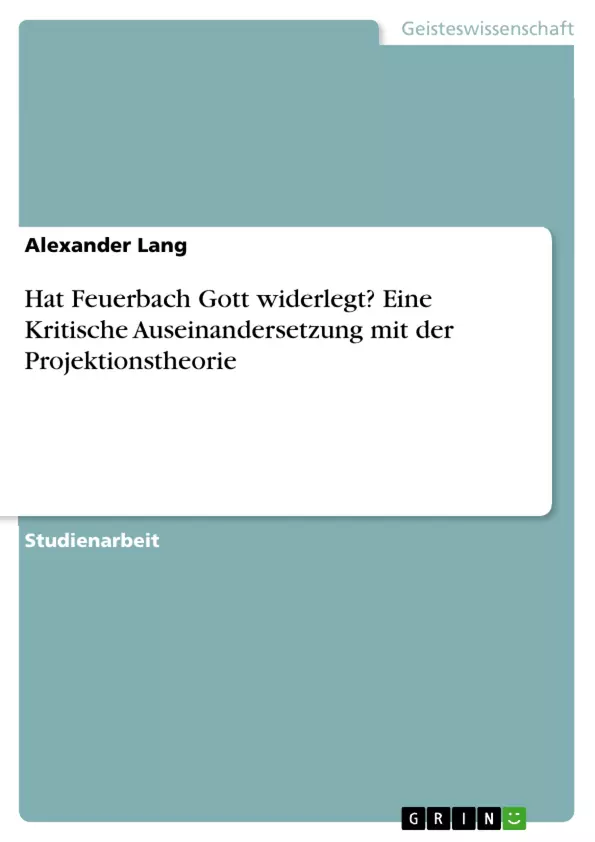Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, die Projektionstheorie zu erläutern und herauszustellen, ob diese Theorie einen Wahrheitsanspruch erheben kann oder nicht. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob Feuerbach Gott widerlegt hat. Um das formulierte Forschungsziel zu erreichen, wird in zwei Schritten vorgegangen: Das erste Kapitel widmet sich dem zum Verständnis der nachfolgenden Diskussion notwendigen Fachbegriff "Projektion" und der Darstellung der theoretischen Grundlagen der Projektionstheorie. Hier wird der Blick exemplarisch auf Feuerbachs Überlegungen im Hauptwerk "Das Wesen des Christentums" gelenkt. Im Fokus des zweiten Kapitels steht eine Diskussion, deren Basis die Überlegungen zur Projektionstheorie in Kapitel eins sind. Dabei soll gezeigt werden, dass die Kritik Feuerbachs einer gewissen Unwucht unterliegt. Ein Fazit beschließt die Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Theoretische Grundlagen
- A. Der Begriff „Projektion“
- B. Feuerbachs Grundgedanken in „Das Wesen des Christentums“
- 1. Allgemein zum Wesen des Menschen und der Religion
- 2. Gott als Spiegelbild des Menschen
- 3. Begründung für die Projektion
- III. Diskussion
- A. 1. Problemstellung
- Gott als Antwort auf die Leiden der Menschen
- 2. Gott als Projektion
- B. Ergebnis
- IV. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, Feuerbachs Projektionstheorie zu erläutern und die Frage zu beantworten, ob diese Theorie einen Wahrheitsanspruch erheben kann. Im Zentrum steht die Frage, ob Feuerbach Gott widerlegt hat.
- Die Entwicklung des Begriffs „Projektion“ in Bezug auf Feuerbachs Werk
- Feuerbachs Verständnis des Menschenwesens und seiner Religionskritik
- Die zentrale Aussage Feuerbachs: Gott als Projektion des menschlichen Wesens
- Die Relevanz von Feuerbachs Thesen für die Religionsforschung
- Die Kritik an Feuerbachs Projektionstheorie und deren Einwände
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel I: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt Feuerbachs zentrale These vor: Gott als Spiegelbild des Menschen. Die Arbeit fokussiert auf Feuerbachs Hauptwerk „Das Wesen des Christentums“ und skizziert die Forschungsfrage.
- Kapitel II: Dieses Kapitel erläutert die theoretischen Grundlagen der Projektionstheorie, wobei Feuerbachs Verständnis des Menschenwesens und seiner Religionsauffassung im Vordergrund stehen. Die Analyse von Feuerbachs „Das Wesen des Christentums“ bildet den Kern dieses Kapitels.
- Kapitel III: Dieses Kapitel diskutiert Feuerbachs Kritik am Gottesbegriff und untersucht, ob er Gott tatsächlich widerlegt hat. Die Diskussion befasst sich mit der Problemstellung, ob Gott als Antwort auf die Leiden der Menschen oder als Projektion des menschlichen Wesens verstanden werden kann.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Feuerbachs Religionsphilosophie, Projektionstheorie, Gottesbegriff, Menschenbild, „Das Wesen des Christentums“, anthropologische Theologie, Religionskritik.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt Feuerbachs Projektionstheorie?
Feuerbach argumentiert, dass Gott kein eigenständiges Wesen ist, sondern eine Projektion des menschlichen Wesens und seiner Wünsche in den Himmel.
Hat Feuerbach Gott damit widerlegt?
Die Arbeit untersucht kritisch, ob seine Theorie einen absoluten Wahrheitsanspruch erheben kann oder ob sie einer gewissen "Unwucht" in der Argumentation unterliegt.
Was ist das Hauptwerk von Ludwig Feuerbach zur Religionskritik?
Sein zentrales Werk ist „Das Wesen des Christentums“, in dem er Gott als Spiegelbild des Menschen darstellt.
Warum projiziert der Mensch laut Feuerbach sein Wesen auf einen Gott?
Gott dient als Antwort auf die Leiden und Sehnsüchte der Menschen; er ist die Verkörperung dessen, was der Mensch gerne wäre, aber nicht ist.
Welche Rolle spielt die Anthropologie in Feuerbachs Theologie?
Feuerbachs Ansatz wird oft als "anthropologische Theologie" bezeichnet, da er das Geheimnis der Theologie in der Anthropologie (der Lehre vom Menschen) sieht.
- Quote paper
- Alexander Lang (Author), 2017, Hat Feuerbach Gott widerlegt? Eine Kritische Auseinandersetzung mit der Projektionstheorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/368314