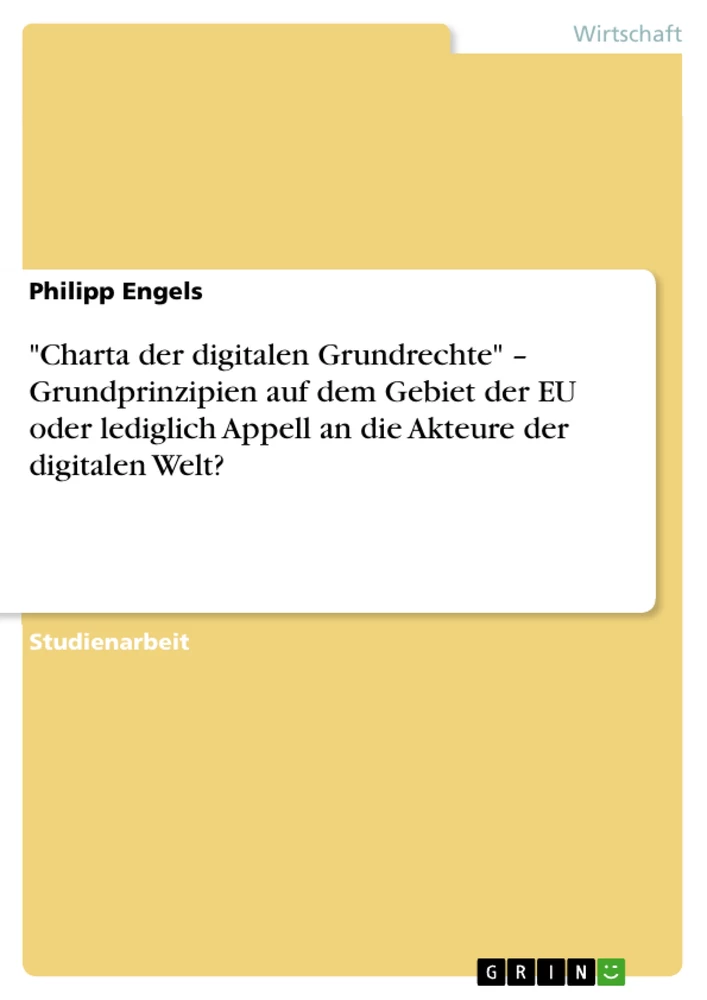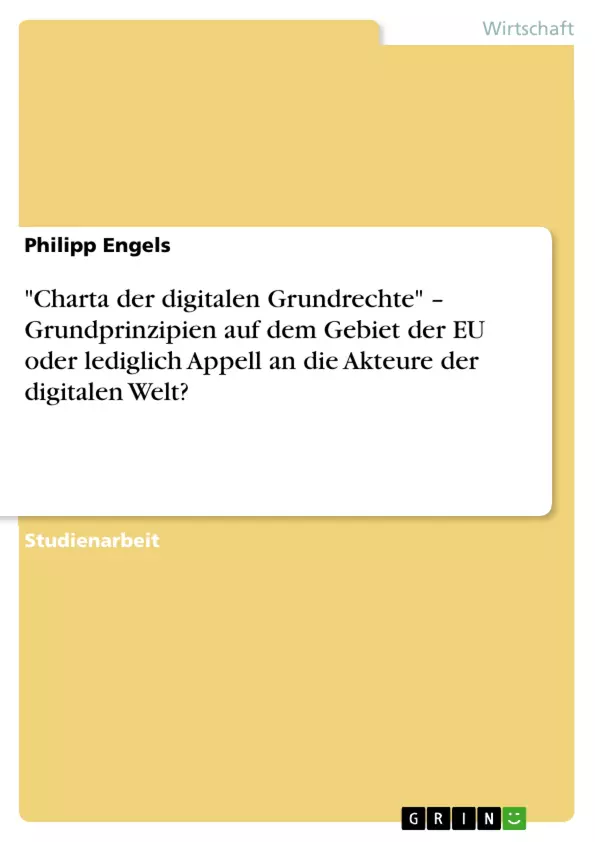Zunächst geht diese Arbeit auf die Aspekte der „Charta der digitalen Grundrechte“ ein, die für die Charta als Grundprinzipien stehen, und nachfolgend auf die Punkte, die dafür sprechen, dass die vorliegende Charta lediglich ein Appell an die Akteure der digitalen Welt ist. Im Anschluss wird auf Basis der gefundenen Argumentationspunkte ein Fazit gezogen.
In den letzten Jahren ist der Umgang mit Daten von Nutzern ein öffentlichkeitswirksames Thema geworden. Die Bedeutung des Verwendungszwecks von Daten im digitalen Zeitalter hat innerhalb der Gesellschaft an Stellenwert gewonnen und wird öffentlich diskutiert. Dies ist auch den großen Unternehmen der IT- und Kommunikationstechnik zu verdanken, die mit ihren Vorgehensweisen bei der Speicherung und Auswertung von Daten teilweise stark in die Kritik geraten sind und eine medienwirksame, öffentliche Debatte angestoßen haben.
Ein dafür prominentes Beispiel sind die Enthüllungen vom amerikanischen IT-Experten und Whistleblower Edward Snowden, die gezeigt haben, dass den amerikanischen Nachrichten- und Geheimdiensten sowie einigen Behörden ein vollkommener Zugriff auf sämtliche in den USA gespeicherten Daten zur Verfügung steht – eben auch Daten von europäischen Nutzern, die auf amerikanischem Staatsgebiet gespeichert werden. Die Nutzerdaten unterliegen folglich dem in den Vereinigten Staaten von Amerika geltenden Recht. Diese Art der gesetzlichen Regelung ermöglicht den Nachrichtendiensten die informationelle Auswertung der Daten der Nutzer. Die Veröffentlichung dieser Meldung in den Medien sorgte weltweit für Empörung und einen Aufschrei bei den Teilnehmern der digitalen Gesellschaft.
Der hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Prof. Dr. Johannes Caspar, sieht die Auswertungen als eine extreme Form der Überwachung: „Dies ist der großangelegte Versuch, die digitale Infrastruktur gegen den Nutzer zu kehren und möglichst alle Daten von Informations- und Kommunikationsprozessen unter ständige Überwachung zu bringen“.
Inhaltsverzeichnis
- „Charta der digitalen Grundrechte“ - Grundprinzipien auf dem Gebiet der EU oder lediglich Appell an die Akteure der digitalen Welt?
- Argumente für die Charta als Grundprinzipien auf dem Gebiet der europäischen Union
- Argumente für die Charta als Appell an die Akteure der digitalen Welt
- Fazit
- Als besonders relevant ausgewählte Grundsätze der „Charta der digitalen Grundrechte“
- Art. 2: Freiheit
- Art. 4: Innere und äußere Sicherheit
- Art. 5: Meinungsfreiheit und Öffentlichkeit
- Einführung einer Obergrenze bei Managervergütungen im Top-Management in nicht-staatlichen Großbetrieben der Wirtschaft
- Argumente für eine Obergrenze bei der Managervergütung
- Argumente gegen eine Obergrenze bei der Managervergütung
- Mögliche Regelungen und Wege, eine Deckelung in der Praxis zu verwirklichen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit zwei aktuellen Themenstellungen im Spannungsfeld von digitaler Entwicklung und ethischen Fragestellungen. Zum einen wird die „Charta der digitalen Grundrechte“ analysiert und deren Bedeutung als verbindliche Grundprinzipien der EU oder als bloßer Appell an die Akteure der digitalen Welt diskutiert. Zum anderen befasst sich die Arbeit mit der Frage einer möglichen Obergrenze bei Managervergütungen in nicht-staatlichen Großbetrieben.
- Die Bedeutung der „Charta der digitalen Grundrechte“ und ihrer Implementierung als verbindliche rechtliche Grundlage für die EU.
- Die Rolle von Großkonzernen in der digitalen Welt und die Notwendigkeit einer ethischen Regulierung ihrer Machtposition.
- Die Relevanz von Grundrechten wie Freiheit, Sicherheit und Meinungsfreiheit im digitalen Raum.
- Die Diskussion um eine gerechte Verteilung von Ressourcen und die soziale Verantwortung von Unternehmen.
- Die Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung im Hinblick auf die Gestaltung einer gerechten und nachhaltigen Gesellschaft.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Analyse der „Charta der digitalen Grundrechte“ und beleuchtet die Argumente für und gegen deren Gültigkeit als verbindliche Grundprinzipien der EU. Im Anschluss werden relevante Grundsätze der Charta, wie Freiheit, Sicherheit und Meinungsfreiheit, näher betrachtet.
Im zweiten Teil wird die Debatte um eine Obergrenze bei Managervergütungen in nicht-staatlichen Großbetrieben beleuchtet. Die Arbeit untersucht die Argumente für und gegen eine solche Deckelung und diskutiert mögliche Regelungen und Wege, um eine Deckelung in der Praxis zu verwirklichen.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit den Themen Digitalisierung, Grundrechte, Datenschutz, Managervergütung, ethische Unternehmensführung, und gesellschaftliche Verantwortung. Die Arbeit analysiert die „Charta der digitalen Grundrechte“ und die Bedeutung von Grundprinzipien im digitalen Raum. Darüber hinaus werden die Argumente für und gegen eine Obergrenze bei Managervergütungen im Kontext der sozialen Verantwortung von Unternehmen diskutiert.
Häufig gestellte Fragen
Ist die „Charta der digitalen Grundrechte“ rechtlich bindend?
Die Arbeit diskutiert, ob die Charta als verbindliche Grundprinzipien für die EU fungiert oder lediglich einen moralischen Appell an Akteure der digitalen Welt darstellt.
Welche Rolle spielte Edward Snowden für die Debatte um digitale Rechte?
Snowdens Enthüllungen über die Massenüberwachung durch US-Geheimdienste lösten weltweit Empörung aus und verdeutlichten die Notwendigkeit eines besseren Schutzes europäischer Nutzerdaten.
Welche Grundrechte sind im digitalen Raum besonders relevant?
Besonders hervorgehoben werden die Artikel zur Freiheit (Art. 2), zur inneren und äußeren Sicherheit (Art. 4) sowie zur Meinungsfreiheit und Öffentlichkeit (Art. 5).
Warum wird eine Obergrenze für Managervergütungen diskutiert?
Die Arbeit untersucht ethische Argumente für und gegen eine Deckelung von Gehältern im Top-Management im Kontext der sozialen Verantwortung von Großunternehmen.
Was kritisiert Prof. Dr. Johannes Caspar an der digitalen Infrastruktur?
Er sieht in der ständigen Auswertung von Nutzerdaten den Versuch, die digitale Infrastruktur gegen den Nutzer zu kehren und eine totale Überwachung zu etablieren.
- Citar trabajo
- Philipp Engels (Autor), 2017, "Charta der digitalen Grundrechte" – Grundprinzipien auf dem Gebiet der EU oder lediglich Appell an die Akteure der digitalen Welt?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/368348