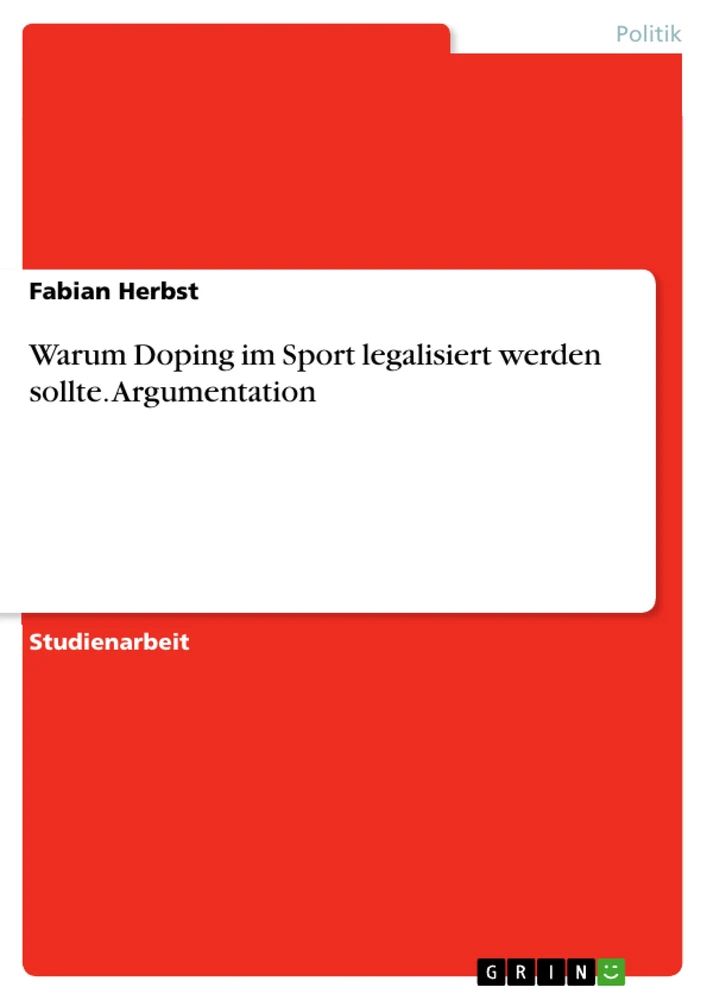Diese Arbeit will die Qualität des Arguments, wonach Doping im Sport legalisiert werden soll, untersuchen. Dazu wird im folgenden das entsprechende Argument von Savulescu et al. ihres Artikels „Why we should allow performance enhancing drugs in sport“ analysiert. Die Autoren fordern, Doping im Sport zu erlauben. Für die weitere Analyse wird zunächst die Argumentationskette dargestellt. Anschließend folgen Definitionen wichtiger Begriffe. Danach wird das Argument rekonstruiert und in eine formale Form gebracht. Es folgen die Bewertung und das Attackieren des Arguments. Dazu werden drei verschiedene Methoden verwendet:
(1) Überprüfung der Validität mittels einer Wahrheitstabelle
(2) Widerlegung des Arguments mittels eines Reductio ad absurdum-Arguments
(3) Widerlegung des Arguments mittels eines Gegenbeispiels.
Dem Autor ist bewusst, dass eine erfolgreiche Methode der drei gelisteten für die Widerlegung ausreichen würde. Da in dieser Arbeit aber verschiedene Methoden anhand des genannten Arguments demonstriert werden sollen, werden alle drei Methoden auf das Argument angewendet. Ein zusammenfassendes Fazit schließt die Analyse des Arguments ab. Dieses zeigt final, ob das Argument haltbar ist oder nicht. Am Ende folgt ein kleiner Ausblick auf die Zukunft der Dopingproblematik im Hochleistungssport.
Dass der Sport ein Dopingproblem hat, wurde beispielsweise im vergangen Jahr durch die McLaren-Berichte bewiesen. McLaren zeigte dabei im Auftrag der WADA russisches Staatsdoping rund um die Olympischen Winterspiele 2014. Ähnliches berichtete die New York Times. Andere Beispiele für Probleme mit Doping sind die positiven Dopingtests bei jamaikanischen Sprintern während der Olympischen Sommerspiele in Peking oder der US-amerikanische Radsportler Armstrong, der zugab, bei all seinen Tour de France-Siegen gedopt gewesen zu sein. Diese Beispiele zeigen Probleme des Sports im Hinblick auf Doping: Staatlich unterstütze Dopingprogramme, positive Tests ohne Auswirkungen und durch verbotene Dopingmittel erfolgreiche Sportler. Da sich Viele dieser Probleme bewusst sind, wurden verschiedene Vorschläge gemacht, diese Themen anzugehen. Der Olympiasieger von London 2012 im Diskuswerfen, Harting, schlug eine Legalisierung von Doping vor. Auch in Wissenschaftlerkreisen hat sich eine Denkweise herausgebildet, die für eine Freigabe von Dopingsubstanzen im Sport plädiert. Andere stehen einer Legalisierung allerdings kritisch gegenüber.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Aktuelle Probleme mit Doping im Hochleistungssport.
- 2 Das Argument "Warum Doping im Sport legalisiert werden sollte" und die Bewertung desselben
- 2.1 Die Argumentationskette der Autoren
- 2.2 Definitionen
- 2.3 Rekonstruktion des Arguments
- 2.4 Bewertung und Attackieren des Arguments
- 2.4.1 Überprüfung der Validität
- 2.4.2 Widerlegung durch ein Reductio ad absurdum-Argument
- 2.4.3 Widerlegung durch ein Gegenbeispiel
- 2.5 Zusammenfassung und Fazit
- 3 Ausblick auf die Zukunft der Dopingproblematik.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Qualität des Arguments, Doping im Sport zu legalisieren. Dazu wird das Argument von Savulescu et al. aus ihrem Artikel "Why we should allow performance enhancing drugs in sport" analysiert, in dem sie für die Freigabe von Doping im Sport plädieren. Die Arbeit analysiert die Argumentationskette der Autoren, definiert wichtige Begriffe, rekonstruiert das Argument und bewertet dessen Qualität mittels verschiedener Methoden.
- Doping im Hochleistungssport
- Argumentation für die Legalisierung von Doping
- Analyse der Argumentationskette von Savulescu et al.
- Bewertung der Qualität des Arguments
- Ausblick auf die Zukunft der Dopingproblematik
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 befasst sich mit aktuellen Problemen des Dopings im Hochleistungssport und zeigt Beispiele für staatlich unterstützte Dopingprogramme, positive Tests ohne Sanktionen sowie den Erfolg von Sportlern durch verbotene Substanzen, denen nichts nachgewiesen werden konnte. Kapitel 2 analysiert das Argument von Savulescu et al. für die Legalisierung von Doping. Die Argumentationskette der Autoren, die Definition wichtiger Begriffe, die Rekonstruktion des Arguments sowie seine Bewertung anhand verschiedener Methoden werden beleuchtet.
Schlüsselwörter
Doping, Sport, Hochleistungssport, Legalisierung, Argumentation, Savulescu et al., Qualität des Arguments, Validität, Reductio ad absurdum, Gegenbeispiel, Dopingproblematik, Zukunft.
- Arbeit zitieren
- Fabian Herbst (Autor:in), 2017, Warum Doping im Sport legalisiert werden sollte. Argumentation, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/368357