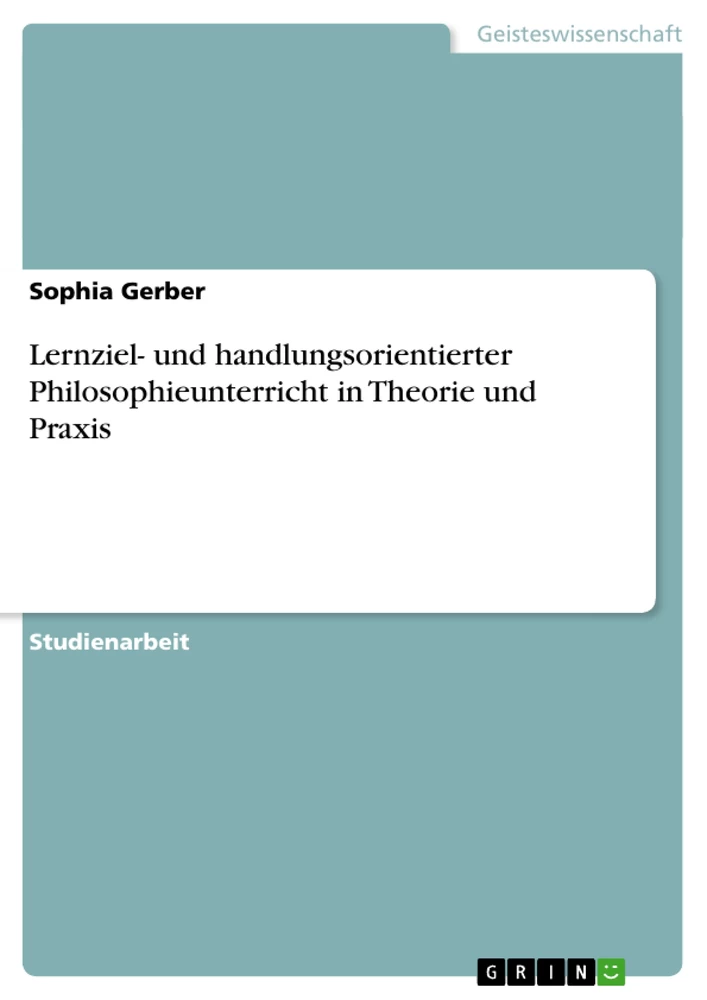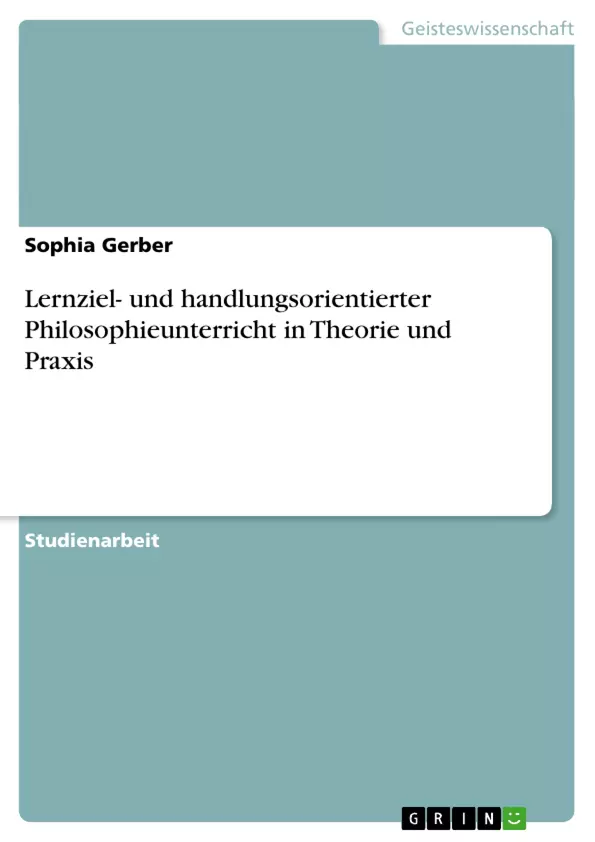Im September 2003 habe ich ein Praktikum am Liceo „G. e. Q. Sella“ absolviert, einem
staatlichen, allgemeinbildenden Gymnasium in Italien. Einen Monat lang durfte ich im
Philosophieunterricht der Oberstufe dieser Schule hospitieren sowie eigene Stunden gestalten
und durchführen. Bei der Hospitation fiel mir auf, dass die italienischen Philosophielehrer
im Allgemeinen den Lernzielorientierten Unterricht, eine eher lehrerzentrierte,
zweckrationale Methode, dem Handlungsorientierten Unterricht, einer eher schülerzentrierten,
offenen Methode, vorzogen. Im Folgenden sollen die beiden Methoden theoretisch
anhand ihrer jeweiligen historischen Entwicklung und Vertreter sowie ihrer Merkmale und
Planung dargestellt werden. Berücksichtigt werden dabei vor allem Forschungsbeiträge aus
der allgemeinen Didaktik, wie von Herbert Gudjons, Werner Jank, Hilbert Meyer, Ingbert
Martial, aber auch aus der Philosophiedidaktik, wie von Wulff D. Rehfus und Ekkehard
Martens. Zur Veranschaulichung der Methoden werden zwei Beispiele aus der Praxis des
Liceo herangezogen, und zwar eine konventionelle Philosophiestunde zur Erkenntnistheorie
Immanuel Kants und ein von mir selbst durchgeführtes Unterrichtsprojekt zu verschiedenen
Herangehensweisen an die Philosophie. Am Ende sollen die Chancen und Probleme
des Lernzielorientierten und Handlungsorientierten Unterrichts in Theorie und Praxis aufgezeigt
und ein nicht nur auf das italienische Schulsystem bezogener Ausblick gegeben
werden.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Die Lernzielorientierte Methode im Philosophieunterricht
- 1.1 Historische Entwicklung und Vertreter
- 1.2 Merkmale und Planung
- 1.3 Fallbeispiel: Unterrichtseinheit „Kants Erkenntnistheorie“
- 1.4 Chancen und Probleme
- 2. Die Handlungsorientierte Methode im Philosophieunterricht
- 2.1 Historische Entwicklung und Vertreter
- 2.2 Merkmale und Planung
- 2.3 Fallbeispiel: Unterrichtseinheit „Wege zur Philosophie“
- 2.4 Chancen und Probleme
- 3. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist die Darstellung und Diskussion des Lernzielorientierten und Handlungsorientierten Philosophieunterrichts in Theorie und Praxis. Die Arbeit analysiert die beiden Methoden anhand ihrer historischen Entwicklung, Vertreter, Merkmale und Planung, sowie anhand von Beispielen aus der Praxis.
- Historische Entwicklung des Lernzielorientierten und Handlungsorientierten Unterrichts
- Merkmale und Planung der beiden Methoden
- Beispiele aus der Praxis des Philosophieunterrichts
- Chancen und Probleme des Lernzielorientierten und Handlungsorientierten Unterrichts
- Bedeutung der beiden Methoden im Kontext des italienischen Schulsystems
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung
Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar und beschreibt die Motivation für die Untersuchung des Lernzielorientierten und Handlungsorientierten Unterrichts im Philosophieunterricht. Die Autorin beschreibt ihre Erfahrungen aus einem Praktikum am Liceo „G. e. Q. Sella“ in Italien, wo sie den Unterschied zwischen den beiden Unterrichtsmethoden beobachten konnte.
1. Die Lernzielorientierte Methode im Philosophieunterricht
Dieses Kapitel definiert den Lernzielorientierten Unterricht und seine historische Entwicklung. Es werden die wichtigsten Vertreter und theoretischen Grundlagen der Methode vorgestellt. Der Fokus liegt auf dem Konzept der Zweckrationalität und der transparenten Zielsetzung im Unterricht.
1.1 Historische Entwicklung und Vertreter
Die Entstehung des Lernzielorientierten Unterrichts wird im Kontext der Industrialisierung und des Bedürfnisses nach Bildung für die Arbeiterklasse erklärt. Die Arbeit stellt Johann Friedrich Herbart als Begründer des Modells vor und beschreibt dessen Zielsetzung und die Weiterentwicklung durch dessen Schüler.
1.2 Merkmale und Planung
Die Merkmale und Planungsaspekte des Lernzielorientierten Unterrichts werden vorgestellt. Dazu gehören die Definition von Lernzielen, die Auswahl von Inhalten, Methoden und Medien, sowie die Steuerung des Unterrichtsablaufs durch den Lehrer.
1.3 Fallbeispiel: Unterrichtseinheit „Kants Erkenntnistheorie“
Dieses Kapitel zeigt ein Beispiel aus der Praxis des Liceo „G. e. Q. Sella“, nämlich eine konventionelle Philosophiestunde zur Erkenntnistheorie Immanuel Kants. Es wird die Anwendung des Lernzielorientierten Unterrichts in diesem Fallbeispiel erläutert.
1.4 Chancen und Probleme
Dieses Kapitel analysiert die Chancen und Probleme des Lernzielorientierten Unterrichts. Es werden die Vor- und Nachteile der Methode hinsichtlich der Vermittlung von Wissen, der Entwicklung von Fähigkeiten und der Förderung von Selbstständigkeit diskutiert.
2. Die Handlungsorientierte Methode im Philosophieunterricht
Dieses Kapitel befasst sich mit der Handlungsorientierten Methode im Philosophieunterricht. Es werden die historischen Wurzeln, die Merkmale und die Planung dieser Methode dargestellt, sowie ein praktisches Beispiel aus der Praxis des Liceo „G. e. Q. Sella“ vorgestellt.
2.1 Historische Entwicklung und Vertreter
Die historischen Wurzeln und Vertreter des Handlungsorientierten Unterrichts werden hier beleuchtet. Dabei wird auch auf die Kritik an dem lehrerzentrierten Charakter des Lernzielorientierten Unterrichts eingegangen.
2.2 Merkmale und Planung
Dieses Kapitel behandelt die Merkmale und Planungsaspekte des Handlungsorientierten Unterrichts. Es werden die Unterschiede zum Lernzielorientierten Unterricht hinsichtlich der Zielsetzung, der Methoden, der Sozialformen und der Rolle des Lehrers erläutert.
2.3 Fallbeispiel: Unterrichtseinheit „Wege zur Philosophie“
Das Kapitel stellt ein von der Autorin selbst durchgeführtes Unterrichtsprojekt zum Thema „Wege zur Philosophie“ vor, das als Beispiel für den Einsatz der Handlungsorientierten Methode im Philosophieunterricht dient.
2.4 Chancen und Probleme
Dieses Kapitel untersucht die Chancen und Probleme des Handlungsorientierten Unterrichts. Es werden die Vor- und Nachteile der Methode hinsichtlich der Förderung von Selbstständigkeit, Kreativität und dem Aufbau von Kompetenzen diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den beiden wichtigen Methoden des Philosophieunterrichts: Lernzielorientierter und Handlungsorientierter Unterricht. Zu den Schlüsselbegriffen gehören: Zweckrationalität, transparente Zielsetzung, Frontalunterricht, Schüleraktivität, Selbstständigkeit, Kompetenzen, Kritik, Didaktik, Philosophiedidaktik, historische Entwicklung, Vertreter, Merkmale, Planung, Praxisbeispiele.
Häufig gestellte Fragen
Was unterscheidet lernziel- von handlungsorientiertem Unterricht?
Lernzielorientierter Unterricht ist eher lehrerzentriert und zweckrational, während handlungsorientierter Unterricht schülerzentriert und offen gestaltet ist.
Welche Methode wird im italienischen Philosophieunterricht bevorzugt?
Die Autorin beobachtete, dass italienische Lehrer tendenziell die lernzielorientierte Methode gegenüber der handlungsorientierten bevorzugen.
Was ist das Ziel des handlungsorientierten Philosophieunterrichts?
Er soll die Selbstständigkeit, Kreativität und Kompetenzentwicklung der Schüler durch aktives Tun und eigene Projekte fördern.
Wer sind wichtige Vertreter dieser didaktischen Ansätze?
Die Arbeit bezieht sich auf Forscher wie Hilbert Meyer, Werner Jank sowie die Philosophiedidaktiker Rehfus und Martens.
Welche Fallbeispiele werden in der Arbeit untersucht?
Untersucht werden eine Einheit zu Kants Erkenntnistheorie (lernzielorientiert) und ein Projekt zu verschiedenen Wegen der Philosophie (handlungsorientiert).
- Quote paper
- Sophia Gerber (Author), 2004, Lernziel- und handlungsorientierter Philosophieunterricht in Theorie und Praxis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36837