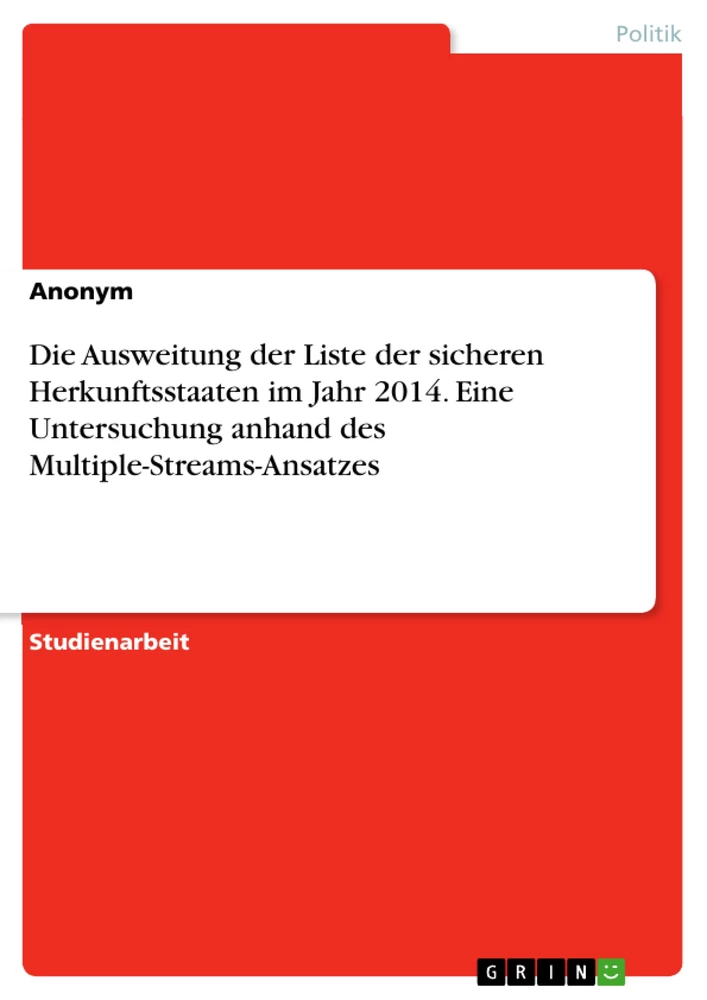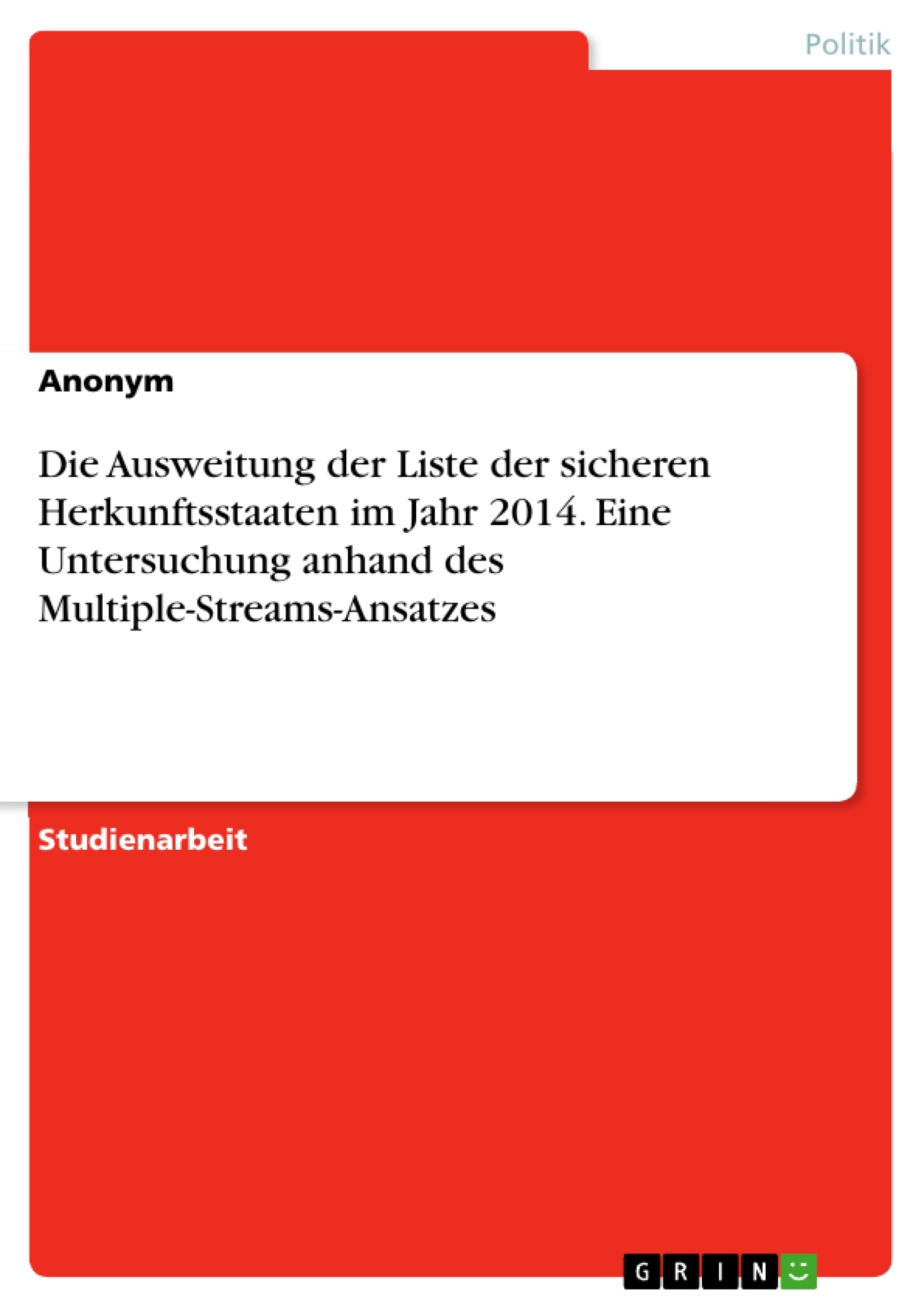"Die Asylberwerberzahlen rechtfertigen diese Lösung und verlangen danach. […] Allein im ersten Quartal dieses Jahres kam ein knappes Drittel aller Asylbewerber in Deutschland aus diesen Staaten, bei einer Anerkennungsquote von unter einem Prozent." (BMI 2014) Mit diesen Worten verteidigte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) den unter Federführung seines Ministeriums erarbeiteten „Entwurf eines Gesetzes zur Einstufung weiterer Staaten als sichere Herkunftsstaaten und zur Erleichterung des Arbeitsmarktzugangs für Asylbewerber und geduldete Ausländer“ gegenüber Pressevertretern am 30. April 2014. Besagter Gesetzesentwurf, der neben der Einstufung von Bosnien und Herzegowina, Mazedonien und Serbien als sichere Herkunftsstaaten nach § 29a des Asylgesetzes (AsylG) 1 , auch die Reduktion der Wartefrist von Asylbewerbern und geduldeten Ausländern für die Ausübung einer Arbeit auf drei Monate vorsah, wurde knapp ein halbes Jahr später, ermöglicht durch die Zustimmung der baden-württembergischen Landesregierung im Bundesrat, in unveränderter Form verabschiedet.
Im Rahmen dieser Hausarbeit gilt das Hauptinteresse der Ausweitung der Liste der sicheren Herkunftsstaaten. Denn seit 1993 wurde keine Staaten mehr dieser Liste hinzugefügt, auf der sich zuletzt nur noch Ghana und Senegal befanden. Hier drängt sich die Frage auf, wieso besagte Policy ausgerechnet im Jahr 2014 auf die Entscheidungsagenda gelangen konnte. Von wissenschaftlicher Relevanz ist diese Frage zum einen, da die Entstehung der Policy bis dato noch nicht vertiefend erforscht wurden und zum anderen, da sie den Auftakt einer weiteren Ausweitung der Liste der sicheren Herkunftsstaaten markiert, die 2015 um Albanien, Montenegro und Kosovo ergänzt wurde, und aktuell in Bezug auf Marokko, Algerien und Tunesien diskutiert wird. Um sich der Frage zu nähern, soll der Multiple-Streams-Ansatz, der in seinen Grundzügen auf die Ausführungen des amerikanischen Politikwissenschaftlers John W. Kingdon (1984) zurückgeht, den theoretischen Rahmen der Analyse bilden. Dieser eignet sich hervorragend, um zu erklären, weshalb Sachverhalte zu einem bestimmten Zeitpunkt auf die Agenda gelangen, was letztlich Voraussetzung für einen Policy-Wandel ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Rahmen – Der Multiple-Streams-Ansatz
- 2.1 Grundannahmen und Elemente
- 2.2 Kritische Würdigung
- 3. Die Liste der sicheren Herkunftsstaaten und ihre Ausweitung im Jahr 2014
- 4. Theoriegeleitete Analyse
- 4.1 Der Problemstrom
- 4.2 Der Politics-Strom
- 4.3 Der Policy-Strom
- 4.4 Policy-Fenster, Politischer Entrepreneur und Verkopplung der Ströme
- 5. Auswertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Ausweitung der Liste der sicheren Herkunftsstaaten im Jahr 2014 unter Anwendung des Multiple-Streams-Ansatzes. Ziel ist es, zu erklären, warum diese politische Entscheidung zu diesem Zeitpunkt getroffen wurde. Die Arbeit analysiert den Entstehungsprozess dieser Policy und trägt somit zur vertieften Erforschung eines bisher wenig untersuchten Politikfelds bei.
- Der Multiple-Streams-Ansatz als Erklärungsmodell für Policy-Wandel
- Analyse der Entwicklung des Problemstroms (Flüchtlingsstatistiken, kommunale Rückmeldungen)
- Untersuchung des Politics-Stroms (öffentliche Meinung, politische Akteure)
- Bewertung des Policy-Stroms (Machbarkeit, normative Akzeptanz, Widerstände)
- Rolle des politischen Entrepreneurs (Bundesinnenminister de Maizière)
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung präsentiert den Hintergrund der Ausweitung der Liste der sicheren Herkunftsstaaten im Jahr 2014, insbesondere die politische Debatte um die Aufnahme von Asylbewerbern aus bestimmten Ländern und die Rechtfertigung dieser Maßnahmen durch den damaligen Bundesinnenminister. Sie führt die Forschungsfrage ein – warum gelangte diese Policy-Entscheidung gerade 2014 auf die Agenda – und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, der auf dem Multiple-Streams-Ansatz basiert und qualitative Inhaltsanalysen von Dokumenten und Statistiken beinhaltet.
2. Theoretischer Rahmen - Der Multiple-Streams-Ansatz: Dieses Kapitel erläutert den Multiple-Streams-Ansatz (MSA) nach John W. Kingdon, seine Grundannahmen, Elemente und Kernaussagen. Es wird auf die Entwicklung des MSA als bedeutendes Analysemodell in der Policy-Forschung eingegangen und eine kritische Würdigung des Ansatzes vorgenommen. Das Kapitel legt somit die theoretische Grundlage für die anschließende Analyse der Ausweitung der Liste der sicheren Herkunftsstaaten.
3. Die Liste der sicheren Herkunftsstaaten und ihre Ausweitung im Jahr 2014: Dieses Kapitel beschreibt die Geschichte der Liste der sicheren Herkunftsstaaten, die lange Zeit unverändert blieb und erst 2014 erweitert wurde. Es werden die Staaten genannt, die hinzugefügt wurden (Bosnien und Herzegowina, Mazedonien und Serbien), und der Kontext der Gesetzesänderung wird beleuchtet. Die Reichweite des Policy-Wandels wird im Hinblick auf seine Bedeutung für das Asylsystem eingeordnet.
4. Theoriegeleitete Analyse: Hier wird der Multiple-Streams-Ansatz angewendet, um die Ausweitung der Liste zu erklären. Die Analyse gliedert sich in die drei Ströme: Problemstrom (Analyse von Flüchtlingsstatistiken und Rückmeldungen der Kommunen), Politics-Strom (Analyse der öffentlichen Meinung) und Policy-Strom (Analyse des Gesetzesentwurfs hinsichtlich Machbarkeit, Akzeptanz und Widerständen). Der Einfluss des Bundesinnenministers als politischer Entrepreneur und das Zusammenspiel der Ströme im Policy-Fenster werden untersucht.
Schlüsselwörter
Multiple-Streams-Ansatz, Agenda-Setting, sichere Herkunftsstaaten, Asylpolitik, Flüchtlingszahlen, Policy-Wandel, politischer Entrepreneur, Bundesinnenministerium, qualitative Inhaltsanalyse.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Ausweitung der Liste sicherer Herkunftsstaaten 2014
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Ausweitung der Liste der sicheren Herkunftsstaaten im Jahr 2014. Sie analysiert den politischen Entscheidungsprozess, der zu dieser Erweiterung führte, und erklärt, warum diese politische Entscheidung zu diesem Zeitpunkt getroffen wurde.
Welches theoretische Modell wird verwendet?
Die Arbeit verwendet den Multiple-Streams-Ansatz (MSA) nach John W. Kingdon als analytisches Rahmenmodell. Dieser Ansatz betrachtet den Policy-Wandel als Ergebnis des Zusammentreffens von drei Strömen: Problemstrom, Politics-Strom und Policy-Strom.
Welche Ströme werden im Detail analysiert?
Die Analyse umfasst eine detaillierte Untersuchung des Problemstroms (basierend auf Flüchtlingsstatistiken und Rückmeldungen der Kommunen), des Politics-Stroms (öffentliche Meinung, politische Akteure) und des Policy-Stroms (Machbarkeit, normative Akzeptanz, Widerstände der Gesetzesänderung).
Welche Rolle spielt der politische Entrepreneur?
Die Arbeit untersucht die Rolle des damaligen Bundesinnenministers de Maizière als politischer Entrepreneur und seinen Einfluss auf den Prozess der Erweiterung der Liste der sicheren Herkunftsstaaten.
Welche Methode wird angewendet?
Die Analyse basiert auf einer qualitativen Inhaltsanalyse von Dokumenten und Statistiken.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit ist gegliedert in eine Einleitung, ein Kapitel zum theoretischen Rahmen (Multiple-Streams-Ansatz), ein Kapitel zur Beschreibung der Ausweitung der Liste der sicheren Herkunftsstaaten 2014, ein Kapitel zur theoriegeleiteten Analyse und eine Auswertung. Die Einleitung beschreibt den Hintergrund, die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz. Die Zusammenfassung der Kapitel bietet einen detaillierten Überblick über den Inhalt jedes Kapitels.
Welche Länder wurden 2014 zur Liste der sicheren Herkunftsstaaten hinzugefügt?
Im Jahr 2014 wurden Bosnien und Herzegowina, Mazedonien und Serbien zur Liste der sicheren Herkunftsstaaten hinzugefügt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Multiple-Streams-Ansatz, Agenda-Setting, sichere Herkunftsstaaten, Asylpolitik, Flüchtlingszahlen, Policy-Wandel, politischer Entrepreneur, Bundesinnenministerium, qualitative Inhaltsanalyse.
Wo finde ich weitere Informationen zum Multiple-Streams-Ansatz?
Das Kapitel zum theoretischen Rahmen bietet eine detaillierte Erklärung des Multiple-Streams-Ansatzes und verweist auf die Arbeiten von John W. Kingdon. Weitere Informationen können über wissenschaftliche Literatur zum Thema Policy-Analyse und Agenda-Setting recherchiert werden.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2017, Die Ausweitung der Liste der sicheren Herkunftsstaaten im Jahr 2014. Eine Untersuchung anhand des Multiple-Streams-Ansatzes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/368394