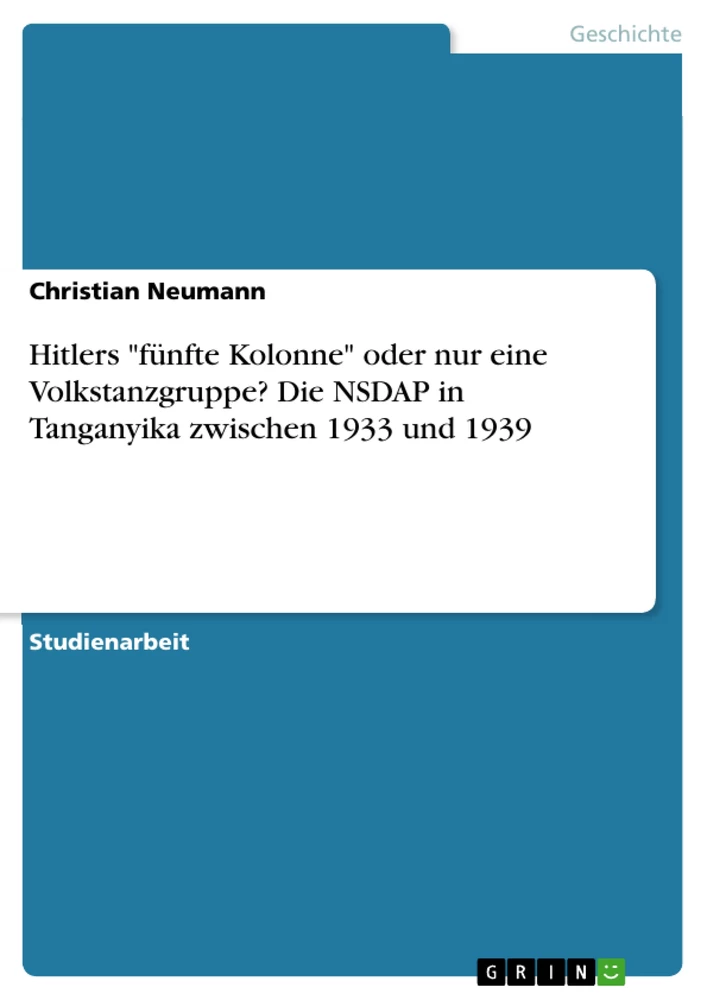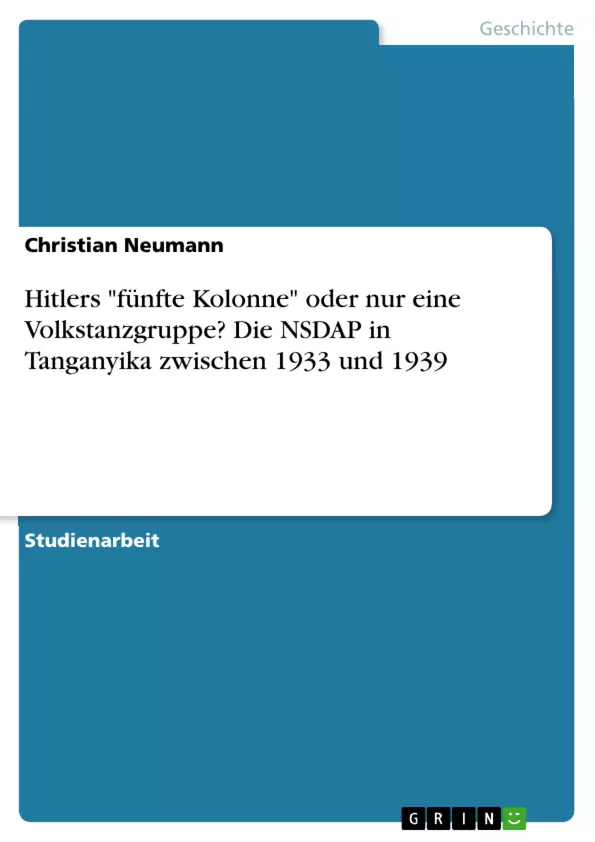In dieser Arbeit soll der Einfluss der NSDAP auf die deutschen Siedler und Missionare sowie die Reaktion der britischen Behörden, der britischen Siedler und der einheimischen Inder darauf untersucht werden. Die beiden Exkolonien waren beide als Siedlerkolonien geplant, jedoch hatten sie nach dem 1.Weltkrieg eine unterschiedliche Geschichte. Die Mandatsmacht von Südwestafrika, die Südafrikanische Union, wies nur Funktionsträger der deutschen Kolonialregierung aus. Alle anderen Siedler blieben im Land. In Tanganyika dagegen mussten alle deutschen Staatsangehörigen die Kolonie verlassen. Diese Arbeit beschränkt sich auf das letztere Gebiet, da hier mit besonderem Ehrgeiz eine Wiederbesiedlung mit Deutschen betrieben wurde. Mit Beginn des 2. Weltkriegs wurden fast alle Deutschen interniert oder mussten das Land verlassen.
Seit 1926, als Deutschland Mitglied im Völkerbund wurde, war es deutschen Staatsangehörigen wieder erlaubt, sich in Tanganyika niederzulassen. Der Status der ehemals deutschen Kolonien als Mandatsgebiet des Völkerbundes wurde in Deutschland so interpretiert, dass eine Rückgabe an Deutschland in absehbarer Zeit möglich sein würde. Deutsche Siedler, in erster Linie in Südwestafrika und Tanganyika, waren ein Argument dafür. Deshalb wurde die Auswanderung dorthin vom Staat als Volkstumspflege gefördert. Die NSDAP hatte schon vor ihrer Machtergreifung Ortsgruppen in diesen beiden Ländern gegründet, war aber erst seit 1933 in der Lage flächendeckend präsent zu sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Deutsche im Ausland nach dem 1. Weltkrieg
- Versailles und das deutsche Kolonialreich
- Volkstumspolitik, Versailles und die Auslandsdeutschen
- Die Auslandsorganisation der NSDAP
- Aus der Geschichte der Auslandsorganisation
- Die NSDAP AO in Tanganyika und der Deutsche Bund
- Vermutungen und Reaktionen der Briten
- Tanganyika und das Sudetenland
- Die Auslandsorganisation und ihre Landsleute
- Evangelische Mission, die Schulen und der Deutsche Bund
- Missionar und Parteifunktionär, ein „afrikanischer\" Antisemitismus
- Katholische Mission und die NSDAP
- Devisenbewirtschaftung
- Spionage
- Fazit
- Abkürzungen
- Quellen
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss der Auslandsorganisation (AO) der NSDAP in Tanganyika zwischen 1933 und 1939. Sie untersucht, wie die AO versuchte, ihre Ziele in diesem Gebiet zu erreichen, und welche Auswirkungen sie auf die deutsche Gemeinschaft hatte. Der Fokus liegt dabei auf der Rolle der AO im Kontext der kolonialen Geschichte und der deutschen Volkstumspolitik.
- Der Einfluss der Auslandsorganisation der NSDAP auf die deutsche Gemeinschaft in Tanganyika
- Die Rolle der AO im Kontext der kolonialen Geschichte
- Die Beziehung zwischen der AO und den deutschen Missionsgesellschaften
- Die Reaktion der britischen Kolonialverwaltung auf die Aktivitäten der AO
- Die Bedeutung der AO für die deutsche Politik in Afrika
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage sowie die methodischen Herangehensweisen vor. Das zweite Kapitel skizziert die Situation der Deutschen im Ausland nach dem Ersten Weltkrieg, insbesondere im Kontext der Versailler Verträge und des Verlusts des deutschen Kolonialreiches. Das dritte Kapitel beschreibt die Auslandsorganisation der NSDAP und deren historische Entwicklung. Der vierte und fünfte Abschnitt beleuchten die Vermutungen und Reaktionen der Briten auf die Aktivitäten der AO in Tanganyika und die politische Entwicklung im Sudetenland und deren Einfluss auf die Situation vor Ort. Der sechste Abschnitt analysiert die Rolle der AO im Leben der deutschen Bevölkerung in Tanganyika, insbesondere in den Bereichen der evangelischen Mission, der Schulen und des Deutschen Bundes. Abschließend wird in einem Fazit eine Bewertung der realen Möglichkeiten der AO in Tanganyika unter den gegebenen Umständen gegeben.
Schlüsselwörter
Auslandsorganisation der NSDAP, Tanganyika, Kolonialismus, Deutsche im Ausland, Volkstumspolitik, Mission, Spionage, britische Kolonialverwaltung.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hatte die NSDAP in Tanganyika zwischen 1933 und 1939?
Die Auslandsorganisation (AO) der NSDAP versuchte, die deutschen Siedler und Missionare im Sinne der NS-Ideologie zu koordinieren und auf eine mögliche Rückgabe der Kolonie vorzubereiten.
Warum durften sich Deutsche nach dem 1. Weltkrieg wieder in Tanganyika niederlassen?
Nach dem Beitritt Deutschlands zum Völkerbund 1926 wurde deutschen Staatsangehörigen die Rückkehr in das ehemalige Mandatsgebiet wieder gestattet.
Wie reagierten die britischen Behörden auf die NSDAP-Aktivitäten?
Die Briten beobachteten die Aktivitäten mit Argwohn und Misstrauen, was bei Ausbruch des 2. Weltkriegs zur Internierung oder Ausweisung fast aller Deutschen führte.
Welche Rolle spielten die christlichen Missionen in diesem Kontext?
Die Arbeit untersucht das Spannungsfeld zwischen Missionsarbeit und Parteifunktionären, wobei insbesondere die evangelische Mission stark unter den Einfluss der NS-Volkstumspolitik geriet.
Was war der „Deutsche Bund“ in Tanganyika?
Der Deutsche Bund war die Organisation, in der die NSDAP AO ihre politischen Ziele innerhalb der deutschen Gemeinschaft vor Ort bündelte.
Gab es Spionageaktivitäten der NSDAP in der Region?
Ein Kapitel der Arbeit widmet sich explizit den Vermutungen und Belegen für Spionage durch deutsche Staatsangehörige im Auftrag der Auslandsorganisation.
- Quote paper
- Christian Neumann (Author), 2017, Hitlers "fünfte Kolonne" oder nur eine Volkstanzgruppe? Die NSDAP in Tanganyika zwischen 1933 und 1939, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/368416