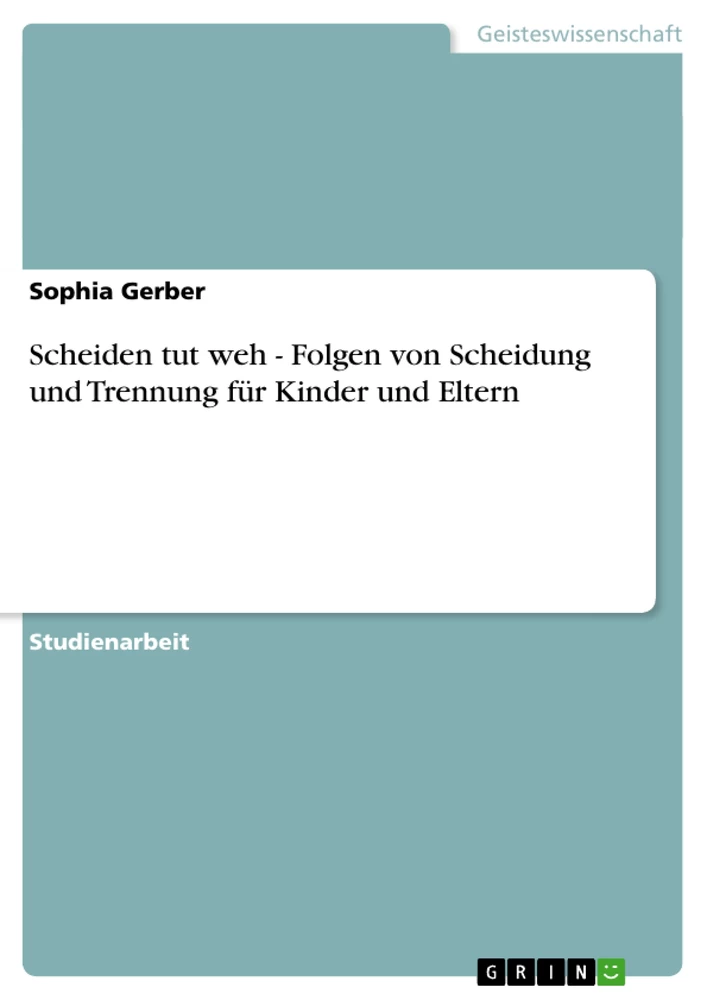Jährlich sind fast 150.000 Kinder in Deutschland von einer Scheidung betroffen; 1,7 Millionen Kinder leben mit nur einem Elternteil zusammen (cf. ). Für die Kinder bedeutet das, Übergänge von einer Familienform in eine andere bewältigen zu müssen, die mit weitreichenden Veränderungen in ihrem Leben verbunden sind. Für die Eltern stellt die Trennung bzw. Scheidung oftmals die Lösung ihrer Partnerprobleme dar und eröffnet neue Perspektiven der Lebensgestaltung. Im Folgenden soll die Frage erörtert werden, wie sich eine Familientrennung als kritisches Lebensereignis auf die einzelnen Familienmitglieder auswirken kann und welche Aufgaben mit ihr verbunden sind. Dabei sollen sowohl die Perspektive der Kinder und Jugendlichen als auch die der Eltern berücksichtigt und die jeweiligen Reaktionen, positiven und negativen, kurzfristigen und langfristigen Folgen sowie die jeweiligen scheidungsbezogenen Entwicklungsaufgaben dargestellt werden. Hierbei werden aktuelle Forschungen zur Entwicklungs- und Familienpsychologie verschiedener Autoren herangezogen, wie von Renate Niesel, Wilfried Griebel, Wassilios E. Fthenakis, Peter Strunk, Gerd Oberndorfer und Sabine Walper. Abschließend sollen die Ergebnisse resümiert und ein Ausblick auch hinsichtlich der Hilfemöglichkeiten in Trennungs- und Scheidungssituationen gegeben werden.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Trennung und Scheidung aus der Perspektive der Kinder und Jugendlichen
- 1.1 Mögliche Reaktionen und Folgen
- 1.2 Scheidungsbezogene Aufgaben
- 2. Trennung und Scheidung aus der Perspektive der Eltern
- 2.1 Mögliche Reaktionen und Folgen
- 2.2 Scheidungsbezogene Aufgaben
- 3. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Folgen von Trennung und Scheidung für Kinder und Eltern. Sie beleuchtet, wie sich eine Familientrennung als kritisches Lebensereignis auf die einzelnen Familienmitglieder auswirken kann und welche Aufgaben mit ihr verbunden sind. Dabei werden die Perspektiven der Kinder und Jugendlichen sowie der Eltern betrachtet und die jeweiligen Reaktionen, sowohl positive als auch negative, kurzfristige und langfristige Folgen sowie die scheidungsbezogenen Entwicklungsaufgaben dargestellt.
- Die Auswirkungen von Trennung und Scheidung auf Kinder und Jugendliche
- Die Reaktionen und Folgen von Trennung und Scheidung für Eltern
- Scheidungsbezogene Aufgaben für Kinder und Jugendliche
- Scheidungsbezogene Aufgaben für Eltern
- Hilfemöglichkeiten in Trennungs- und Scheidungssituationen
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung
Die Arbeit befasst sich mit den Folgen von Trennung und Scheidung für Kinder und Eltern. Sie stellt die Relevanz des Themas dar, indem sie auf die hohe Anzahl betroffener Kinder in Deutschland hinweist und die Bedeutung der Bewältigung von Veränderungen in ihrem Leben betont. Die Einleitung gibt zudem einen Ausblick auf die Schwerpunkte der Arbeit.
1. Trennung und Scheidung aus der Perspektive der Kinder und Jugendlichen
1.1 Mögliche Reaktionen und Folgen
Dieser Abschnitt beschreibt die Unsicherheit, die Kinder vor und während einer Scheidung erleben, da sie selten in den elterlichen Konflikt eingeweiht werden. Er beleuchtet die verschiedenen Reaktionen von Kindern auf eine Trennung, die sich je nach Altersgruppe unterscheiden. Es werden sowohl die negativen Auswirkungen (z.B. Angst, Trauer, Schulschwierigkeiten) als auch positive Entwicklungen (z.B. Stärkung der Beziehung zum alleinerziehenden Elternteil) aufgezeigt.
1.2 Scheidungsbezogene Aufgaben
Der Abschnitt behandelt die psychischen Aufgaben, die Kinder nach einer Trennung zu bewältigen haben. Es geht darum, die Trennung zu akzeptieren, mit Verlust- und Schuldgefühlen umzugehen und eine neue Familiensituation zu etablieren.
Häufig gestellte Fragen
Welche Auswirkungen hat eine Scheidung auf Kinder in verschiedenen Altersgruppen?
Die Reaktionen variieren stark: Während jüngere Kinder oft mit Angst und Verlustgefühlen reagieren, können bei Jugendlichen Schulschwierigkeiten oder Rückzug auftreten. Es gibt jedoch auch positive Folgen, wie eine engere Bindung zum alleinerziehenden Elternteil.
Was sind die wichtigsten psychischen Aufgaben für Scheidungskinder?
Kinder müssen lernen, die Trennung als endgültig zu akzeptieren, ihre Schuldgefühle abzubauen und sich an die neue Lebenssituation in zwei getrennten Haushalten anzupassen.
Wie erleben Eltern den Prozess der Trennung?
Für Eltern ist die Scheidung oft ein zweischneidiges Ereignis: Einerseits bedeutet sie das Ende belastender Konflikte, andererseits bringt sie große emotionale Belastungen und organisatorische Herausforderungen mit sich.
Warum fühlen sich Kinder oft schuldig an der Scheidung ihrer Eltern?
Da Kinder oft nicht in die wahren Gründe des elterlichen Konflikts eingeweiht werden, beziehen sie die Trennung in ihrer egozentrischen Sichtweise häufig fälschlicherweise auf ihr eigenes Verhalten.
Welche Hilfemöglichkeiten gibt es für Familien in Trennungssituationen?
Die Arbeit verweist auf Erziehungsberatungsstellen, Mediation und familienpsychologische Angebote, die dabei helfen, den Übergang für alle Beteiligten schonender zu gestalten.
- Quote paper
- Sophia Gerber (Author), 2004, Scheiden tut weh - Folgen von Scheidung und Trennung für Kinder und Eltern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36843