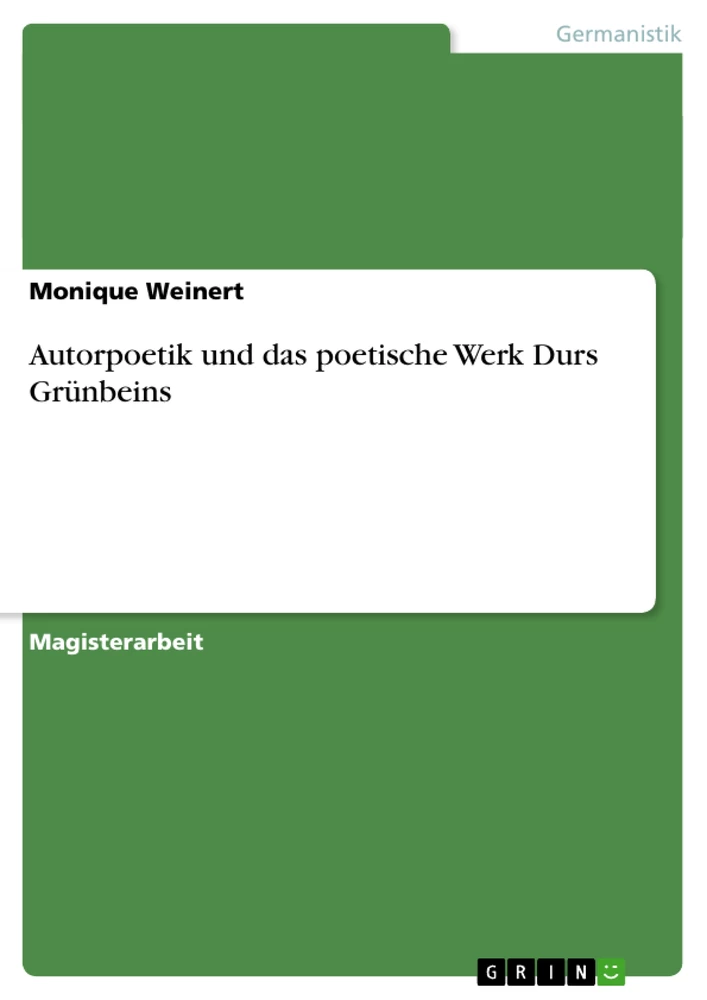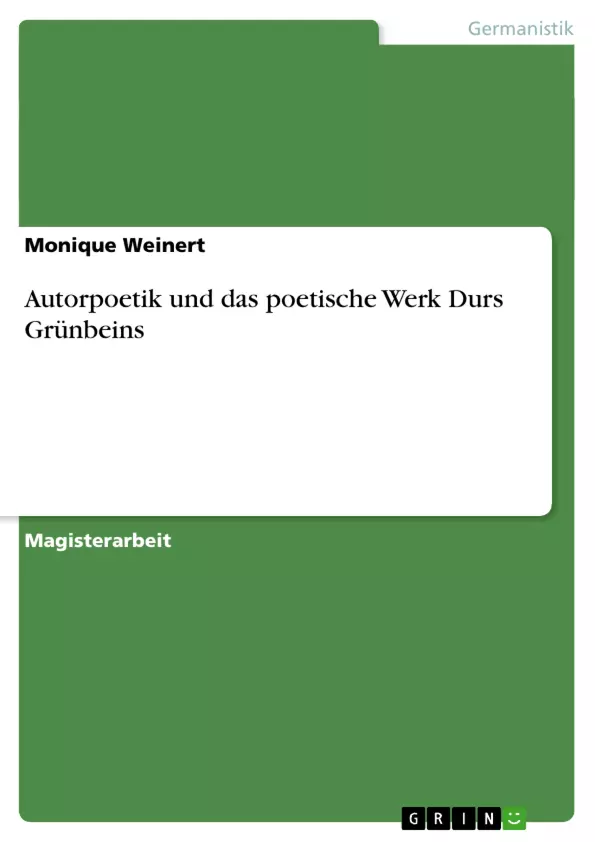Durs Grünbein, Georg Büchner-Preisträger von 1995 und damit einer der jüngsten Lyriker im poetischen Olymp, darüber hinaus Verfasser diverser Aufsätze und reflektierender Texte, mag in Kenner- und Kritikerkreisen umstritten, dem einen „Götterliebling“ , dem anderen „ein bedeutendes Talent, das sich von Zeit zu Zeit verschwendet“ sein, davon unberührt bleibt jedoch die Tatsache, dass er mit Leib und – nun ja – Leib Dichter ist, dessen Leben sich nun einmal um die kleine, abgesteckte Welt von „Poesie, dem geliebten Partner, [mittlerweile auch der Tochter], und durchaus dem Whisky“ dreht – wenngleich allein die Poesie Grünbeins thematisch durchaus unsere ganze Welt innerhalb der Dimensionen Raum und Zeit abtastet.
Wann genau die Lyrik ihre ersten Keime in Grünbein legte, weiß er selbst nicht genau zu sagen. Vielleicht war „da ein Ansatz, irgendein Zeichen für eine Poetik des Ersten Augenblicks“ auf dem Vesuv seiner Kindheitserinnerung, jenem Müllberg – „ein Stillleben im zerbrochenen Rahmen“ – bei seiner Heimatstadt Dresden . Vielleicht waren es aber auch erst „Novalis’ Hymnen an die Nacht“ , die den damals Fünfzehnjährigen derartig prägten, dass „es nicht lange dauern“ konnte, bis auch er anfing zu schreiben. „Mit siebzehn“ folgten dann die ersten „Notizen […], kleine emphatische Schreiberein, die wie Gedichte aussahen und nur im engsten Kreis vorzeigbar waren“ (V 39). Denkbar, sie legten den ersten Grundstein für den „Versuch einer Poetik“ (V 39). Dem folgte die Berührung mit „Baudelaire“ und den „Cantos des Ezra Pound“, die den nun Achtzehnjährigen „jung und zitatengeil“ hinterließen. Für „jede literarische Einflüsterung offen“ hat ihn „unmerklich […] das Studium überkommen, seine erste recherche“ (E 63).
Sein geheimer Kontrakt mit der Zeit, durch frühe Lektüre geschlossen, ist mit einem Mal rechtskräftig geworden. Er marschiert durch die Hintergründe, liest sich durch Fußnoten und Bibliographien und entdeckt den Zauber der Anspielung im Nebensatz. Was er jetzt von sich gibt, sich großspurig herausnimmt, nennt er selbst, verführt von neusachlicher coolness, Versuche. Der Euphemismus Gedichte bleibt lange Tabu.
Inhaltsverzeichnis
- 0 Einleitung
- 1 Autorpoetik
- 1.1 Begriffsklärung
- 1.2 Konzept
- 1.2.1 Dichtung und Körper
- 1.2.2 Dichtung und >Ich
- 1.2.3 Gedicht und »Ich« auf Sendung
- 1.2.4 Gedicht. Einschneidend
- 1.2.5 Autorpoetik. Kompakt
- 2 Poetisches Werk und Autorpoetik
- 2.1 >GRAUZONE MORGENS
- 2.2 >SCHÄDELBASISLEKTION
- 2.2.1 Lektionen des Körpers
- 2.2.1.1 Fünf „Lektionen im Auftrag der Ernüchterung“
- 2.2.1.2 >Den Körper zerbrechen<. Büchner als Verkörperung der Idee einer somatischen Poesie
- 2.2.2 Imagination und Wirklichkeit
- 2.2.2.1 >Galilei vermisst Dantes Hölle und bleibt an den Maßen hängen<. Der reduktive Rationalismus Galileis vs. Dante als Verkörperung der Idee einer imagistischen Poesie.
- 2.2.2.2 „Poetik der Präsenz“
- 2.2.2.3 >Inframince<. Von Eigenwelten und Missverständnissen
- 2.2.2.4 >Niemands Land Stimmen<. Von den Schwierigkeiten, die heutige Wirklichkeit im Sinne der an Dante entwickelten Poetik in Anschauung zu verwandeln
- 2.2.2.5 Vergegenwärtigung des Todes. Ausblick auf die Epitaphe ›Den Teuren Toten‹
- 2.3 >NACH DEN SATIREN
- 2.3.1 Vier Postsatiren
- 2.3.1.1 >Postsatire I<. Im Dickicht der Großstadt
- 2.3.1.2 >Postsatire II<. Fazit im dreißigsten Jahr
- 2.3.1.3 >Postsatire III<. Baustelle Berlin
- 2.3.1.4 >Postsatire IV<. Zwiegespräch
- 2.3.2 Grünbein und die Antike
- 3 Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Autorpoetik von Durs Grünbein, indem sie seine lyrischen Werke und seine Reflexionen über das Schreiben analysiert. Ziel ist es, Grünbeins poetologisches Programm zu rekonstruieren und seine zentralen Themen und poetischen Verfahren zu identifizieren.
- Der Einfluss der literarischen Tradition auf Grünbeins Werk
- Die Rolle des Körpers und der sinnlichen Wahrnehmung in Grünbeins Dichtung
- Die Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und deren Fragmentierung
- Das Verhältnis von Imagination und Realität in Grünbeins Poesie
- Grünbeins Umgang mit Intertextualität und Zitation
Zusammenfassung der Kapitel
0 Einleitung: Die Einleitung stellt Durs Grünbein als bedeutenden Lyriker vor und skizziert die Entwicklung seiner poetischen Interessen, beginnend mit frühen Einflüssen wie Novalis und später Ezra Pound. Sie betont die körperliche und sinnliche Dimension von Grünbeins Schreiben und kündigt die zentrale These der Arbeit an: Grünbeins Poetik wurzelt in der sinnlich-körperlichen Wahrnehmung und der Auseinandersetzung mit einer als fragmentiert erlebten Wirklichkeit. Der Einfluss seiner sozialistischen Erziehung in der DDR und seine daraus resultierende "behavioristische" Prägung werden als wichtige Faktoren für sein poetisches Schaffen hervorgehoben.
1 Autorpoetik: Dieses Kapitel befasst sich mit der Begriffsklärung von Autorpoetik und legt das Konzept für die folgende Analyse der Werke Grünbeins dar. Es untersucht die Beziehung zwischen Dichtung und Körper, Dichtung und dem lyrischen Ich, und analysiert die spezifischen Merkmale von Grünbeins Gedichtverständnis. Der Fokus liegt auf der Entwicklung einer umfassenden Definition der Autorpoetik, die als Grundlage für die anschließende Auseinandersetzung mit Grünbeins Werk dient. Es werden die verschiedenen Einflüsse auf Grünbeins Poetik beleuchtet, um ein fundiertes Verständnis seines Schreibprozesses und seiner künstlerischen Intentionen zu schaffen.
2 Poetisches Werk und Autorpoetik: Dieses Kapitel analysiert ausgewählte Gedichte und Prosatexte von Grünbein im Lichte der zuvor entwickelten Autorpoetik. Anhand der Werke „Grauzone Morgens“, „Schädelbasislektion“ und „Nach den Satiren“ werden die zentralen Themen wie die Auseinandersetzung mit dem Körper, die Fragmentierung der Wirklichkeit und der Umgang mit der literarischen Tradition exemplarisch untersucht. Die Analyse deckt die verschiedenen Facetten Grünbeins poetischer Praxis auf – von seiner Auseinandersetzung mit der Antike bis hin zu den modernen Großstadtlandschaften. Die Kapitel verfolgen die Spuren der körperlichen Erfahrung, der Imagination und der Reflexion über das Schreiben selbst. Es verbindet die theoretischen Überlegungen des ersten Kapitels mit konkreten Beispielen aus Grünbeins poetischem Œuvre, um die komplexe Interaktion zwischen Autor, Text und Wirklichkeit zu erhellen.
Schlüsselwörter
Durs Grünbein, Autorpoetik, Lyrik, Körper, Sinnlichkeit, Imagination, Realität, Fragmentierung, Intertextualität, Zitation, literarische Tradition, sozialistische Erziehung, DDR, Poetik, Bewusstseinseinschübe, physische Wahrnehmung, Textuelle Organisation, Imagistische Poesie, Somatische Poesie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Autorpoetik bei Durs Grünbein"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Autorpoetik des Lyrikers Durs Grünbein. Sie analysiert seine lyrischen Werke und Reflexionen über das Schreiben, um sein poetologisches Programm und seine zentralen Themen sowie poetischen Verfahren zu rekonstruieren.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit dem Einfluss der literarischen Tradition auf Grünbeins Werk, der Rolle des Körpers und der sinnlichen Wahrnehmung in seiner Dichtung, der Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und deren Fragmentierung, dem Verhältnis von Imagination und Realität, und Grünbeins Umgang mit Intertextualität und Zitation.
Welche Werke von Durs Grünbein werden analysiert?
Die Arbeit analysiert ausgewählte Gedichte und Prosatexte Grünbeins, insbesondere "Grauzone Morgens", "Schädelbasislektion" und "Nach den Satiren".
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Autorpoetik, ein Kapitel zur Analyse ausgewählter Werke im Lichte der Autorpoetik und ein Resümee. Sie enthält zudem ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Was versteht die Arbeit unter Autorpoetik?
Die Arbeit entwickelt eine umfassende Definition von Autorpoetik, die die Beziehung zwischen Dichtung und Körper, Dichtung und dem lyrischen Ich, sowie die spezifischen Merkmale von Grünbeins Gedichtverständnis untersucht. Sie beleuchtet die verschiedenen Einflüsse auf Grünbeins Poetik, um sein Schreibprozess und seine künstlerischen Intentionen zu verstehen.
Welche zentralen Thesen vertritt die Arbeit?
Ein zentrales Argument der Arbeit ist, dass Grünbeins Poetik in der sinnlich-körperlichen Wahrnehmung und der Auseinandersetzung mit einer als fragmentiert erlebten Wirklichkeit wurzelt. Der Einfluss seiner sozialistischen Erziehung in der DDR wird als wichtiger Faktor für sein poetisches Schaffen hervorgehoben.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Durs Grünbein, Autorpoetik, Lyrik, Körper, Sinnlichkeit, Imagination, Realität, Fragmentierung, Intertextualität, Zitation, literarische Tradition, sozialistische Erziehung, DDR, Poetik, Bewusstseinseinschübe, physische Wahrnehmung, Textuelle Organisation, Imagistische Poesie, Somatische Poesie.
Wie wird die Analyse der Werke Grünbeins durchgeführt?
Die Analyse der Werke erfolgt im Kontext der zuvor entwickelten Definition der Autorpoetik. Sie untersucht die verschiedenen Facetten von Grünbeins poetischer Praxis, von der Auseinandersetzung mit der Antike bis hin zu modernen Großstadtlandschaften, und verfolgt die Spuren der körperlichen Erfahrung, der Imagination und der Reflexion über das Schreiben.
Welche Rolle spielt die körperliche Wahrnehmung in Grünbeins Dichtung?
Die Arbeit betont die körperliche und sinnliche Dimension von Grünbeins Schreiben. Der Körper und die sinnliche Wahrnehmung sind zentrale Elemente seiner Poetik und werden in der Analyse der Werke ausführlich behandelt.
Wie setzt sich Grünbein mit der Wirklichkeit auseinander?
Grünbein setzt sich mit einer als fragmentiert erlebten Wirklichkeit auseinander. Die Arbeit analysiert, wie diese Fragmentierung in seinen Werken zum Ausdruck kommt und wie er mit den Herausforderungen einer solchen Wahrnehmung umgeht.
- Citar trabajo
- Monique Weinert (Autor), 2004, Autorpoetik und das poetische Werk Durs Grünbeins, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36847