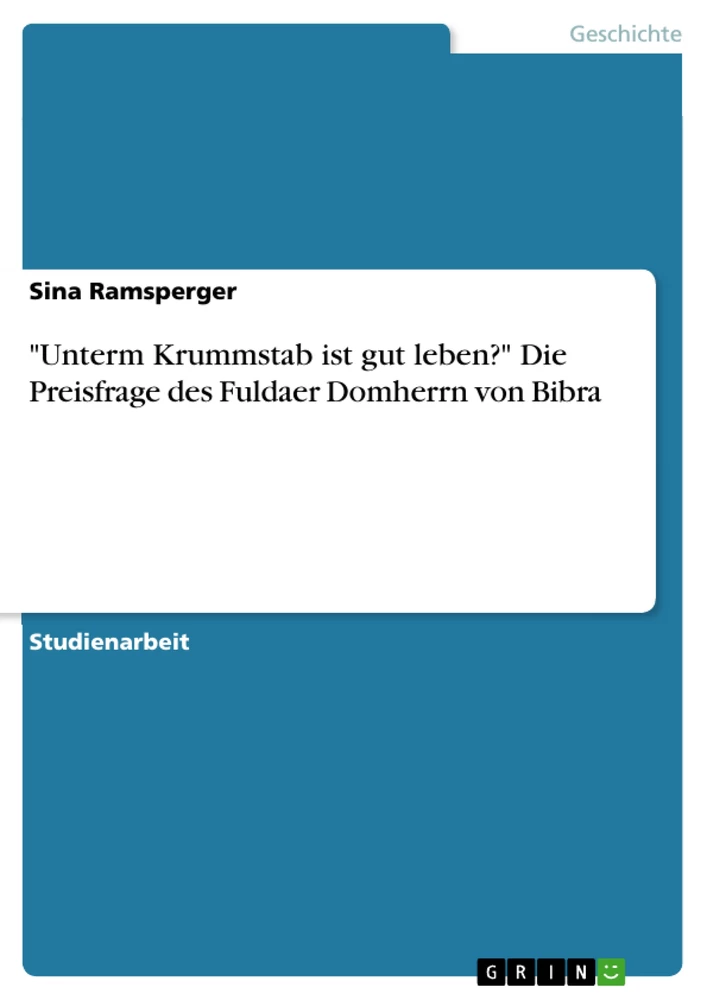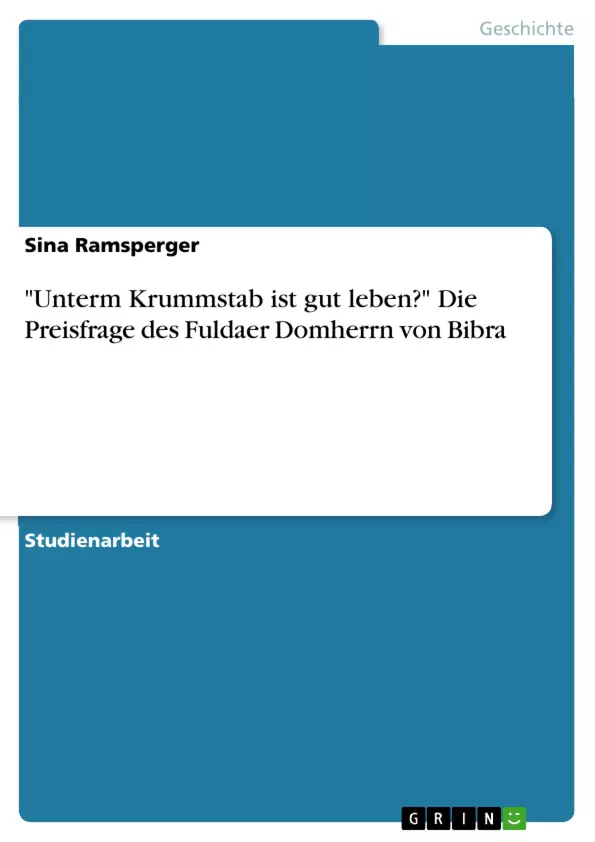Um nachzuvollziehen, in welchem historischen Kontext der Fuldaer Domherr Philipp Anton von Bibra seine Preisfrage gestellt hat, wird zunächst wird die Ausgangslage beschrieben. Dabei ist aber eine differenzierte Betrachtungsweise von Nöten: Sowohl die positiven als auch die negativen Aspekte der „Krummstabländer“ werden betrachtet und mit den protestantischen Gebieten verglichen. Dazu wird insbesondere auf die Punkte eingegangen, welche die Verfasser der Preisschriften bemängelt haben.
Um die Hintergründe Bibras zu ergründen, und auch auf die Bedeutung seiner Frage eingehen zu können, wird seine Biografie im nächsten Punkt vorgestellt. Dies geschieht recht ausführlich, damit das scheinbar antagonistische Dasein Bibras als Geistlicher und Aufklärer gedeutet werden kann.
Anschließend werden drei ausgewählte Preisschriften, von Joseph von Sartori5, Friedrich Carl Freiherr von Moser6 und Joseph Andreas Schnaubert, inhaltlich dargelegt. Dabei wird zunächst auf den Hintergrund der Teilnehmer des Preisausschreibens eingegangen. Anschließend wird lediglich Bezug auf den Grundtenor genommen, eine detailliertere Analyse erfolgt im Punkt 3.3.
Die Schriften explizit dieser drei Autoren werden vorgestellt, da sie als Zeugnis der Disputation dienen, die zu dieser Zeit in der Reichskirche geherrscht hat. Darüber hinaus nehmen sie, gerade was die Wahlkapitulationen und die Wahl an sich betreffen, konträre Position ein, was Wiederholungen verhindert. Die Ergebnisse der Arbeiten Sartoris, Mosers und Schnauberts werden daraufhin bezüglich des Bildes, das sie von der Geistlichkeit haben, dem Sozialwesen, der Erziehung und Wahlkapitulationen verglichen.
Bewusst wurde hier eine Doppelung der im zweiten Punkt „Ausgangslage“ vorgestellten Aspekte vermieden, um ein weiter fassendes Bild der geistlichen Staaten, welches Sartori, Moser und Schnaubert, mit ihren Abhandlungen malen, aufzuzeigen. Insgesamt vermitteln die Preisschriften eine detaillierte Darstellung von den „Krummstabländern“ des deutschen Reichs Ende des 18. Jahrhunderts.8 Im darauf folgenden Punkt 3.4 soll die Bedeutung der Frage analysiert und bewertet werden. Im Fazit wird das Ergebnis dieser Arbeit zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Ausgangslage
- 2.1 Unvereinbarkeit von geistlichem Amt und landesherrlicher Stellung
- 2.2 Militär
- 2.3 Wirtschaft
- 2.4 Sozialwesen
- 2.5 Bildung, Kunst und Kultur
- 3. Die Preisfrage des Fuldaer Domherrn von Bibra
- 3.1 Biographie Philipp Anton von Bibra
- 3.2 Preisschriften
- 3.2.1 Joseph von Sartori
- 3.2.2 Friedrich Carl Freiherr von Moser
- 3.2.3 Joseph Andreas Schnaubert
- 3.3 Vergleich der Preisschriften
- 3.3.1 Bild der Geistlichen
- 3.3.2 Sozialwesen
- 3.3.3 Erziehung durch die Geistlichen
- 3.3.4 Wahlkapitulationen
- 3.4 Bedeutung der Preisfrage
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Preisfrage des Fuldaer Domherrn Philipp Anton von Bibra, die im Jahr 1786 im „Journal von und für Deutschland“ veröffentlicht wurde. Bibras Frage, worin die Mängel der geistlichen Staaten lagen und wie diese zu beheben seien, spiegelt die Debatte um die Modernisierung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation im 18. Jahrhundert wider. Die Arbeit analysiert die historischen Hintergründe und den Kontext, in dem Bibras Preisfrage entstand, sowie die zentralen Argumente der Preisschriften, die auf diese Frage eingingen.
- Die Kritik an der Unvereinbarkeit von geistlichem Amt und landesherrlicher Stellung
- Die Rolle der geistlichen Staaten im Sozialwesen, in der Wirtschaft und im Bildungswesen
- Die Bedeutung von Wahlkapitulationen und der Frage nach der Legitimität der Herrschaft geistlicher Fürsten
- Die Entwicklung der Aufklärungsideen im Kontext der geistlichen Staaten
- Die historische Relevanz von Bibras Preisfrage als „Präludium der Säkularisation“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den historischen Kontext der Preisfrage von Bibra vor und erläutert die Relevanz des Themas. Kapitel 2 beleuchtet die Ausgangslage der geistlichen Staaten im 18. Jahrhundert, indem es die Vor- und Nachteile der „Krummstabländer“ im Vergleich zu den protestantischen Gebieten untersucht. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Kritik an der Unvereinbarkeit von geistlichem Amt und landesherrlicher Stellung. Kapitel 3 analysiert die Preisschriften von Joseph von Sartori, Friedrich Carl Freiherr von Moser und Joseph Andreas Schnaubert, die auf Bibras Frage antwortend die Mängel der geistlichen Staaten aufzeigten. Das Kapitel fokussiert auf die unterschiedlichen Perspektiven der Autoren hinsichtlich des Bildes der Geistlichkeit, des Sozialwesens, der Erziehung und der Wahlkapitulationen. Die Bedeutung der Preisfrage für die Debatte um die Säkularisation wird in Kapitel 3.4 betrachtet. Das Fazit fasst die zentralen Erkenntnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den geistlichen Staaten im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, insbesondere im 18. Jahrhundert. Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Geistliche Staaten, Säkularisation, Aufklärung, Preisfrage, Wahlkapitulationen, Friedrich Carl Freiherr von Moser, Joseph von Sartori, Joseph Andreas Schnaubert, Germania Sacra, Krummstabländer.
Häufig gestellte Fragen
Was war die Preisfrage des Domherrn von Bibra?
Er fragte 1786 im „Journal von und für Deutschland“, worin die Mängel der geistlichen Staaten lagen und wie diese zu beheben seien.
Warum wurden die "Krummstabländer" im 18. Jahrhundert kritisiert?
Kritisiert wurde vor allem die Unvereinbarkeit von geistlichem Amt und landesherrlicher Stellung sowie Defizite in Militär, Wirtschaft und Bildung.
Welche Autoren antworteten auf die Preisfrage?
Die Arbeit analysiert die Schriften von Joseph von Sartori, Friedrich Carl Freiherr von Moser und Joseph Andreas Schnaubert.
Was versteht man unter "Wahlkapitulationen"?
Das waren Verträge, die ein gewählter geistlicher Fürst vor seinem Amtsantritt mit dem Domkapitel abschließen musste, um seine Machtbefugnisse festzulegen.
Warum gilt Bibras Preisfrage als „Präludium der Säkularisation“?
Weil sie die öffentliche Debatte über die Existenzberechtigung geistlicher Staaten befeuerte, die schließlich 1803 mit dem Reichsdeputationshauptschluss endete.
- Arbeit zitieren
- Sina Ramsperger (Autor:in), 2017, "Unterm Krummstab ist gut leben?" Die Preisfrage des Fuldaer Domherrn von Bibra, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/368492