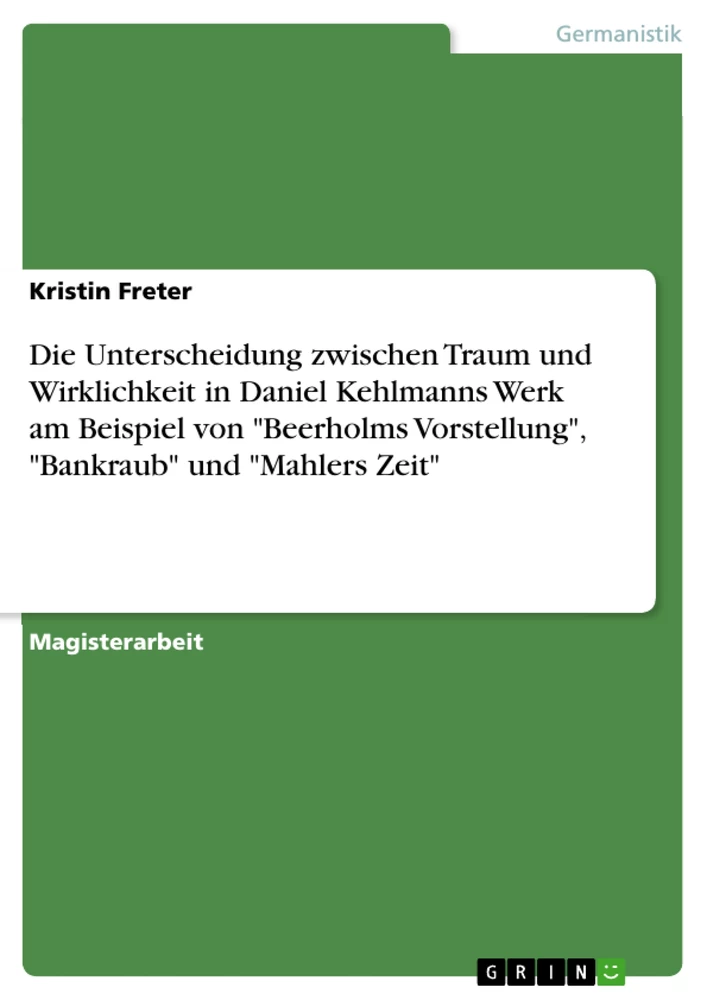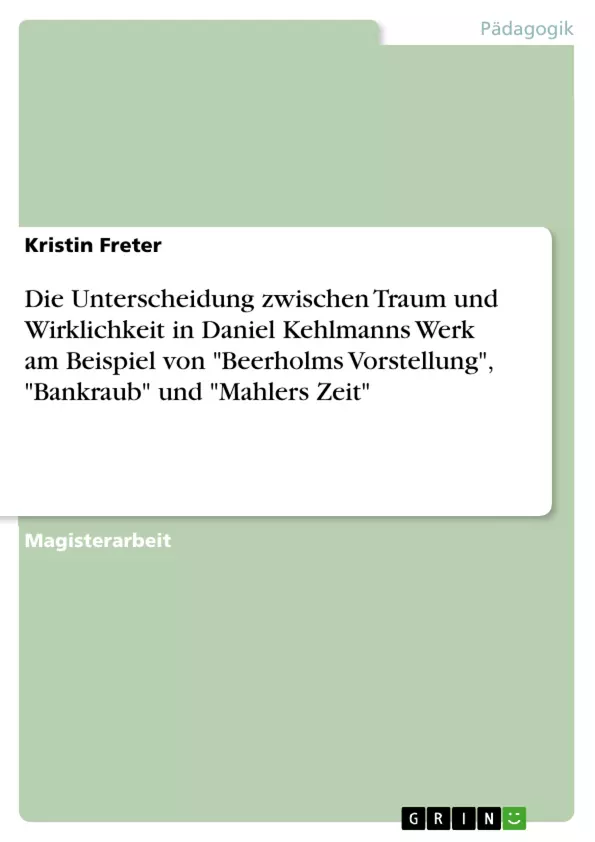Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen die frühen Veröffentlichungen Kehlmanns, Beerholms Vorstellung (1997), Bankraub (1998) und Mahlers Zeit (1999).
Die Beschränkung auf Kehlmanns Frühwerk ist dessen Thematik geschuldet – auch wenn sich das Traummotiv durch all seine Werke zieht, spielt es besonders in den Jahren vor der Jahrtausendwende eine vorherrschende Rolle. Gemeinsam ist den hier vorgestellten Werken, dass sie keine eindeutige Auslegung zulassen. Kehlmanns Umgang mit der Traum-Wirklichkeits-Thematik entspricht insofern einer postmodernen Ästhetik, als dass er keinen Anspruch auf „so etwas wie [eine] verbindliche Wahrheit oder einen Zugriff auf authentische Realität […]“ erhebt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Traumwirklichkeiten als Genremerkmal
- 1.1 TRÄUMEN UND SCHREIBEN
- 1.2 KEHLMANNS GEBROCHENER REALISMUS
- 2. Gesteuerte Träume - Beerholms Vorstellung (1997)
- 2.1 SEMANTISCHE VERKNÜPFUNGEN DES WORTFELDES TRAUM
- 2.2 MARKIERUNGEN DES TRAUMZUSTANDS
- 2.3 BEERHOLMS RINGEN UM WIRKLICHKEIT
- 2.4 UNGEWISSHEIT ALS EINZIGE GEWISSHEIT
- 3. Antithetische Differenzen - Bankraub (1998)
- 3.1 SEMANTISCHE MARKIERUNGEN VON WIRKLICHKEIT
- 3.2 WIRKLICHKEITSKONSTRUKTIONEN
- 3.3 SEMANTISCHE MARKIERUNGEN DER TRAUMSPHÄRE
- 4. Mahlers Traum – Mahlers Zeit (1999)
- 4.1 HALBSCHLAF ALS ZWISCHENFORM
- 4.2 DAS KOHÄRENZKRITERIUM
- 4.3 DER PROPHETISCHE TRAUM
- 4.4 DER TRAUM ALS SUBJEKT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Unterscheidung zwischen Traum und Wirklichkeit in den frühen Werken von Daniel Kehlmann, insbesondere in seinen Romanen "Beerholms Vorstellung", "Bankraub" und "Mahlers Zeit". Dabei wird analysiert, wie Kehlmann die Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit verwischt und den Leser in eine Welt der Ambivalenz und Ungewissheit führt. Die Arbeit befasst sich mit den sprachlichen und stilistischen Mitteln, die Kehlmann verwendet, um die Traum- und Wachzustände seiner Figuren zu kennzeichnen.
- Das Genremerkmal der Traumwirklichkeit in Kehlmanns Werken
- Die semantischen Markierungen von Traum und Wirklichkeit
- Die Konstruktion der Realität in Kehlmanns Romanen
- Die Bedeutung von Träumen und Tagträumen für die Figuren
- Die Frage nach der Unterscheidung von Traum und Wirklichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Traum-Wirklichkeit-Unterscheidung in Kehlmanns Werken ein und stellt das zentrale Zitat aus "Beerholms Vorstellung" vor, das die Durchlässigkeit der Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit veranschaulicht.
Kapitel 1 widmet sich dem Genremerkmal der Traumwirklichkeit in Kehlmanns Werken. Es wird auf die traditionsreiche Verbindung von Traum und Dichtung sowie auf Kehlmanns Anverwandlung des Magischen Realismus eingegangen.
Kapitel 2 analysiert die semantischen Verknüpfungen des Wortes "Traum" in Kehlmanns Roman "Beerholms Vorstellung". Es werden die sprachlichen und stilistischen Mittel beleuchtet, die Kehlmann verwendet, um die Traumwelt des Protagonisten darzustellen.
Kapitel 3 untersucht die semantischen Markierungen von Wirklichkeit im Roman "Bankraub". Dabei wird der Gegensatzpaar Literatur und Arbeit sowie der Transfer von Traum in Wirklichkeit betrachtet.
Kapitel 4 beleuchtet den Roman "Mahlers Zeit" und die Darstellung von Halbschlaf als Zwischenform von Traum und Wirklichkeit.
Schlüsselwörter
Daniel Kehlmann, Traum, Wirklichkeit, Wahrnehmung, Imagination, Magischer Realismus, Genre, Semantik, Stilistik, Postmoderne, "Beerholms Vorstellung", "Bankraub", "Mahlers Zeit".
- Quote paper
- Magistra Artium Kristin Freter (Author), 2014, Die Unterscheidung zwischen Traum und Wirklichkeit in Daniel Kehlmanns Werk am Beispiel von "Beerholms Vorstellung", "Bankraub" und "Mahlers Zeit", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/368572