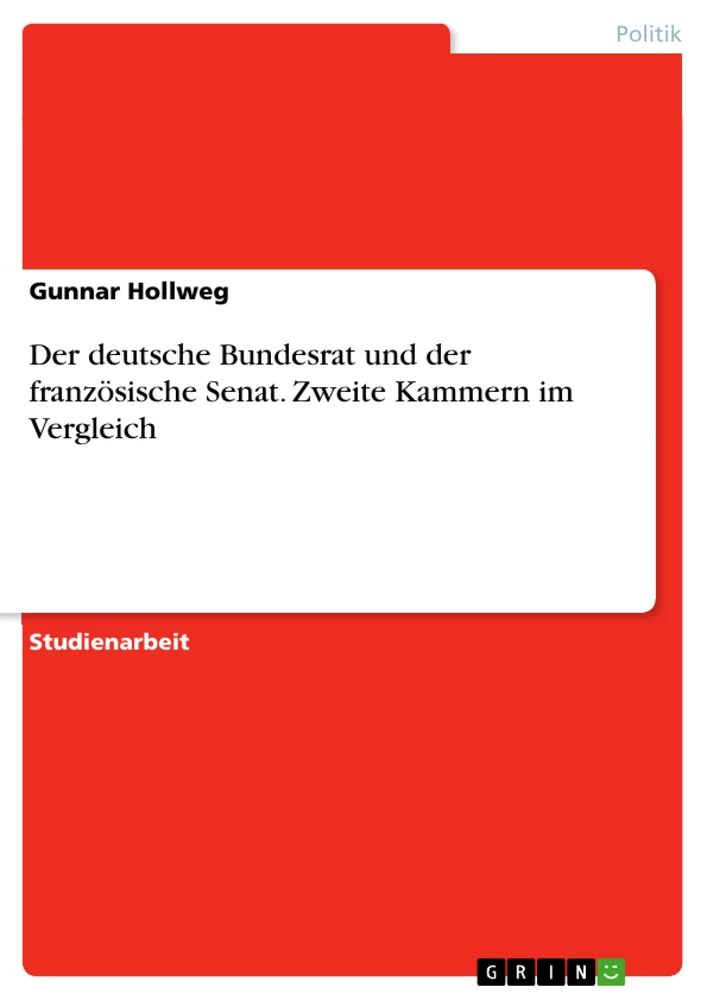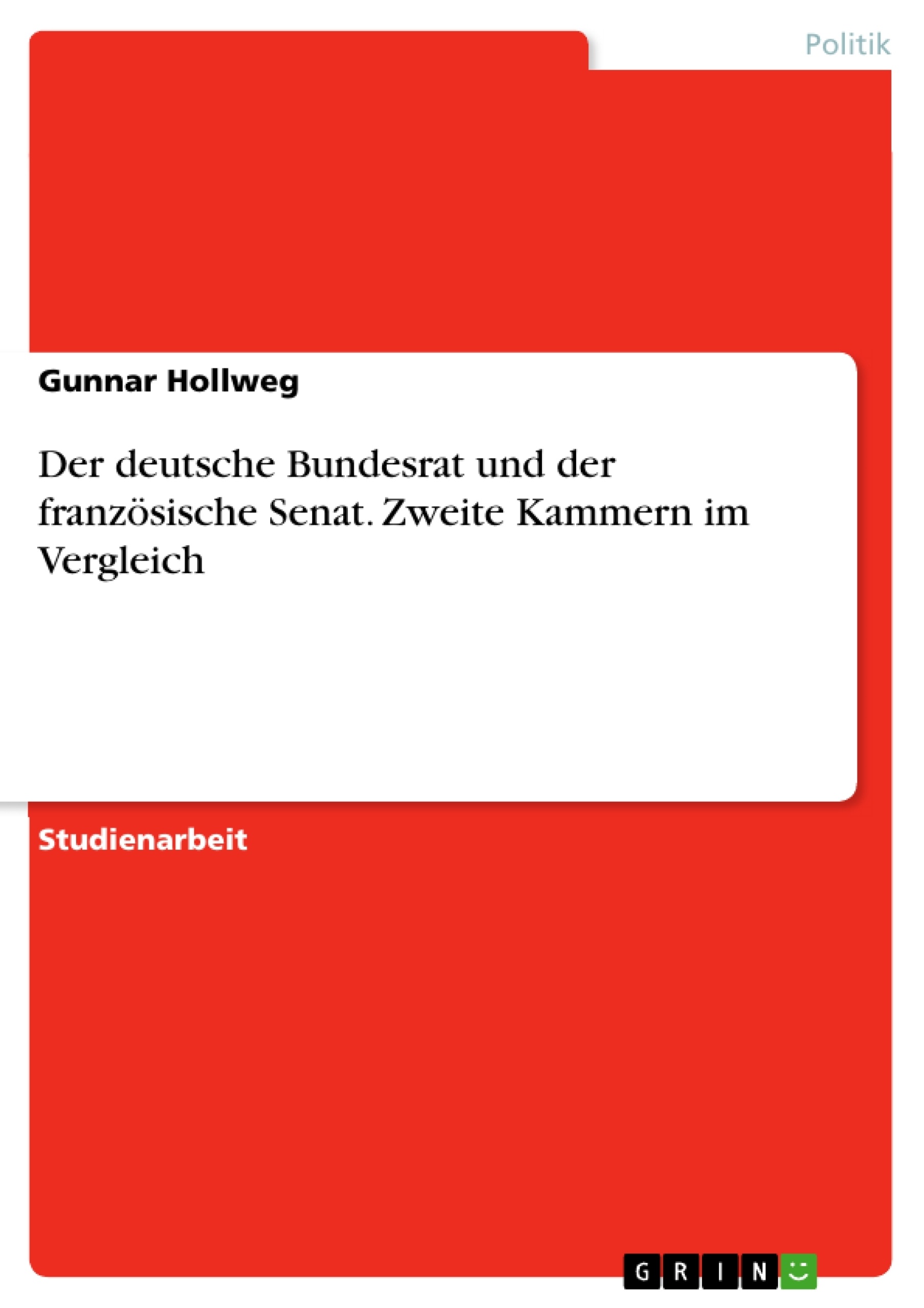Deutschland und Frankreich sind mit Zweiten Kammern ausgestattet: dem deutschen Bundesrat und dem französischen Senat. Im Folgenden sollen die beiden politischen Organe hinsichtlich der Frage untersucht werden, welche der beiden Zweiten Kammern mehr Möglichkeiten hat, auf die aktuelle Politik Einfluss zu nehmen. Diese Arbeit ist in vier Abschnitte unterteilt: Eingangs wird die geschichtliche Entwicklung kurz skizziert und dargestellt, aus welcher Motivation die jeweilige Kammer entstanden ist. Folgend wird beschrieben, wie sich aus den Anfängen der heutige Aufbau entwickelt hat. Anschließend werden Aufgaben und Möglichkeiten zur Einflussnahme auf das politische Geschehen beleuchtet. Anhand dieser beiden Punkte lässt sich die tatsächliche Macht beider Kammern vergleichen. Die Ausarbeitung beschränkt sich dabei auf die heutige Situation der Kammern.
In vielen politischen Systemen unserer Zeit sind Zweite Kammern fester Bestandteil. Sie sind so weit verbreitet, „[…] daß heute rund ein Drittel aller Staaten bikamerale Parlamente haben.“ Dabei stehen Zweite Kammern besonders in der politischen Forschung nur in zweiter Reihe und im Schatten der Ersten Kammern.
Über Zweite Kammern ist intensiv gearbeitet worden. Zum Beispiel in dem von Gisela Riescher herausgegeben umfangreichen Sammelwerk (Zweite Kammern), das 2000 erschien ist. Hier ist ein umfassender Überblick der wichtigsten Zweiten Kammern gegeben. Zudem gibt es zahlreiche Werke, die sich ausschließlich mit dem Bundesrat befassen. Dazu gehört die Arbeit von Gebhard Ziller und Georg-Bernd Oschatz von 1998 (Der Bundestag), das wesentlich detaillierter informiert. Auffällig ist, dass in der deutschen Fachliteratur das französische System als Ganzes intensiv behandelt, der Senat dabei aber nur am Rande thematisiert wurde. Deutlich ist das zu sehen in den Werken von Udo Kempf (Das politische System Frankreichs) von 2007 und von Hans J. Tümmers in „Das politischen System Frankreichs – eine Einführung“ aus 2006. Auch ein direkter Vergleich von deutschem Bundesrat und französischem Senat ist selten zu finden. Das soll nun in dieser Arbeit passieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschichtliche Entwicklung beider Kammern
- Entwicklung des Bundesrates
- Entwicklung des französischen Senats
- Aufbau beider Kammern
- Aufbau des Bundesrates
- Aufbau des französischen Senats
- Aufgabe und Einflussnahme beider Kammern
- Aufgabe und Einflussnahme des Bundesrates
- Aufgabe und Einflussnahme des französischen Senats
- Die Kammern im Vergleich
- Aufgaben
- Möglichkeiten zur politischen Einflussnahme
- Schlussteil
- Fazit
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, welche der beiden Zweiten Kammern, der deutsche Bundesrat und der französische Senat, mehr Möglichkeiten hat, auf die aktuelle Politik Einfluss zu nehmen.
- Geschichtliche Entwicklung beider Kammern
- Aufbau und Zusammensetzung der Kammern
- Aufgaben und Kompetenzen beider Kammern
- Möglichkeiten der politischen Einflussnahme
- Vergleich der Machtverhältnisse und des Einflusses der Kammern
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Diese Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und erläutert die Relevanz von Zweiten Kammern im politischen System. Sie stellt den deutschen Bundesrat und den französischen Senat als Fallbeispiele vor und skizziert den Aufbau der Arbeit.
Geschichtliche Entwicklung beider Kammern
Entwicklung des Bundesrates
Dieses Kapitel beschreibt die geschichtliche Entwicklung des deutschen Bundesrates von seinen Anfängen im Norddeutschen Bund bis zur heutigen Zeit. Es werden die verschiedenen Verfassungsmodelle und die Debatten um die Rolle des Bundesrates im deutschen Föderalismus beleuchtet.
Entwicklung des französischen Senats
Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung des französischen Senats von der III. Republik bis zur V. Republik. Es werden die verschiedenen politischen Systeme und die Veränderungen in der Rolle und Bedeutung des Senats im französischen Staatswesen dargestellt.
Aufbau beider Kammern
Aufbau des Bundesrates
Dieses Kapitel beschreibt den Aufbau und die Zusammensetzung des deutschen Bundesrates. Es erläutert die Stimmrechte der einzelnen Bundesländer sowie die Wahl und die Rolle der Mitglieder im Bundesrat.
Aufbau des französischen Senats
Dieses Kapitel beleuchtet den Aufbau und die Zusammensetzung des französischen Senats. Es beschreibt die Wahl der Senatoren, ihre Funktion und die Besonderheiten des französischen Senats im Vergleich zum deutschen Bundesrat.
Aufgabe und Einflussnahme beider Kammern
Aufgabe und Einflussnahme des Bundesrates
Dieses Kapitel erläutert die Aufgaben und Kompetenzen des deutschen Bundesrates im Gesetzgebungsprozess. Es werden die verschiedenen Möglichkeiten der Einflussnahme des Bundesrates auf die Politik dargestellt.
Aufgabe und Einflussnahme des französischen Senats
Dieses Kapitel beschreibt die Aufgaben und Kompetenzen des französischen Senats im Gesetzgebungsprozess. Es werden die verschiedenen Möglichkeiten der Einflussnahme des Senats auf die Politik dargestellt.
Schlüsselwörter
Zweite Kammern, Bundesrat, Senat, Föderalismus, Gesetzgebung, politische Einflussnahme, Machtverteilung, deutsche Politik, französische Politik, Vergleich,
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptunterschied zwischen dem deutschen Bundesrat und dem französischen Senat?
Der deutsche Bundesrat besteht aus Vertretern der Landesregierungen (Exekutiv-Föderalismus), während der französische Senat durch ein Wahlkollegium aus lokalen Mandatsträgern gewählt wird.
Welche Kammer hat mehr Einfluss auf die Gesetzgebung?
In Deutschland hat der Bundesrat bei Zustimmungsgesetzen ein absolutes Veto. In Frankreich kann die Nationalversammlung bei Uneinigkeit letztlich das letzte Wort behalten, wodurch der Senat oft schwächer positioniert ist.
Wie entstand der französische Senat historisch?
Die Entwicklung reicht von der III. Republik bis zur V. Republik unter De Gaulle, wobei der Senat als stabilisierendes Element gegen radikale politische Umschwünge konzipiert wurde.
Warum werden diese Organe als „Zweite Kammern“ bezeichnet?
In bikameralen Systemen ergänzen sie die direkt gewählte „Erste Kammer“ (Bundestag bzw. Assemblée Nationale), um regionale Interessen (Bundesländer bzw. Kommunen/Departements) zu vertreten.
Wie ist die Stimmverteilung im deutschen Bundesrat geregelt?
Die Stimmen sind nach der Einwohnerzahl der Bundesländer gestaffelt, wobei jedes Land seine Stimmen nur einheitlich abgeben kann.
- Arbeit zitieren
- Gunnar Hollweg (Autor:in), 2017, Der deutsche Bundesrat und der französische Senat. Zweite Kammern im Vergleich, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/368940