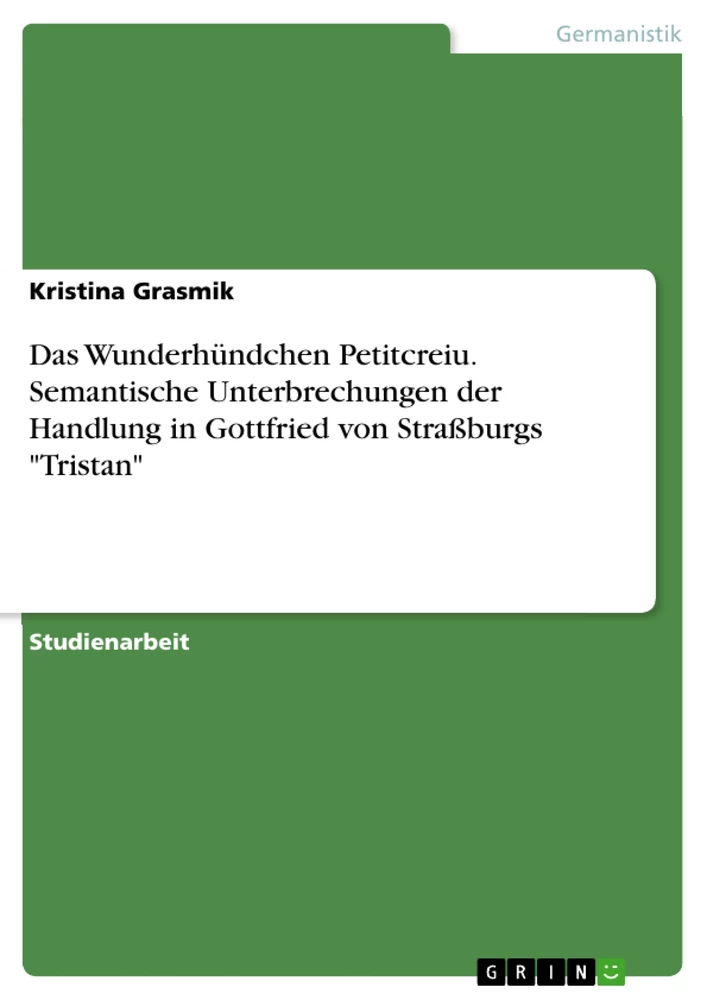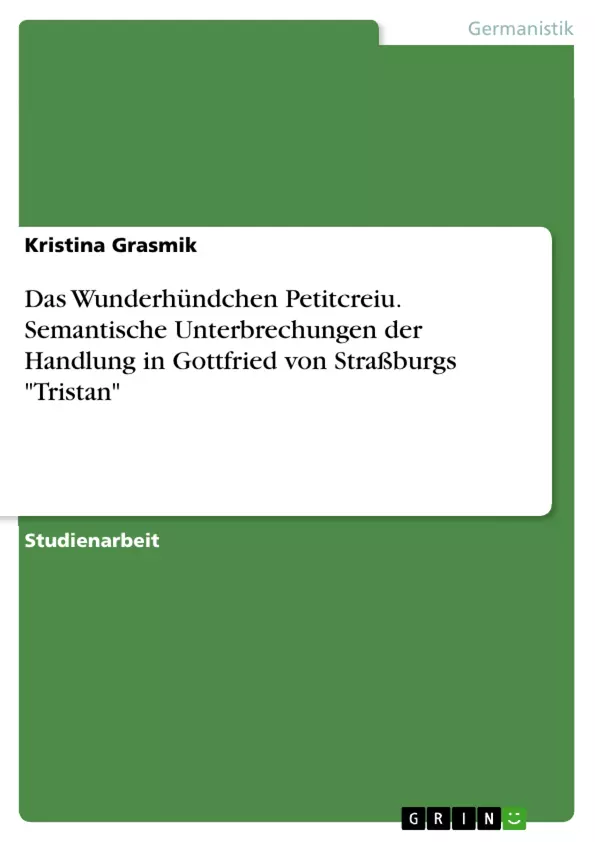In vielen mittelhochdeutschen Romanen tauchten Tiere und Fabelwesen auf. Diese hatten bestimmte Eigenschaften, die in der mittelalterlichen Zeit von Bedeutung waren. Auch spielten Farben im Mittelalter eine große Rolle, die in Verbindung mit Tieren zu wichtigen Deutungsmerkmalen für einige Romanhandlungen werden konnten. Diese Arbeit beschäftigt sich mit diesen Themen am Beispiel des Wunderhündchens Petitcreiu im "Tristan" von Gottfried von Straßburg.
Das Interessante ist, herauszufinden, warum und inwieweit der Hund für die Handlung wichtig ist und warum er plötzlich aus der Handlung verschwindet. Dazu wird zunächst der Wunderbegriff bzw. das Wunderverständnis des Mittelalters geklärt und mit Petitcreiu in Verbindung gebracht. Mit der Farbendeutung Petitcreius kommt eine weitere wichtige Eigenschaft des Mittelalters hinzu, sowie die Frage, was der Hund im Mittelalter für Bedeutungen hatte und wie diese sich im Hündchen Petitcreiu wiederspiegeln.
Außerdem spielt die semantische Unterbrechung im Roman eine große Rolle. Dabei stellt sich die Frage, wie sich diese Unterbrechung äußert. Gibt es weitere Unterbrechungen im Roman? Welche Funktion kann eine semantische Unterbrechung bewirken? Welche Bedeutung hat das Wunderhündchen durch diese Unterbrechung und warum verschwindet es plötzlich?
In der abschließenden Zusammenfassung werden alle Ergebnisse kurz aufgegriffen und erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bedeutung des Wunders im Mittelalter
- Bedeutung von Hunden im Mittelalter
- Bedeutung der Farben Petitcreius
- Semantische Unterbrechung im Tristan-Roman
- Bedeutung des Wunderhündchens für die Handlung
- Warum verschwindet das Wunderhündchen Petitcreiu aus der Handlung?
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert das Wunderhündchen Petitcreiu in Gottfrieds von Straßburgs Tristan. Dabei werden die Bedeutung des Wunders und von Hunden im Mittelalter sowie die semantische Unterbrechung in der Handlung beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Rolle des Hündchens für die Handlung und den Gründen für sein plötzliches Verschwinden.
- Wunderbegriff und Wunderverständnis im Mittelalter
- Bedeutung von Hunden im Mittelalter, insbesondere als Statussymbol, Nutztier und Leitbild für Liebe
- Farbsymbolik und ihre Bedeutung in der mittelalterlichen Literatur
- Funktion der semantischen Unterbrechung im Tristan-Roman
- Die Rolle des Wunderhündchens Petitcreiu in der Handlung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und stellt den Fokus auf das Wunderhündchen Petitcreiu in Gottfrieds von Straßburgs Tristan sowie auf die Rolle von Tieren und Farben in der mittelalterlichen Literatur.
Bedeutung des Wunders im Mittelalter: Dieses Kapitel beleuchtet das Wunderverständnis des Mittelalters und erörtert die Bedeutung von Wundern im Kontext der damaligen Gesellschaft. Es werden auch die verschiedenen Arten von Wundern im Mittelalter diskutiert.
Bedeutung von Hunden im Mittelalter: Dieses Kapitel behandelt die Rolle von Hunden in der mittelalterlichen Gesellschaft und deren Bedeutung als Statussymbole, Nutztiere und Leitbilder für Liebe.
Bedeutung der Farben Petitcreius: Dieses Kapitel analysiert die Bedeutung der Farben Petitcreius im Kontext der mittelalterlichen Farbsymbolik.
Semantische Unterbrechung im Tristan-Roman: Dieses Kapitel erörtert die semantische Unterbrechung im Tristan-Roman und untersucht deren Funktion und Auswirkungen auf die Handlung.
Bedeutung des Wunderhündchens für die Handlung: Dieses Kapitel untersucht die Bedeutung des Wunderhündchens Petitcreiu für die Handlung des Romans.
Warum verschwindet das Wunderhündchen Petitcreiu aus der Handlung?: Dieses Kapitel analysiert die Gründe für das plötzliche Verschwinden des Wunderhündchens Petitcreiu aus der Handlung.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Wunderhündchen Petitcreiu in Gottfrieds von Straßburgs Tristan und beleuchtet die Bedeutung des Wunders, von Hunden und Farben im Mittelalter sowie die semantische Unterbrechung in der Handlung. Schwerpunkte sind das Wunderverständnis des Mittelalters, die Rolle des Hundes als Statussymbol und Nutztier sowie die Farbsymbolik in der mittelalterlichen Literatur.
Häufig gestellte Fragen
Welche Bedeutung hat das Wunderhündchen Petitcreiu in Gottfrieds Tristan?
Das Hündchen Petitcreiu dient als Wunderwesen, das durch seinen Anblick und den Klang eines Glöckchens Kummer vertreiben kann, und ist eng mit der Thematik der Liebe verknüpft.
Was symbolisieren die Farben von Petitcreiu?
Die Farben des Hundes spielen eine zentrale Rolle in der mittelalterlichen Farbsymbolik und dienen als Deutungsmerkmale für die Romanhandlung.
Was ist eine „semantische Unterbrechung“ im Roman?
Es handelt sich um Momente, in denen die lineare Handlung durch wunderbare oder symbolische Elemente unterbrochen wird, um tiefere Bedeutungsebenen zu erschließen.
Warum verschwindet das Hündchen plötzlich aus der Handlung?
Die Arbeit untersucht die Gründe für das Verschwinden, das oft als Notwendigkeit interpretiert wird, wenn die Protagonisten zur Realität ihres Leidens zurückkehren müssen.
Wie wurden Hunde allgemein im Mittelalter wahrgenommen?
Hunde galten als Statussymbole, Nutztiere und oft als Leitbilder für Treue und Liebe in der höfischen Literatur.
Wie definierte man im Mittelalter ein „Wunder“?
Wunder wurden als außergewöhnliche Ereignisse verstanden, die die natürliche Ordnung durchbrachen und oft einen göttlichen oder magischen Ursprung hatten.
- Quote paper
- Kristina Grasmik (Author), 2012, Das Wunderhündchen Petitcreiu. Semantische Unterbrechungen der Handlung in Gottfried von Straßburgs "Tristan", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/369256