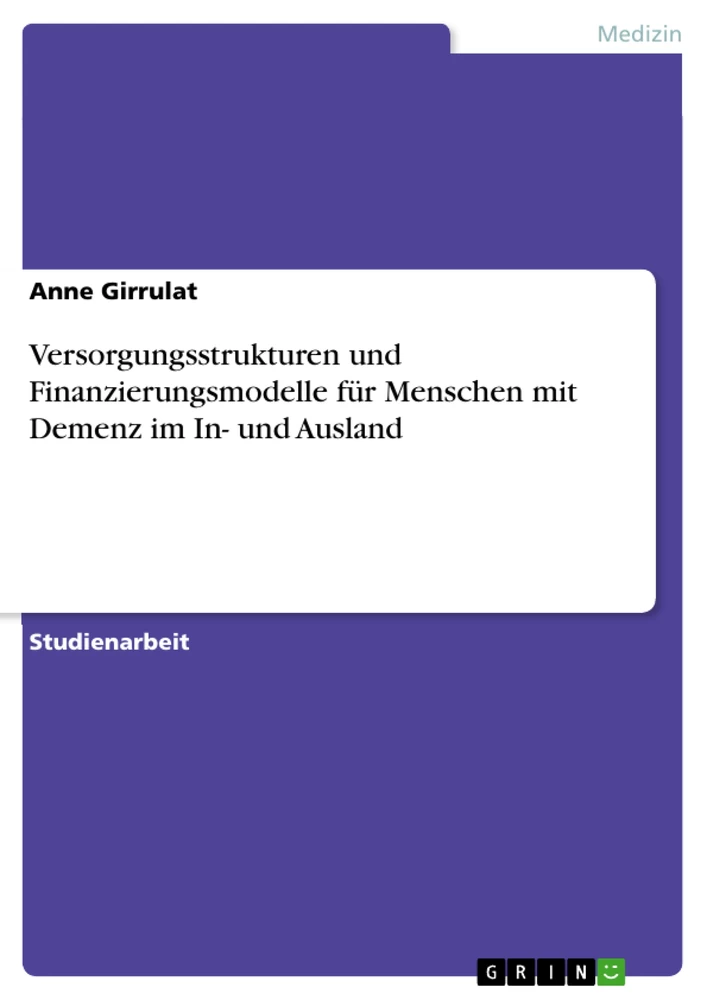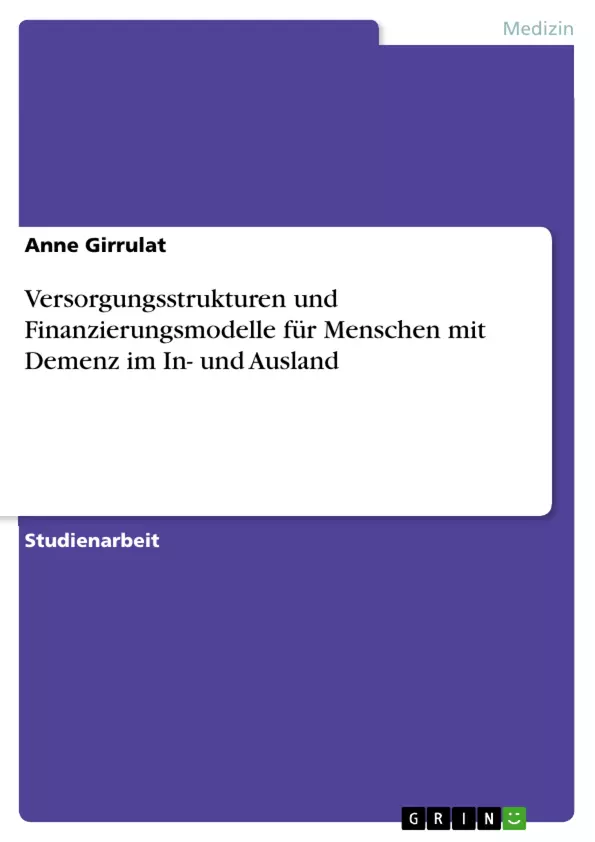Bei diesem Thema geht es mir darum, zu zeigen, welche Strukturen und Konzepte es für Demenzerkrankte Menschen inzwischen in Deutschland und auch anderen europäischen Staaten gibt, um ein lebenswertes und vor dem Hintergrund ethischer und sozioökonomischer Aspekte werterhaltendes Leben zu führen. Aber was ist eigentlich Demenz? Wie verändert sich das Leben durch diese Erkrankung? Ist der Weg in eine stationäre Einrichtung, der Weg, den jeder demente Mensch letztlich gehen muss?
Bis vor einigen Jahren war nur die Unterbringung in eine stationäre Einrichtung der letzte Ausweg für viele Angehörige, die mit der Betreuung und Versorgung der dementen Angehörigen zu Hause überfordert und überlastet waren. Dies hat sich inzwischen grundlegend geändert.
Nach aktuellen Schätzungen leben heute rund 1,3 Millionen Menschen mit Demenz in Deutschland. Im statistischen Schnitt kommen damit auf 100.000 Einwohner 1600 Menschen mit dieser Erkrankung. Bis 2050, so die düstere Prognose der Experten, könnte sich diese Zahl mehr als verdoppelt haben. In der Schweiz, wo Demenzen in der Sterbestatistik erfasst werden, stehen sie nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs an dritter Stelle bei den häufigsten Todesursachen, heißt es in dem Bericht. Diese Tatsache lässt neue Lebensformen und Alternative Lebensmodelle zur klassischen stationären oder ambulanten Versorgung zu.
Die verschiedenen Wohnformen wie beispielsweise ein Dorf für Demente in den Niederlanden zeigen auf, dass es inzwischen weitaus mehr Versorgungskonzepte für dementiell erkrankte Menschen gibt, als es noch vor einigen Jahren der Fall war. Allerdings zählt nicht nur die pflegerische und medizinische Versorgung, sondern auch die Betreuung und Beschäftigung der Dementen Menschen zur Aufgabe in den Einrichtung.
Seit einigen Jahren gibt es in den stationären Einrichtungen den § 87b der beinhaltet, dass Demente durch Alltagsbegleiter zusätzlich betreut werden. Wie sieht diese Betreuung in anderen Wohnformen aus und reicht diese tatsächlich aus? Außerdem spielt die Finanzierung bei der Unterbringung der Demenzerkrankten Menschen eine große Rolle. Es gibt zwei unterschiedliche Finanzierungsmodelle, die von den Staaten angewandt werden. Das Beverege- Modell und Bismarck- Modell sind die Grundlagen für die Absicherungssysteme in vielen europäischen Ländern. Diese möchte ich anhand von Beispielen einiger Staaten erläutern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Demenz
- Definition
- Formen und Häufigkeit
- Pathologie vom Alzheimer Typus
- Pathologie vom vaskulären Typus
- Pathologie vom gemischten Typus
- Differentialdiagnostik
- Symptomatik und Krankheitsverlauf einer Demenz
- Versorgungskonzepte von Menschen mit Demenz
- klassische Versorgungskonzepte
- stationäre Einrichtung
- ambulante Versorgung
- Demenzgerechte Wohnformen
- Wohn- und Hausgemeinschaften
- Das Konzept der Pflegeoase
- Demenzdörfer: Hogewey und Tönebön am See
- klassische Versorgungskonzepte
- Finanzierung
- Finanzierungsmodelle
- Beverige Modell – steuerfinanzierte Absicherung
- Bismarck-Modell – die Absicherung über eine Sozialversicherung
- Finanzierungsmodelle
- Schlusswort/ Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit den Versorgungskonzepten und Finanzierungsmodellen für Menschen mit Demenz im In- und Ausland. Dabei wird das Krankheitsbild der Demenz in seinen verschiedenen Facetten beleuchtet, um ein umfassendes Verständnis der Herausforderungen und Möglichkeiten der Versorgung zu ermöglichen.
- Die unterschiedlichen Formen der Demenz und deren Häufigkeit
- Die verschiedenen Versorgungskonzepte für Menschen mit Demenz, sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich
- Demenzgerechte Wohnformen und ihre Bedeutung für die Lebensqualität von Menschen mit Demenz
- Die Finanzierungsmodelle für die Versorgung von Menschen mit Demenz im In- und Ausland
- Die Herausforderungen und Chancen der Demenzversorgung im Kontext der demografischen Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Demenzversorgung ein und erläutert die Relevanz der Thematik. Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Krankheitsbild der Demenz, definiert den Begriff, beschreibt verschiedene Formen und Häufigkeiten sowie die Symptomatik und den Krankheitsverlauf.
Kapitel 3 widmet sich den Versorgungskonzepten für Menschen mit Demenz. Es werden sowohl klassische Versorgungskonzepte wie stationäre Einrichtungen und ambulante Versorgung als auch moderne Demenzgerechte Wohnformen wie Wohn- und Hausgemeinschaften, das Konzept der Pflegeoase und Demenzdörfer vorgestellt.
Das vierte Kapitel behandelt die Finanzierung der Demenzversorgung. Es werden die beiden prägnanten Finanzierungsmodelle, das Beverige Modell und das Bismarck Modell, im Detail erläutert und ihre Vor- und Nachteile im Kontext der Demenzversorgung diskutiert.
Schlüsselwörter
Demenz, Versorgungskonzepte, Finanzierungsmodelle, Alzheimer-Krankheit, vaskuläre Demenz, stationäre Einrichtung, ambulante Versorgung, Demenzgerechte Wohnformen, Wohn- und Hausgemeinschaften, Pflegeoase, Demenzdörfer, Beverige Modell, Bismarck Modell, Demografische Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Welche modernen Wohnformen gibt es für Menschen mit Demenz?
Neben stationären Heimen gibt es Wohn- und Hausgemeinschaften, Pflegeoasen sowie spezialisierte Demenzdörfer (z. B. Hogewey in den Niederlanden).
Was unterscheidet das Bismarck-Modell vom Beveridge-Modell?
Das Bismarck-Modell basiert auf einer beitragsfinanzierten Sozialversicherung, während das Beveridge-Modell eine steuerfinanzierte Absicherung vorsieht.
Wie viele Menschen mit Demenz leben aktuell in Deutschland?
Nach aktuellen Schätzungen sind es rund 1,3 Millionen Menschen, wobei sich diese Zahl bis 2050 mehr als verdoppeln könnte.
Was ist die Aufgabe von Alltagsbegleitern nach § 87b?
Alltagsbegleiter leisten in stationären Einrichtungen eine zusätzliche Betreuung und Beschäftigung, um die Lebensqualität der dementen Bewohner zu verbessern.
Was ist eine "Pflegeoase"?
Eine Pflegeoase ist ein spezielles Versorgungskonzept für Menschen in einem sehr fortgeschrittenen Stadium der Demenz, das auf Geborgenheit und intensive Betreuung in einem geschützten Raum setzt.
- Quote paper
- Anne Girrulat (Author), 2016, Versorgungsstrukturen und Finanzierungsmodelle für Menschen mit Demenz im In- und Ausland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/369518