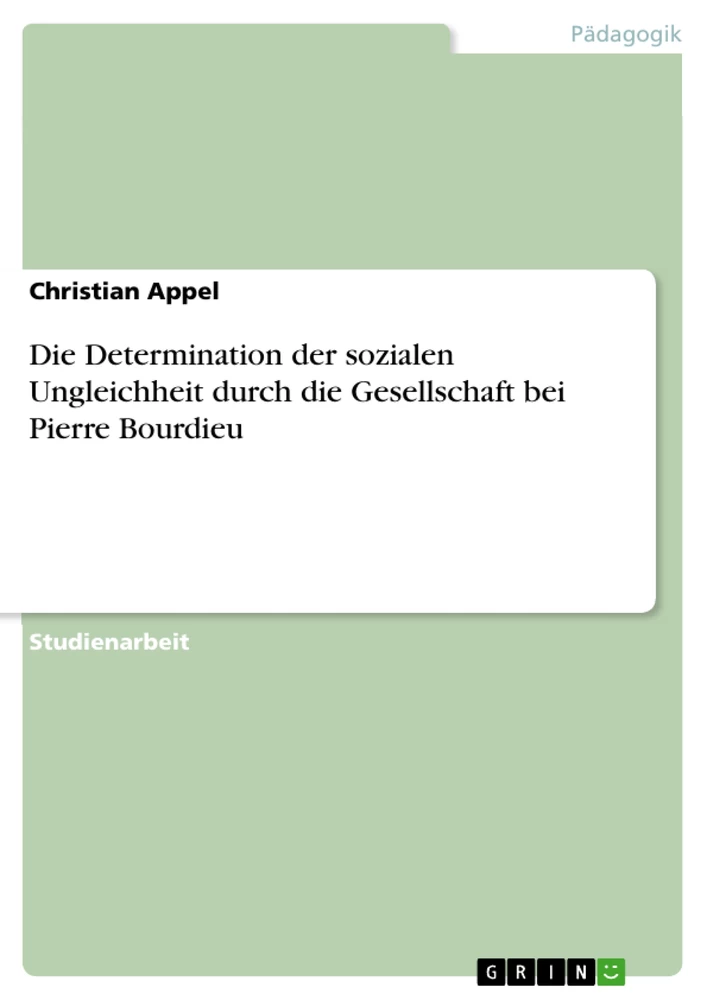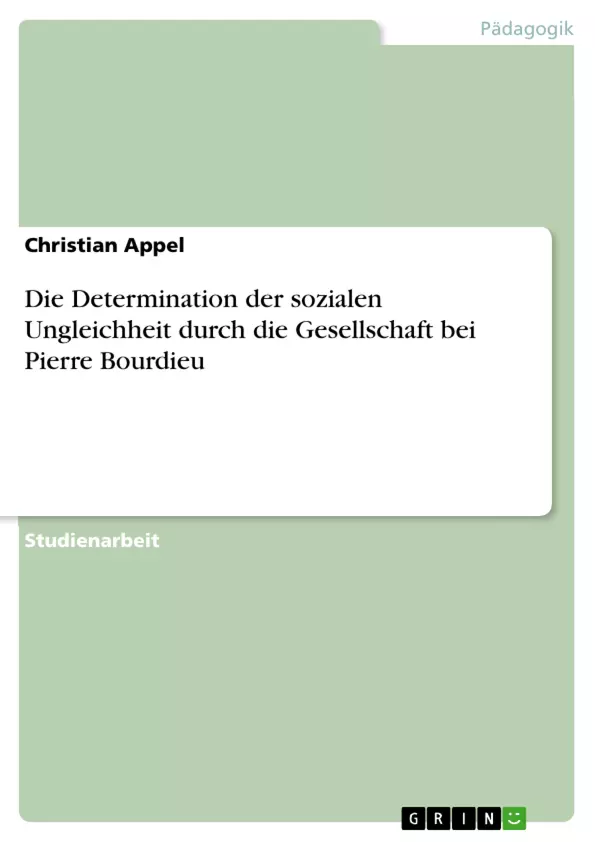Die vorliegende Arbeit verhandelt den Kapitalbegriff Pierre Bourdieus vor dem Hintergrund der Frage nach der Reproduktion von sozialer Ungleichheit durch gesellschaftliche Strukturen.
Es wird ein kleiner Abriss von Bourdieus Arbeiten zum Thema „Gesellschaft und soziale Ungleichheit“ vorgestellt. Diese sollen zusätzlich anhand von aktuellen Forschungsergebnissen illustriert und ggf. kontrastiert werden.
In einem ersten Textabschnitt wird in einer kurzen Zusammenfassung der Text „Ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital“ von Pierre Bourdieu erläutert. Der Wissenschaftler skizziert hier anhand eines von ihm entwickelten Kapitalmodells die Grundzüge der gesellschaftlichen Ordnung und nennt Kriterien, die innerhalb der Gesellschaft für ein Wachstum von sozialer Ungleichheit sorgen.
Ein zweiter Abschnitt geht auf das von Bourdieu entwickelte Habitus-Prinzip ein. Vergesellschaftung sei, so Bourdieu, immer auch Habitualisierung (vgl. Zimmermann 1983). Demzufolge ist auch der Habitus eine Kategorie, die in der Lage ist, die Produktion und Reproduktion sozialer Ungleichheit zu beschreiben.
In einem dritten Teil wird abschließend ein konkreter Blick auf die Situation im französischen Bildungssystem der 60er Jahre geworfen. Anhand des Textes „Bildungsprivileg und Bildungschancen an der Hochschule“ von Pierre Bourdieu und Jean-Claude Passeron sollen dabei die Theorien Bourdieus nochmals exemplarisch angewendet werden. Die beiden Soziologen analysieren hier das Hochschulwesen Frankreichs im Hinblick auf seine soziale Unausgewogenheit, die vor allem zu Lasten der Studenten gehe, die aus einer sozialschwachen Familie stammen.
Schlussendlich soll im folgenden Fazit aufgezeigt werden, welche Zusammenhänge zwischen der Struktur einer Gesellschaft und der Produktion wie Reproduktion sozialer Ungleichheit bestehen und wie diese aufeinander wirken.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Determination der sozialen Ungleichheit durch die Gesellschaft
- Soziale Ungleichheit durch Kapitalmonopole – Bourdieus Kapitalbegriff
- Soziale Ungleichheit durch Klassenprägung – Bourdieus Habitusbegriff
- Soziale Ungleichheit – Ein Beispiel
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit bietet einen Überblick über Pierre Bourdieus Theorien zur sozialen Ungleichheit, insbesondere seine Konzepte von Kapital und Habitus. Sie illustriert Bourdieus Ansatz anhand aktueller Forschungsergebnisse und untersucht die Beziehung zwischen gesellschaftlicher Struktur und der Reproduktion sozialer Ungleichheit.
- Bourdieus Kapitalbegriff (ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital)
- Der Habitus als zentraler Mechanismus der Reproduktion sozialer Ungleichheit
- Die Rolle des Bildungssystems in der Reproduktion sozialer Ungleichheit
- Zusammenhang zwischen gesellschaftlicher Struktur und sozialer Ungleichheit
- Anwendung von Bourdieus Theorien auf das französische Bildungssystem
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der sozialen Ungleichheit und deren Reproduktion ein. Sie benennt zentrale Forschungsfragen und erläutert den Ansatz von Pierre Bourdieu, der die Beziehung zwischen Gesellschaft und sozialer Ungleichheit untersucht. Die Arbeit kündigt eine Zusammenfassung von Bourdieus Arbeiten an, die durch aktuelle Forschungsergebnisse illustriert und gegebenenfalls kontrastiert werden sollen. Besonders die Konzepte des Kapitals und des Habitus werden im Fokus stehen, angewendet auf das französische Bildungssystem der 60er Jahre.
Die Determination der sozialen Ungleichheit durch die Gesellschaft: Dieses Kapitel erörtert Bourdieus Kapitalbegriff, insbesondere die Unterscheidung zwischen ökonomischem, kulturellem und sozialem Kapital. Es wird detailliert beschrieben, wie diese Kapitalformen die gesellschaftliche Ordnung prägen und zur Reproduktion sozialer Ungleichheit beitragen. Bourdieu widerlegt die Vorstellung einer vollkommenen Konkurrenz und Chancengleichheit, indem er aufzeigt, wie die ungleiche Verteilung von Kapital gesellschaftliche Zwänge widerspiegelt. Die Analyse des inkorporierten kulturellen Kapitals betont den Einfluss der familiären Sozialisation und des Bildungssystems auf den Bildungserfolg und verdeutlicht den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildung.
Schlüsselwörter
Soziale Ungleichheit, Pierre Bourdieu, Kapital (ökonomisches, kulturelles, soziales), Habitus, Bildungssystem, Reproduktion sozialer Ungleichheit, Frankreich, gesellschaftliche Machtverhältnisse, soziale Herkunft, Bildungserfolg.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der sozialen Ungleichheit nach Bourdieu
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Pierre Bourdieus Theorien zur sozialen Ungleichheit, insbesondere seine Konzepte von Kapital und Habitus. Sie untersucht, wie gesellschaftliche Strukturen die Reproduktion sozialer Ungleichheit beeinflussen und veranschaulicht dies anhand aktueller Forschungsergebnisse und am Beispiel des französischen Bildungssystems.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Bourdieus Kapitalbegriff (ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital), den Habitus als Mechanismus der Reproduktion sozialer Ungleichheit, die Rolle des Bildungssystems, den Zusammenhang zwischen gesellschaftlicher Struktur und sozialer Ungleichheit sowie die Anwendung von Bourdieus Theorien auf das französische Bildungssystem der 60er Jahre.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel ("Die Determination der sozialen Ungleichheit durch die Gesellschaft"), welches Bourdieus Kapital- und Habitusbegriff detailliert beschreibt, und ein Fazit. Die Einleitung führt in die Thematik ein und benennt die Forschungsfragen. Das Hauptkapitel erörtert die Rolle von Kapitalformen bei der Reproduktion sozialer Ungleichheit.
Wie wird Bourdieus Kapitalbegriff erklärt?
Die Arbeit erklärt Bourdieus Unterscheidung zwischen ökonomischem, kulturellem und sozialem Kapital und wie diese Kapitalformen die gesellschaftliche Ordnung prägen und zur Reproduktion sozialer Ungleichheit beitragen. Es wird gezeigt, wie die ungleiche Verteilung von Kapital zu gesellschaftlichen Zwängen führt und die Vorstellung einer vollkommenen Konkurrenz widerlegt.
Welche Rolle spielt der Habitus in Bourdieus Theorie?
Der Habitus wird als zentraler Mechanismus der Reproduktion sozialer Ungleichheit dargestellt. Er beschreibt inkorporiertes kulturelles Kapital, das durch familiäre Sozialisation und das Bildungssystem erworben wird und den Bildungserfolg beeinflusst. Dadurch wird der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildung verdeutlicht.
Welche Rolle spielt das Bildungssystem?
Das Bildungssystem wird als ein wichtiger Faktor bei der Reproduktion sozialer Ungleichheit dargestellt. Die Arbeit untersucht, wie das Bildungssystem die ungleiche Verteilung von Kapital reproduziert und somit soziale Ungleichheit aufrechterhält.
Auf welches Beispiel wird Bourdieus Theorie angewendet?
Die Arbeit wendet Bourdieus Theorien auf das französische Bildungssystem der 60er Jahre an, um die Zusammenhänge zwischen sozialer Herkunft, Bildungserfolg und gesellschaftlicher Struktur zu veranschaulichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Soziale Ungleichheit, Pierre Bourdieu, Kapital (ökonomisches, kulturelles, soziales), Habitus, Bildungssystem, Reproduktion sozialer Ungleichheit, Frankreich, gesellschaftliche Machtverhältnisse, soziale Herkunft, Bildungserfolg.
- Quote paper
- Christian Appel (Author), 2010, Die Determination der sozialen Ungleichheit durch die Gesellschaft bei Pierre Bourdieu, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/369582