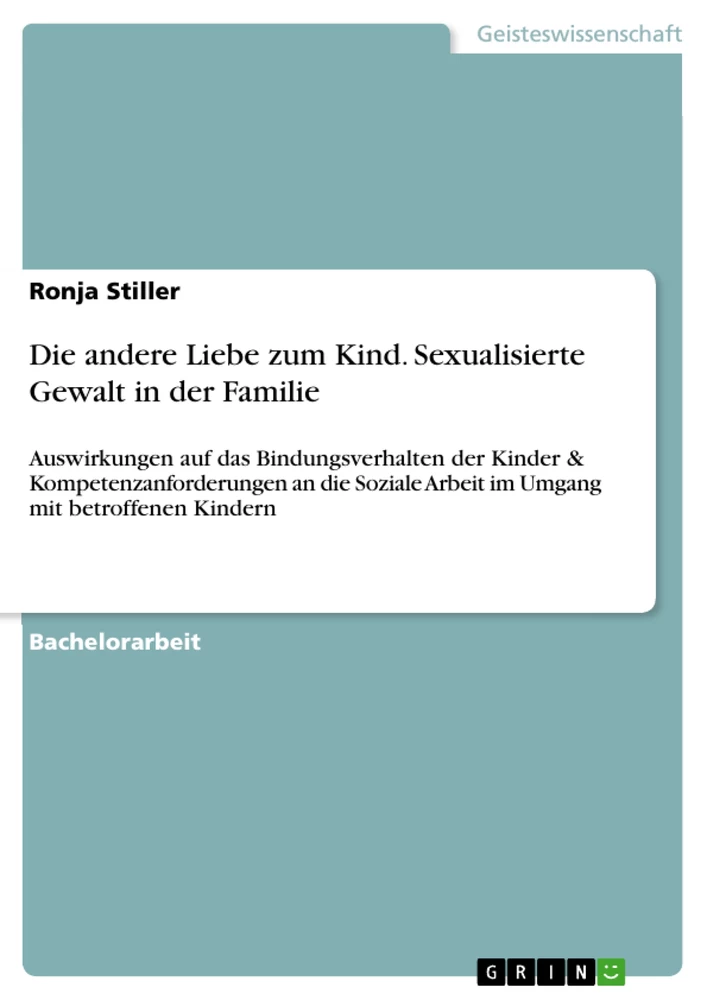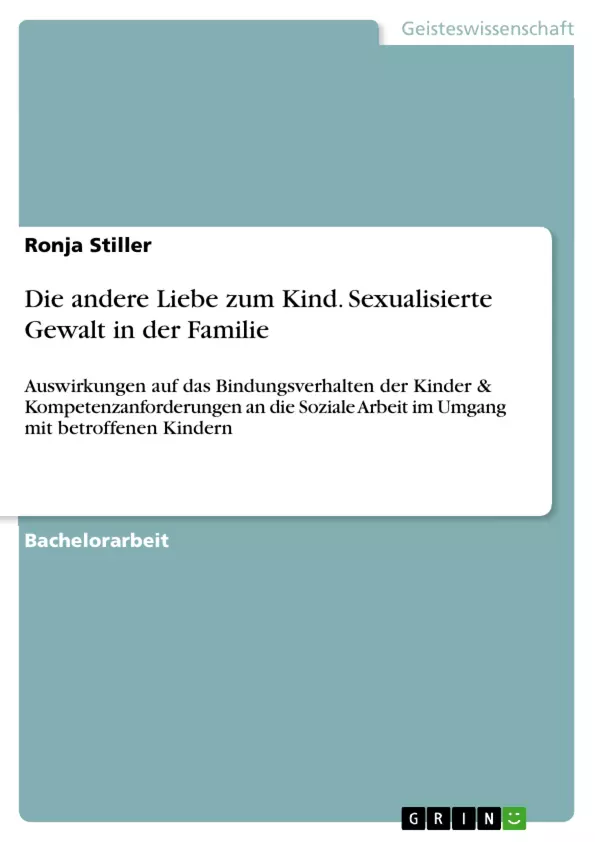Sexualisierte Gewalt ist ein verschwiegenes Thema. Die wenigsten Betroffenen können direkt offen über ihre Erfahrungen sprechen. Auch Kindern fällt das schwer, da sie oftmals von ihren Tätern stark beeinflusst werden und sie die sexualisierten Gewalterfahrungen nicht richtig einordnen können.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema sexualisierte Gewalt innerhalb der Familie, zwischen Eltern und ihren Kindern und soll diese Problematik näher beleuchten.
Die sexualisierte Gewalt an Kindern durch ihre Eltern tritt in vielen unterschiedlichen Formen und Konstellationen auf. Die oben genannten Fallbeispiele sind nur ein Bruchteil an Auszügen von Erfahrungen der grausamen Taten, die Kindern tagtäglich in Deutschland und weltweit zugefügt werden.
Das Erlebte wird von den Kindern unterschiedlich wahrgenommen und verarbeitet. Die möglichen aus der sexualisierten Gewalt resultierenden Folgen und Auswirkungen sind aufgrund dessen sehr vielseitig und lassen sich nicht verallgemeinern. Welches Ausmaß die Folgen haben können, wird diese Arbeit zeigen.
Sie befasst sich mit den konkreten Auswirkungen auf die Bindungsfähigkeit der Kinder und stellt dar, wie diese durch sexualisierte Gewalt beeinflusst wird.
Hierzu wird zunächst eine Einführung in das Thema gegeben, um anschließend die betroffenen Personen und deren Umfeld näher betrachten zu können. Hierbei ist es von großer Bedeutung für das Gesamtverständnis neben den Opfern auch einen Blick auf die TäterInnen zu werfen. Nach Betrachtung der TäterInnen und deren Strategien und Vorgehensweisen in Bezug auf die sexualisierte Gewalt, werden die Auswirkungen auf die Kinder geschildert. Um den Bezug zur Bindungsfähigkeit herstellen zu können, bedarf es einer theoretischen Grundlage. Diese wird in den Unterkapiteln 3.1, 3.2 und 3.3 gelegt. Dieses bietet zum einen eine Definition und einen kurzgefassten Erklärungsansatz zum Thema Traumatisierung während der sexualisierten Gewalterfahrungen. Es wird erläutert, wie sich das Trauma auswirkt, um die Verbindung zur Bindungsfähigkeit herzustellen. Hierfür ist es zum anderen wichtig, die Grundzüge und Entstehungsgeschichte der Bindungstheorie zu kennen. Dazu werden im Unterkapitel 3.2 zwei bedeutende Charaktere der Bindungstheorie und Bindungsforschung und ihre Erkenntnisse vorgestellt. Auch ist es von Bedeutung zu wissen, was unter Bindungsfähigkeit verstanden und woran sie gemessen wird. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Annäherung an das Thema sexualisierte Gewalt
- 2.1 Begriffsdefinition
- 2.2 Wer sind die TäterInnen?
- 2.3 TäterInnenstrategien
- 2.4 Sexualisierte Gewalt als Kindeswohlgefährdung
- 3 Auswirkungen von sexualisierter Gewalt auf Kinder
- 3.1 Das Trauma
- 3.2 Geschichte der Bindungstheorie
- 3.3 Bindungs- und Beziehungsfähigkeit
- 3.4 Bindungsschwierigkeiten als Folge sexualisierter Gewalt
- 4 Professionelle Hilfe und Beziehungsgestaltung
- 4.1 Anforderungen an Fachkräfte (SozialarbeiterInnen) als Bezugspersonen
- 4.1.1 Fachkompetenz
- 4.1.2 Methodenkompetenz
- 4.1.3 Sozial- und Selbstkompetenzen
- 6 Die Inobhutnahme als Ausweg
- 6.1 Rechtsgrundlagen
- 6.2 Möglichkeiten und Ziele
- 7 Fazit der Arbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit dem Thema sexualisierte Gewalt in der Familie und deren Auswirkungen auf das Bindungsverhalten von Kindern. Ziel ist es, ein tiefergehendes Verständnis für die Folgen von sexualisierter Gewalt für Kinder zu entwickeln und die besonderen Kompetenzen aufzuzeigen, die Fachkräfte der Sozialen Arbeit im Umgang mit betroffenen Kindern benötigen.
- Definition und Formen sexualisierter Gewalt
- TäterInnenprofile und -strategien
- Auswirkungen von sexualisierter Gewalt auf das Bindungsverhalten
- Notwendige Kompetenzen für die professionelle Arbeit mit betroffenen Kindern
- Möglichkeiten der Inobhutnahme als Schutzmaßnahme
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Thema sexualisierte Gewalt in der Familie einführt und die Relevanz des Themas für die Soziale Arbeit hervorhebt. Kapitel 2 widmet sich der Definition von sexualisierter Gewalt, betrachtet verschiedene TäterInnenprofile und -strategien und beleuchtet die Bedeutung von sexualisierter Gewalt als Kindeswohlgefährdung. Kapitel 3 analysiert die Auswirkungen von sexualisierter Gewalt auf Kinder, insbesondere die Entstehung von Traumata und die Auswirkungen auf die Bindungs- und Beziehungsfähigkeit.
Kapitel 4 fokussiert auf die professionelle Hilfe für betroffene Kinder und die notwendigen Kompetenzen von Fachkräften der Sozialen Arbeit. Die Anforderungen an Fachkompetenz, Methodenkompetenz sowie Sozial- und Selbstkompetenzen werden ausführlich dargestellt. Kapitel 6 thematisiert die Inobhutnahme als Schutzmaßnahme für Kinder, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Die Arbeit endet mit einem Fazit, das die wichtigsten Erkenntnisse zusammenfasst und den Handlungsbedarf für die Soziale Arbeit im Umgang mit sexualisierter Gewalt hervorhebt.
Schlüsselwörter
Sexualisierte Gewalt, Familie, Kindeswohlgefährdung, Bindungstheorie, Bindungs- und Beziehungsfähigkeit, Trauma, Fachkompetenz, Methodenkompetenz, Sozial- und Selbstkompetenzen, Inobhutnahme, Soziale Arbeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht sexualisierte Gewalt innerhalb der Familie und deren spezifische Auswirkungen auf die Bindungsfähigkeit betroffener Kinder.
Wie beeinflusst sexualisierte Gewalt das Bindungsverhalten?
Durch das Erleben schwerer Traumata entstehen oft tiefgreifende Bindungsstörungen, die das Vertrauen in Bezugspersonen nachhaltig erschüttern.
Welche Strategien nutzen Täter bei sexualisierter Gewalt?
Täter nutzen oft Manipulation, Geheimhaltung und Machtpositionen innerhalb der Familie, um die Kinder zu beeinflussen und die Taten zu verschleiern.
Welche Kompetenzen benötigen Fachkräfte in der Sozialen Arbeit?
Gefordert sind hohe Fach-, Methoden- sowie Sozial- und Selbstkompetenzen, um professionell mit traumatisierten Kindern und deren Umfeld umzugehen.
Was bedeutet „Inobhutnahme“ als Schutzmaßnahme?
Die Inobhutnahme ist eine vorübergehende Unterbringung des Kindes in einem sicheren Umfeld durch das Jugendamt bei akuter Kindeswohlgefährdung.
Welche Rolle spielt die Bindungstheorie in der Arbeit?
Sie dient als theoretische Grundlage, um zu erklären, wie gesunde Bindungen entstehen und wie diese durch Missbrauch zerstört werden.
- Citation du texte
- Ronja Stiller (Auteur), 2016, Die andere Liebe zum Kind. Sexualisierte Gewalt in der Familie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/369961