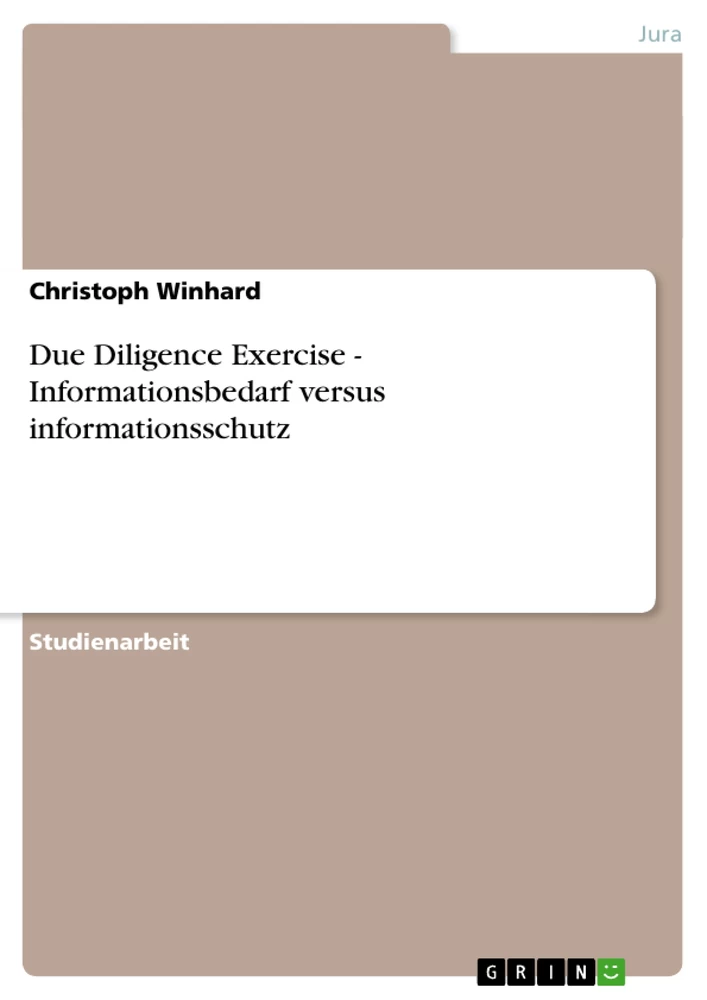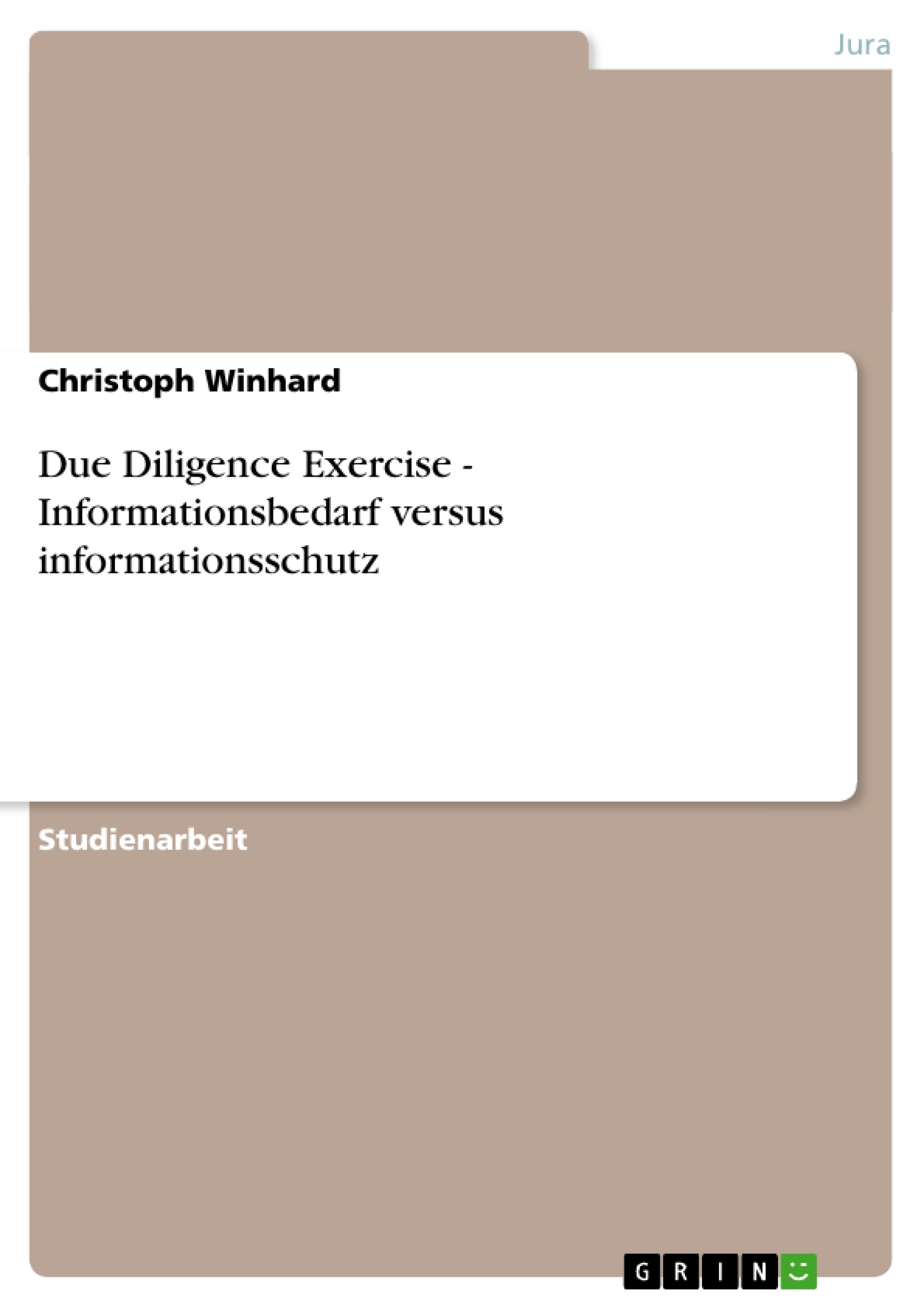Die Due Diligence ist die kaufvorbereitende Untersuchung des Zielunternehmens durch den Käufer1. Das Ziel der Due Diligence besteht für den Käufer darin, einen möglichst umfassenden Informationspool über die rechtlichen, wirtschaftlichen, finanziellen, organisatorischen und sonst wichtigen Verhältnisse des Zielunternehmens anzulegen2. Die Due Diligence ist insbesondere Grundlage für die Kalkulation des fairen Kaufpreises, für die Ermittlung der Chancen und Risiken des Unternehmenskaufs und damit letztendlich Grundlage für die Darstellung des unternehmerischen Risikos, das der Käufer eingehen möchte3. Gerade die Risikoanalyse ist für den Käufer von besonderer Bedeutung, da unerkannte Risiken den gesamten Transaktionserfolg gefährden können4. Anschaulich wird diese Problematik an dem Debakel, das BMW bei der Übernahme von Rover erlebt hat. Die Due Diligence verdient daher besonderes Augenmerk im Rahmen einer Unternehmenstransaktion. Ein sorgfältiger Käufer wird daher regelmäßig ein gesteigertes Interesse daran haben, ein möglichst lückenloses Bild über die Zielgesellschaft zu erhalten. Allerdings besteht dieses Informationsbedürfnis nicht schrankenlos, sondern kollidiert vielmehr mit verschiedenen gegenläufigen Informationsschutzinteressen der Zielgesellschaft, Dritter und der Allgemeinheit. Gegenstand dieser Arbeit ist, das
Zusammenspiel von Informationsbedürfnis und Informationsschutz im Rahmen einer Due Diligence zu untersuchen. 1 Merkt Rz. 602 2 Ziegler DStR 2000, 249; Holzapfel / Pöllath Rz. 12 3 Krüger / Kalbfleisch DStR 1999, 175 4 Brühl M&A 2002, 13
Inhaltsverzeichnis
- §1. Begriff „Due Diligence“
- §2. Der Informationsbedarf des Käufers
- A. Der Unternehmenskauf
- B. Due Diligence und vertragliches Gewährleistungsregime
- C. Due Diligence und gesetzliche Gewährleistungshaftung
- I. Maßgeblicher Personenkreis für Kenntnis oder Kennenmüssen
- II. Positive Kenntnis aus einer Due Diligence
- III. Grob fahrlässige Unkenntnis trotz Due Diligence
- 1.) Unterlassene Due Diligence
- a.) Rechtliche Untersuchungspflicht des Käufers?
- b.) Due Diligence und Verkehrssitte
- c.) Billigkeit als Ausnahme
- 2.) Durchgeführte Due Diligence
- a.) Prüfungsbeschränkung auf Teilbereiche
- b.) Unsorgfältige Due Diligence
- 1.) Unterlassene Due Diligence
- D. Due Diligence und Culpa in Contrahendo
- I. Tatbestandsmäßigkeit der Culpa in Contrahendo
- II. Einwand des Mitverschuldens gem. § 254 BGB?
- E. Zusammenfassung
- §3. Informationsschutz oder die Grenzen des Informationsbedürfnisses
- A. Gesellschaftsrechtliche Grenzen der Informationsweitergabe
- I. Die Informationsordnung in der AG
- 1.) Anspruch auf Auskunftserteilung im Rahmen einer Due Diligence
- 2.) Die Herausgabe von Informationen durch den Vorstand der Zielgesellschaft
- a.) Schweigepflicht des Vorstands gem. § 93 Abs. 1 Satz 2 AktG und Informationsaustausch im Rahmen der Due Diligence
- (1.) Auslegung der Schweigepflicht
- (2.) Due Diligence und Unternehmensinteresse
- b.) Maßnahmen zur Risikobegrenzung
- a.) Schweigepflicht des Vorstands gem. § 93 Abs. 1 Satz 2 AktG und Informationsaustausch im Rahmen der Due Diligence
- II. Die Informationsordnung in der GmbH
- 1.) Rechtsstellung des Käufers
- 2.) Informationsanspruch des veräußerungswilligen Gesellschafters
- a.) Weitergabe der Informationen als „gesellschaftsfremder Zweck“ gem. § 51a Abs. 2 GmbHG
- b.) Weitergabe von Informationen als Verstoß gegen die Treuepflicht
- III. Informationsordnung in der Personengesellschaft
- 1.) Informationsrechte der persönlich haftenden Gesellschafter
- 2.) Informationsrecht des Kommanditisten
- I. Die Informationsordnung in der AG
- B. Datenschutzrechtliche Grenzen des Informationsaustausches
- I. Rechtsgrundlagen des Datenschutzrechts
- II. Grundsätzliches Verbot der Weitergabe personenbezogener Daten
- III. Rechtfertigung der Weitergabe personenbezogener Daten
- IV. Weitergabe von Informationen über kollektivrechtliche Verhältnisse
- V. Zusammenfassung
- C. Insiderrecht und Informationsaustausch
- A. Gesellschaftsrechtliche Grenzen der Informationsweitergabe
- §4. Gesamtzusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Bedeutung und den rechtlichen Rahmenbedingungen der Due Diligence im Kontext von Unternehmenstransaktionen. Ziel ist es, das Zusammenspiel von Informationsbedürfnis des Käufers und Informationsschutz der Zielgesellschaft zu beleuchten.
- Rechtliche und wirtschaftliche Aspekte der Due Diligence
- Der Informationsbedarf des Käufers und seine Bedeutung für die Vertragsverhandlungen
- Gesellschaftsrechtliche und datenschutzrechtliche Grenzen des Informationsaustauschs
- Die Rolle der Due Diligence im Gewährleistungsrecht
- Der Einfluss des Insiderrechts auf den Informationsaustausch
Zusammenfassung der Kapitel
- §1. Begriff „Due Diligence“: Der erste Abschnitt definiert den Begriff der Due Diligence als kaufvorbereitende Untersuchung des Zielunternehmens durch den Käufer. Er erläutert die Ziele der Due Diligence, wie z.B. die Ermittlung des fairen Kaufpreises und die Analyse von Chancen und Risiken.
- §2. Der Informationsbedarf des Käufers: Dieses Kapitel analysiert den Informationsbedarf des Käufers im Detail. Es beleuchtet den Einfluss der Due Diligence auf das vertragliche und gesetzliche Gewährleistungsregime sowie auf die Culpa in Contrahendo.
- §3. Informationsschutz oder die Grenzen des Informationsbedürfnisses: Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit den rechtlichen Grenzen des Informationsbedürfnisses des Käufers. Er analysiert die Informationsordnung in Aktiengesellschaften, GmbHs und Personengesellschaften sowie die datenschutzrechtlichen Aspekte und den Einfluss des Insiderrechts.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Due Diligence, Unternehmenskauf, Informationsbedarf, Informationsschutz, Gewährleistung, Datenschutz und Insiderrecht. Sie analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen und Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Informationsaustausch im Rahmen von Unternehmenstransaktionen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel einer Due Diligence?
Ziel ist die kaufvorbereitende Untersuchung eines Zielunternehmens, um einen umfassenden Informationspool über rechtliche, finanzielle und wirtschaftliche Verhältnisse für die Kaufpreiskalkulation und Risikoanalyse zu schaffen.
Wo liegen die gesellschaftsrechtlichen Grenzen der Informationsweitergabe?
Die Weitergabe kollidiert oft mit der Schweigepflicht des Vorstands (§ 93 AktG) oder der Treuepflicht von Gesellschaftern (GmbH), wobei stets das Unternehmensinteresse gewahrt bleiben muss.
Welche Rolle spielt der Datenschutz bei der Due Diligence?
Es besteht ein grundsätzliches Verbot der Weitergabe personenbezogener Daten. Eine Rechtfertigung ist schwierig und erfordert oft Anonymisierung oder spezielle vertragliche Schutzmaßnahmen.
Wie beeinflusst die Due Diligence das Gewährleistungsrecht?
Eine durchgeführte Due Diligence kann dazu führen, dass der Käufer sich nicht mehr auf Mängel berufen kann, die er bei sorgfältiger Prüfung hätte erkennen müssen (positive Kenntnis oder grobe Fahrlässigkeit).
Was bedeutet „Culpa in Contrahendo“ in diesem Zusammenhang?
Es bezeichnet das Verschulden bei Vertragsschluss. Wenn eine Partei während der Due Diligence falsche Informationen liefert oder wichtige Fakten verschweigt, kann dies zu Schadensersatzansprüchen führen.
Gibt es eine rechtliche Untersuchungspflicht für den Käufer?
Eine generelle gesetzliche Pflicht zur Due Diligence gibt es nicht, jedoch entspricht sie der Verkehrssitte und ist für einen sorgfältigen Käufer zur Risikominimierung unerlässlich.
- Quote paper
- Christoph Winhard (Author), 2003, Due Diligence Exercise - Informationsbedarf versus informationsschutz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37004