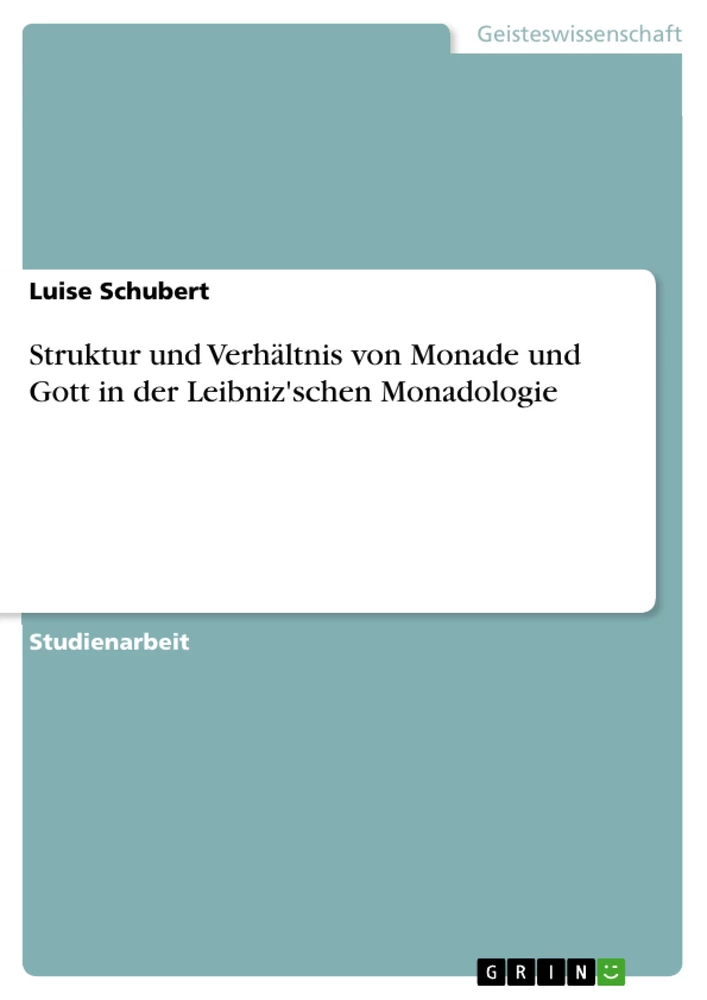Gottfried Wilhelm Leibniz konstruiert 1714 in seiner metaphysischen Abhandlung: „Eclaircissement sur les Monades“, der (später so genannten) Monadologie, eine Wirklichkeit, die auf einfachen Entitäten beruht: den Monaden. Der verdichtete und auf den Adressatenkreis zugespitzte Inhalt der so genannten Monadologie, erscheint in weiten Teilen rätselhaft, verschlüsselt, zusammenhangslos und fremd im mechanistischen Weltbild des 17. und 18. Jahrhunderts, was ihn nicht zuletzt bis heute zum Sujet zahlreicher Fragestellungen in der Forschung macht.
In welcher Korrespondenz stehen sich nun Schöpfer und Geschöpfe gegenüber? Was trennt und verbindet sie und wie wirken sie? Der Fokus dieser Arbeit richtet sich auf das Verhältnis von Verursacher und Verursachtem, insbesondere aus der Perspektive der weltlichen Monade. Dabei sollen sämtliche Begleitaspekte, wie der apriorische Gottesbeweis, das Konzept der bestmöglichen Welt oder die stets präsente Leib-Seele-Problematik, beiseitegelassen werden um den Umfang der Arbeit nicht zu sprengen. Zunächst soll die innere Systematik der Monade umfassend erläutert werden, da sie die Grundlage für alle Konzepte in der Monadologie bildet. Anschließend soll der Gottesbegriff in Bezug auf seine Schöpfungsaktivität und seine Tätigkeit beleuchtet werden, um ihn im Folgenden in die Erkenntnishierarchie einzuordnen.
Schließlich sollen vereinende und gegenläufige Charakteristika zusammengefasst werden. Im Abschluss soll die Leibniz’sche Überlegung eines Gottesstaates als ‚praktische‘ Auswirkung seiner Wirklichkeitskonzeption erläutert werden. Ein Resümee soll die Erkenntnisse der Arbeit abschließend zusammenfassen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Begriff der Monade bei Leibniz
- 3. Die Monade und Gott
- 3.1 Die Schöpfung und das göttliche „Aufleuchten“
- 3.2 Einordnung in die Erkenntnishierarchie
- 3.3 Gegensätzliche und vereinende Strukturen
- 4. Der Gottesstaat und sein vollkommener Monarch
- 5. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Verhältnis zwischen Monade und Gott in Leibniz' Monadologie. Sie konzentriert sich auf die Interaktion zwischen dem Schöpfer und seinen Geschöpfen, ohne dabei auf begleitende Aspekte wie den Gottesbeweis oder die bestmögliche Welt einzugehen. Der Fokus liegt auf der Perspektive der weltlichen Monade.
- Die innere Systematik der Monade
- Gottes Schöpfungsaktivität und seine Tätigkeit
- Einordnung der Monade in die Erkenntnishierarchie
- Vereinende und gegenläufige Charakteristika von Monade und Gott
- Leibniz' Konzept des Gottesstaates
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Monadologie von Gottfried Wilhelm Leibniz ein, beschreibt den historischen Kontext und die Zielsetzung der Arbeit. Sie hebt die Komplexität und Rätselhaftigkeit des Leibnizschen Systems im mechanistischen Weltbild hervor und skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich auf die innere Systematik der Monade, das Verhältnis von Monade und Gott sowie das Konzept des Gottesstaates konzentriert. Der Fokus wird auf das Verhältnis von Schöpfer und Geschöpf aus der Perspektive der weltlichen Monade gelegt, während andere Aspekte der Leibnizschen Philosophie bewusst ausgeklammert werden, um den Umfang der Arbeit zu begrenzen. Die verwendeten Quellen werden genannt.
2. Die Monade bei Leibniz: Dieses Kapitel beschreibt die grundlegende Struktur der Leibnizschen Monade. Die Einfachheit der Monade als unt teilbare, nicht-physische Einheit steht im Mittelpunkt. Im Gegensatz zu atomistischen Vorstellungen wird die Monade als metaphysisch-punktuelle, beseelte Einheit charakterisiert. Ihre Unteilbarkeit und Unveränderlichkeit werden hervorgehoben, sowie die Unmöglichkeit eines natürlichen Entstehens oder Vergehens. Die Abwesenheit von Bewegung innerhalb der Monade und ihre Unbeeinflussbarkeit von außen werden detailliert erklärt, um die fundamentale Eigenständigkeit dieser einfachen Substanzen zu verdeutlichen. Die Verbindung zum Konzept des „punctum physicum“ wird erörtert.
Schlüsselwörter
Monade, Gott, Leibniz, Monadologie, Schöpfung, Erkenntnishierarchie, Gottesstaat, Einfachheit, Perzeption, Appetition, metaphysische Punkte, unteilbar.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Leibniz' Monadologie: Monade und Gott"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Verhältnis zwischen Monade und Gott in Leibniz' Monadologie. Der Fokus liegt dabei auf der Interaktion zwischen dem Schöpfer und seinen Geschöpfen aus der Perspektive der weltlichen Monade. Aspekte wie der Gottesbeweis oder die bestmögliche Welt werden bewusst ausgeklammert.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die innere Systematik der Monade, Gottes Schöpfungsaktivität, die Einordnung der Monade in die Erkenntnishierarchie, vereinende und gegenläufige Charakteristika von Monade und Gott sowie Leibniz' Konzept des Gottesstaates.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Der Begriff der Monade bei Leibniz, Die Monade und Gott (mit Unterkapiteln zur Schöpfung, Erkenntnishierarchie und gegensätzlichen/vereinenden Strukturen), Der Gottesstaat und sein vollkommener Monarch, und Schlussbetrachtung.
Wie wird die Monade bei Leibniz beschrieben?
Die Monade wird als unt teilbare, nicht-physische, metaphysisch-punktuelle und beseelte Einheit charakterisiert. Ihre Unteilbarkeit, Unveränderlichkeit, Unbeeinflussbarkeit von außen und die Abwesenheit innerer Bewegung werden hervorgehoben. Die Verbindung zum Konzept des „punctum physicum“ wird ebenfalls erörtert.
Welche Rolle spielt Gott in der Arbeit?
Gott spielt eine zentrale Rolle als Schöpfer der Monaden. Die Arbeit untersucht Gottes Schöpfungsaktivität und die Einordnung der Monaden in die von Gott geschaffene Erkenntnishierarchie. Das Verhältnis von Schöpfer und Geschöpf aus der Perspektive der weltlichen Monade steht im Mittelpunkt.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, das Verhältnis zwischen Monade und Gott in Leibniz' Monadologie zu untersuchen und die Interaktion zwischen Schöpfer und Geschöpfen aus der Perspektive der weltlichen Monade zu analysieren.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Monade, Gott, Leibniz, Monadologie, Schöpfung, Erkenntnishierarchie, Gottesstaat, Einfachheit, Perzeption, Appetition, metaphysische Punkte, unteilbar.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit folgt einem strukturierten Aufbau mit Einleitung, Kapiteln zu zentralen Aspekten der Monadologie, Zusammenfassung der Kapitel und einer Schlussbetrachtung. Der Fokus liegt auf der klaren Darstellung des Verhältnisses von Monade und Gott.
- Quote paper
- Luise Schubert (Author), 2016, Struktur und Verhältnis von Monade und Gott in der Leibniz'schen Monadologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/370084