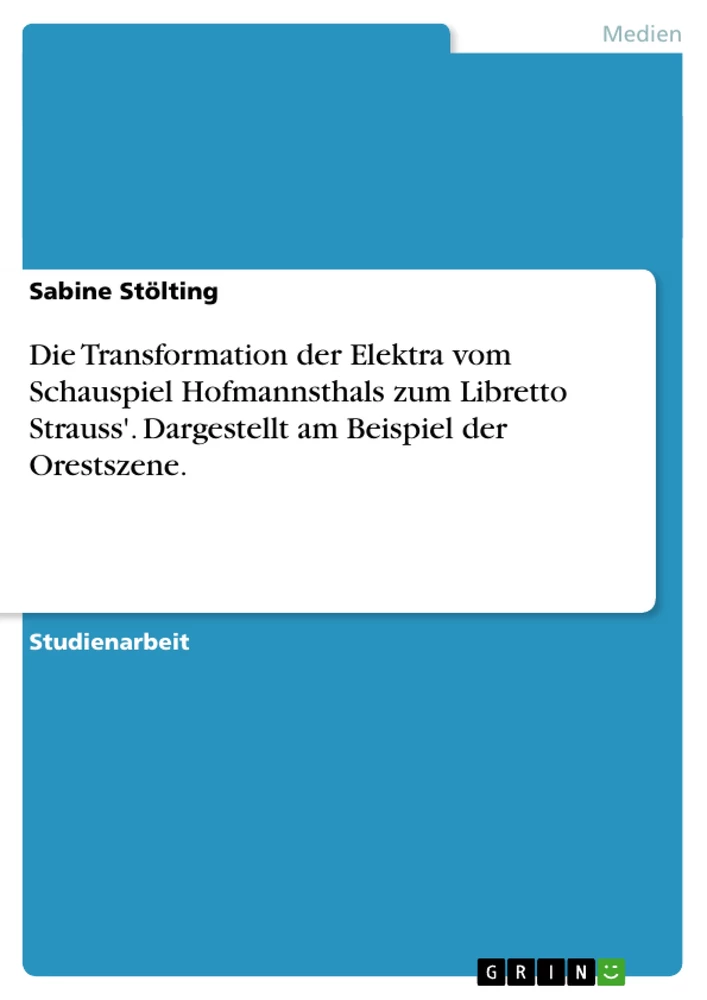Die vorliegende Hausarbeit befaßt sich mit der Transformation des Schauspieltextes Elektra von Hugo von Hofmannsthal in das Opernlibretto zur gleichnamigen Oper von Richard Strauss (Op. 58). Es soll zunächst der Frage nachgegangen werden, warum eine Veränderung des Textes bei der Übernahme in das andere Medium überhaupt notwendig ist. Geklärt werden soll auch, ob sich in bezug auf die Oper, beziehungsweise die daraus beispielhaft ausgewählte Szene, von einer Zusammenarbeit zwischen Hofmannsthal und Strauss sprechen läßt. Im Hinblick darauf wird der Briefwechsel zwischen den beiden Autoren einer näheren Betrachtung unterzogen. Anschließend werden anhand exemplarischer Analysen einzelne Teilszenen auf ihre Veränderungen hin untersucht: „Was wird geändert?“ und: „Wie gravierend sind die Änderungen?“ werden hierbei die Leitfragen sein. Dabei wird sich auch der Gesamtrahmen der Analyse auf die Orestszene beschränken.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Zusammenarbeit Strauss-Hofmannsthal bei dem Libretto zu Elektra
- 3. Die Orestszene
- 3.1 Die Ausgangssituation
- 3.2 Zusammenfassung der Szene bei Hofmannsthal
- 3.3 Die Gewichtung der Szene innerhalb der Oper
- 4. Die Zusammenarbeit in der Orestszene – Untersuchung des Briefwechsels
- 5. Motivation der Änderung des Dramentextes bei der Transformation in die Oper
- 5.1 Intensität und Spannungsverlauf
- 5.2 Allgemeine Änderungen aufgrund der Transformation in ein anderes Medium
- 5.3 Sonstige Motivationen, Publikum, Ort und Zeit
- 6. Analyse
- 7. Zusammenfassung und Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Transformation von Hugo von Hofmannsthals Schauspiel "Elektra" in Richard Strauss' gleichnamige Oper. Das Hauptziel ist es, die Notwendigkeit von Textänderungen bei der Übertragung in ein anderes Medium zu beleuchten und die Zusammenarbeit zwischen Hofmannsthal und Strauss zu analysieren, insbesondere anhand des Briefwechsels. Die Arbeit konzentriert sich auf die Orestszene als Beispiel.
- Die Notwendigkeit von Textänderungen bei der Adaption eines Schauspiels in eine Oper.
- Der Umfang und die Art der Zusammenarbeit zwischen Hofmannsthal und Strauss bei der Entstehung des Opernlibrettos.
- Die Analyse der Veränderungen in der Orestszene und deren Auswirkungen auf die Handlung und Charaktere.
- Die Rolle der musikalischen Gestaltung in der Transformation des Textes.
- Die Berücksichtigung von Aspekten wie Intensität, Spannungsverlauf und Publikumserwartung bei den Änderungen.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und skizziert die Forschungsfrage nach der Notwendigkeit von Textänderungen bei der Adaption von Hofmannsthals "Elektra" in die Oper von Strauss. Sie benennt die Methode, die auf der Analyse der Orestszene und des Briefwechsels zwischen den beiden Künstlern beruht, und umreißt den weiteren Aufbau der Arbeit.
2. Die Zusammenarbeit Strauss/Hofmannsthal bei dem Libretto zu Elektra: Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung des Opernlibrettos und die Zusammenarbeit zwischen Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal. Es analysiert den Briefwechsel zwischen den beiden Künstlern, um den Grad ihrer Kooperation zu bestimmen. Es wird deutlich, dass Strauss anfänglich weitgehend unabhängig vom Dramatiker arbeitete, später aber die Zusammenarbeit enger wurde, insbesondere bei der Schluss- und der Orestszene. Der quantitative Anteil von Hofmannsthals Änderungen am Gesamttext bleibt gering, der Impuls zu den meisten Abwandlungen kommt von Strauss. Trotzdem wird die Zusammenarbeit als Gemeinschaftsarbeit zumindest ansatzweise betrachtet.
3. Die Orestszene: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Orestszene als zentralen Wendepunkt im Stück. Es beschreibt zunächst die Ausgangssituation, in der Elektra nach dem Scheitern ihrer Rachepläne allein dasteht. Die Zusammenfassung der Szene bei Hofmannsthal schildert das Zusammentreffen Elektras mit ihrem Bruder Orest, dessen Identität sie zunächst nicht erkennt. Das Kapitel analysiert die Begegnung und die damit verbundenen emotionalen und dramaturgischen Entwicklungen. Der Fokus liegt auf Elektras Hoffnungen und der Wiedererlangung derselben durch die Rückkehr Orests. Die Szene markiert einen Übergang von Elektras passiver Rolle zu einer aktiven, wobei diese Aktivität aber durch Orests Handeln wieder aufgehoben wird.
Schlüsselwörter
Elektra, Hugo von Hofmannsthal, Richard Strauss, Oper, Libretto, Schauspiel, Transformation, Orestszene, Briefwechsel, Zusammenarbeit, Textänderung, Adaption, Musik, Drama.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Die Zusammenarbeit Strauss-Hofmannsthal bei der Oper Elektra"
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Transformation von Hugo von Hofmannsthals Schauspiel "Elektra" in Richard Strauss' gleichnamige Oper. Der Fokus liegt auf der Analyse der notwendigen Textänderungen bei der Adaption in ein anderes Medium und der Zusammenarbeit zwischen Hofmannsthal und Strauss, insbesondere anhand des Briefwechsels. Die Orestszene dient als Fallbeispiel.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Notwendigkeit von Textänderungen bei der Übertragung eines Schauspiels in eine Oper zu beleuchten. Sie analysiert den Umfang und die Art der Zusammenarbeit zwischen Hofmannsthal und Strauss bei der Entstehung des Opernlibrettos, untersucht die Veränderungen in der Orestszene und deren Auswirkungen, sowie die Rolle der musikalischen Gestaltung bei der Texttransformation. Dabei werden Aspekte wie Intensität, Spannungsverlauf und Publikumserwartung berücksichtigt.
Welche Methode wird verwendet?
Die Arbeit basiert auf der Analyse der Orestszene aus Hofmannsthals Schauspiel und Strauss' Oper, sowie auf der Auswertung des Briefwechsels zwischen den beiden Künstlern. Dies erlaubt es, die Zusammenarbeit und die Gründe für die Textänderungen nachzuvollziehen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, die Zusammenarbeit Strauss-Hofmannsthal beim Libretto zu Elektra, die Orestszene (mit Unterkapiteln zur Ausgangssituation, Hofmannsthals Zusammenfassung und der Gewichtung der Szene), die Zusammenarbeit in der Orestszene anhand des Briefwechsels, die Motivation der Textänderungen bei der Transformation in die Oper (mit Unterkapiteln zu Intensität, allgemeinen Änderungen und weiteren Motivationen), Analyse und Zusammenfassung mit Ergebnissen.
Wie wird die Orestszene behandelt?
Die Orestszene steht im Mittelpunkt der Analyse. Es wird die Ausgangssituation beschrieben, Hofmannsthals Version der Szene zusammengefasst und deren Bedeutung innerhalb der Oper untersucht. Der Fokus liegt auf den emotionalen und dramaturgischen Entwicklungen, Elektras Hoffnungen und dem Übergang von einer passiven zu einer aktiven Rolle.
Welche Rolle spielt der Briefwechsel zwischen Strauss und Hofmannsthal?
Der Briefwechsel dient als zentrale Quelle zur Analyse der Zusammenarbeit zwischen Strauss und Hofmannsthal. Er gibt Aufschluss über den Grad ihrer Kooperation, die Art der Entscheidungsfindung und die Beweggründe für die vorgenommenen Textänderungen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
(Die konkreten Schlussfolgerungen sind im Kapitel "Zusammenfassung und Ergebnisse" detailliert beschrieben. Die FAQ kann an dieser Stelle durch die Zusammenfassung der Ergebnisse aus dem Text erweitert werden.)
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Elektra, Hugo von Hofmannsthal, Richard Strauss, Oper, Libretto, Schauspiel, Transformation, Orestszene, Briefwechsel, Zusammenarbeit, Textänderung, Adaption, Musik, Drama.
- Quote paper
- Sabine Stölting (Author), 2005, Die Transformation der Elektra vom Schauspiel Hofmannsthals zum Libretto Strauss'. Dargestellt am Beispiel der Orestszene., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37013