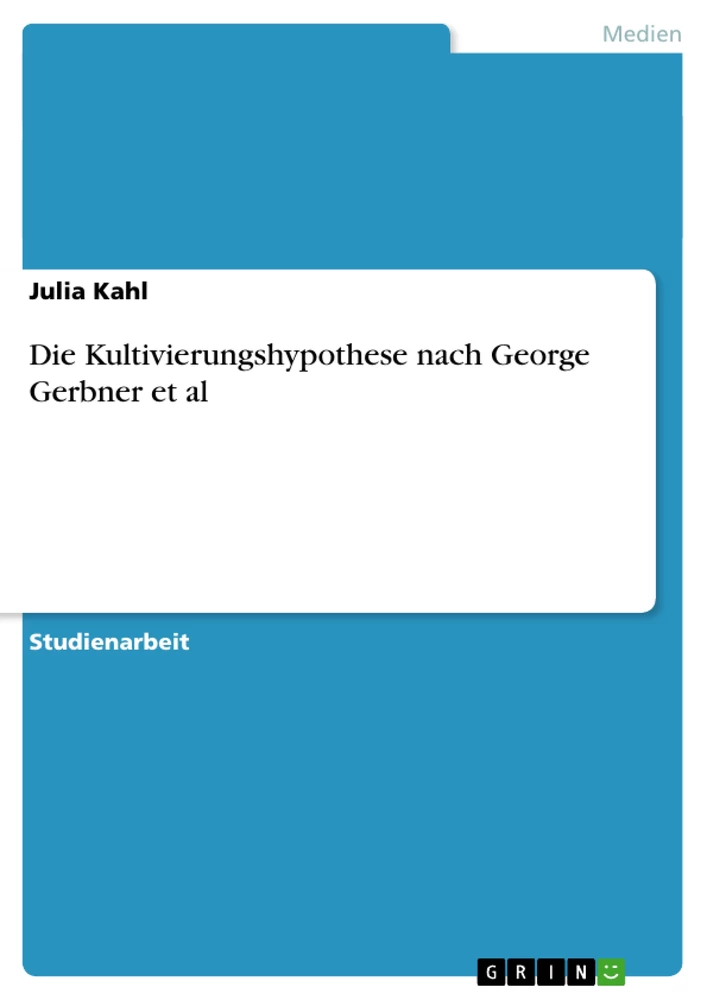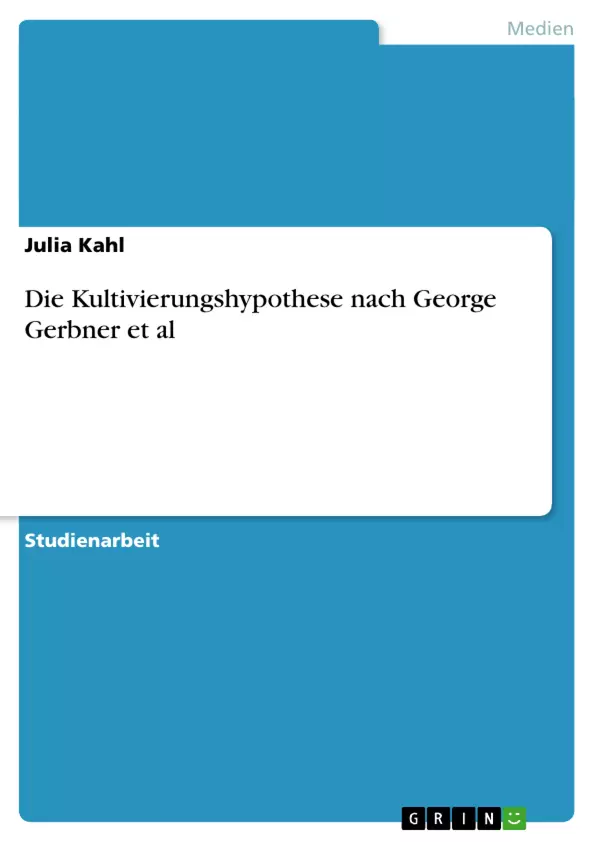Die Fragestellung, ob stetig steigende Gewaltbereitschaft im amerikanischen Fernsehen eine negative Auswirkung auf seine Zuschauer haben könnte, war der Antrieb vieler Sozialwissenschaftler in den USA sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ab Mitte der 60er Jahre sollte die Sachlage anhand von Untersuchungen mehrerer Forschungsteams geklärt werden. Finanzielle Hilfestellung und Koordination sollte dabei von der amerikanischen Gesundheitsbehörde und hier speziell von der Surgeon Generals’s Scientific Advisory Committee on Television and Social Behavior gewährleistet werden. Unter den Teams befand sich auch der Sozialwissenschaftler George Gerbner mit seiner Forschungsgruppe der Annenberg School of Communication der Universität von Philadelphia, die zu ihren eigenen Ergebnissen kamen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Forschungsinitiativen, die sich mit der Fragestellung befaßten, ob mediale Gewalt das Verhalten von Kindern auf negative Weise beeinflussen würde, widmete sich das Team um George Gerbner auch der inhaltsanalytischen Erfassung von Gewalt im Fernsehen. Hierzu wurden entsprechende Experimente und Feldstudien durchgeführt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Entwicklungsgeschichte
- 2. Der Violence Index
- 2.1. Die Berechnung des Violence Index
- 2.2. Victimization Scores und Killer Killed Ratio
- 3. Die Kultivierungsanalyse
- 4. Mainstreaming
- 4.1. Resonanz
- 5. Kritik
- 5.1. Paul Hirsch
- 5.2. Kritik zur Message System Analysis
- 6. Schlusswort
- 7. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Kultivierungsanalyse, einem Forschungsansatz, der die Auswirkungen von Gewalt im Fernsehen auf das Weltbild und das Verhalten von Zuschauern untersucht. Die Analyse entstand aus der Frage, ob die zunehmende Gewaltdarstellung im amerikanischen Fernsehen negative Folgen für die Rezipienten hat.
- Entwicklung und Berechnung des Violence Index
- Die Kultivierungshypothese und ihre zentralen Annahmen
- Die Rolle von Mainstreaming und Resonanz im Kultivierungsprozess
- Kritik an der Kultivierungsanalyse und der Message System Analysis
- Empirische Befunde und Studien zur Medienwirkung von Gewalt
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Entwicklungsgeschichte: Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung der Kultivierungsanalyse und ihre Anfänge in den 1960er Jahren. Es beleuchtet die Forschungsmotivationen und die finanziellen Rahmenbedingungen, die zur Entwicklung der Kultivierungsanalyse führten.
- Kapitel 2: Der Violence Index: Dieses Kapitel stellt den Violence Index vor, ein Instrument zur quantitativen Erfassung des Gewaltgehalts von Fernsehprogrammen. Es erläutert die Berechnung des Index und seine Kritikpunkte, insbesondere die Frage der Vergleichbarkeit von verschiedenen Kennwerten.
- Kapitel 3: Die Kultivierungsanalyse: Dieses Kapitel präsentiert die Kultivierungshypothese als Kern der Kultivierungsanalyse. Es erklärt die Annahme, dass das Fernsehen ein bestimmtes Weltbild kultiviert, das von der Realität abweicht, und beschreibt den Kultivierungseffekt, der insbesondere bei Vielsehern beobachtet wird.
- Kapitel 4: Mainstreaming: Dieses Kapitel widmet sich dem Konzept des Mainstreamings, das die homogenisierende Wirkung von Medien auf die Weltanschauung von Rezipienten beschreibt. Es erläutert die Bedeutung von Resonanz für den Kultivierungsprozess.
- Kapitel 5: Kritik: Dieses Kapitel untersucht Kritikpunkte an der Kultivierungsanalyse, insbesondere von Paul Hirsch. Es analysiert die Kritik an der Message System Analysis und ihren empirischen Befunden.
Schlüsselwörter
Die Kultivierungsanalyse, Violence Index, Message System Analysis, Kultivierungshypothese, Mainstreaming, Resonanz, Gewalt im Fernsehen, Medienwirkung, Weltbild, Medienkonsum, Rezipientenverhalten.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die Kultivierungshypothese von George Gerbner?
Sie besagt, dass langfristiger Fernsehkonsum das Weltbild der Zuschauer prägt und sie dazu bringt, die Realität so wahrzunehmen, wie sie im Fernsehen dargestellt wird.
Was ist der "Violence Index"?
Ein Instrument zur quantitativen Messung von Gewalt im Fernsehprogramm, das Faktoren wie die Anzahl der Gewalttaten und die Rollen von Opfern und Tätern einbezieht.
Was versteht man unter "Mainstreaming" in der Medienforschung?
Mainstreaming beschreibt die Angleichung unterschiedlicher Weltanschauungen bei Vielsehern hin zu einem vom Fernsehen dominierten "Mainstream".
Was bedeutet der Begriff "Resonanz" im Kultivierungsprozess?
Resonanz tritt auf, wenn Fernseherfahrungen mit realen Alltagserfahrungen der Zuschauer übereinstimmen, was den Kultivierungseffekt verstärkt.
Welche Kritik gibt es an Gerbners Ansatz?
Kritiker wie Paul Hirsch bemängeln methodische Schwächen und argumentieren, dass andere soziale Faktoren einen größeren Einfluss auf das Weltbild haben als das Fernsehen.
- Citation du texte
- Julia Kahl (Auteur), 2000, Die Kultivierungshypothese nach George Gerbner et al, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37022